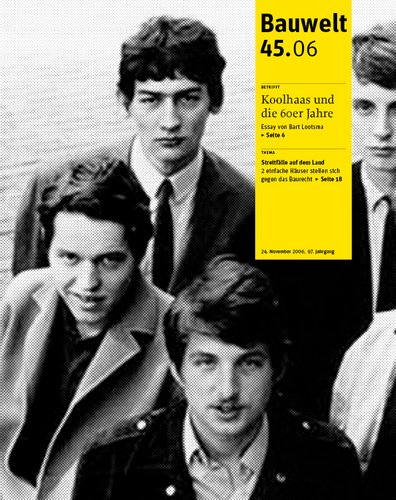Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Staatsarchitektur der Weimarer Republik | Michael Kasiske
03 Stadtansichten Kairo | Urte Schmidt
04 Sanierung des Dunckerviertels in Leipzig | Matthias Grünzig
04 Bericht von der Expo Real | Christian Brensing
BETRIFFT
06 Koolhaas und die niederländische Kultur der 60er Jahre | Bart Lootsma
WETTBEWERBE
14 Barrierefreie Museumsmeile in Paris | Doris Kleilein
16 Auslobungen
THEMA
18 Wohnhaus in Hochstätt | Kaye Geipel
24 Chronologie eines Bauprozesses
26 Skihütte in Lech | Walter Chramosta
32 Wochenendhaus im Schliertal
RUBRIKEN
05 Leserbriefe
36 Kalender
37 Anzeigen