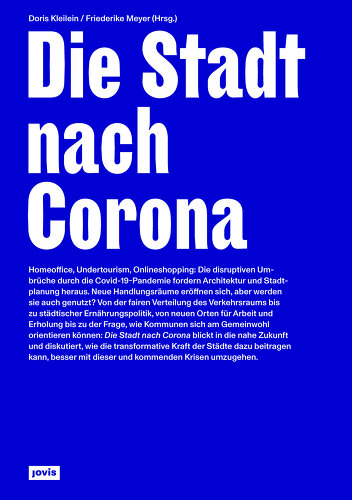BU
Von links nach rechts die Arbeiten „Green Sights“ (1. Preis), „Counter Point“ (2. Preis) und „Alterscape“ (3. Preis)
Lagepläne, Schnitte ohne Maßstab, Perspektiven: Architekten
AUTOR 1 Doris Kleilein
eMail doris.kleilein@springer.com
FOTOGRAF 1 Schindler Award
Att: Nicole Gehrig, Telefon 41 76 564 35 79
nicole.gehrig@ch.schindler.com
Unter Barrierefreiheit verstehen viele Architekten bestenfalls das Hinzufügen einer Rampe. Die Forderung nach einem „Zugang für Alle“ wird als eine weitere Regel im ohnehin komplizierten Baugesetz empfunden. Im Rahmen des Schindler Award haben sich 500 Studenten damit auseinandergesetzt, wie eine Architektur ohne Hindernisse aussehen könnte.
Die Passerelle Debilly, eine Eisenbrücke aus dem 19. Jahrhundert, liegt gegenüber dem neuen Musée Quai Branly unweit des Eiffelturms. Sie überbrückt die Seine und führt hinüber zum Palais de Tokyo, ei¬nem Monumentalbau von 1937, in dem seit einigen Jahren zeitgenössische Kunst gezeigt wird. Wer mit dem Rollstuhl oder dem Kinderwagen von einem Museum zum anderen gelangen will, kann nicht einfach über die Passerelle schlendern, sondern muss einen weiten Umweg in Kauf nehmen: Treppen, Schnellstra¬ßen und Höhenunterschiede zu beiden Seiten des Flusses machen den Spaziergang zum Hindernislauf.
Es war eine komplexe Aufgabe, die der diesjährige Schindler Award gestellt hatte. Eine hindernisfreie Museumsmeile im Herzen von Paris sollte gestaltet werden, dazu ein Besucherzentrum und ein Ausstellungskonzept für die leer stehenden Flächen des Palais, das „Bewusstsein schafft“ – und allen Menschen, auch blinden und tauben, und der in Zukunft immer größer werdenden Gruppe von Gebrechlichen und Altersdementen den Zugang zur Kunst ermöglicht. Wie der Juryvorsitzende Thomas Sieverts, Köln, erläuterte, ging es bei dem zum zweiten Mal ausgelobten Wettbewerb eben nicht um die technisch mach¬bare Lösung für Behinderte, sondern um ein grundsätzliches Umdenken: Der Zugang für alle muss für die junge Architektengeneration gestalterische Herausforderung und Selbstverständlichkeit werden.
Der erste Preis ging denn auch nicht an das spektakulärste architektonische Projekt, sondern an die zurückhaltende, gut durchdachte Arbeit von Marta Neic, Marco Di Nallo und Manfred Sponseiler: Sie setzen der Tyrannei der Achsen, die in Paris regiert, ein spielerisches Band aus Rampen entgegen, das von der Passerelle abzweigt und in den Außenhof des Palais de Tokyo führt. Von der Rampe aus, in deren Zwickel drei „Pocket Parks“ geplant sind, führen Aufzüge in jedes Geschoss des Museums. Auch im Inneren werden die Besucher auf einen Entdeckungspfad geführt, der sich durch die grünen Höfe und Räume der Westfassade schlängelt.
Während Adam Beard und Marie Henrike Haase von der TU Delft mit ihrem Entwurf die Seine umarmen – ein Servicepoint ist am Quai Branly untergebracht, eine holzbeplankte Erweiterung der Passerelle führt zum Besucherzentrum an der bislang tristen Rückseite des Palais am anderen Flussufer –, setzt das siebenköpfige Team aus dem schwedischen Lund auf die große Geste: Eine riesige Glas-Stahl-Brücke ersetzt die Passerelle und bildet einen neuen Platz über dem Fluss. Die gigantische Spielfläche war der Jury einen dritten Preis wert, unter anderem, weil kein einziges Element einen Unterscheid zwischen Behinderten und Nichtbehinderten macht.
Ein Spezialpreis ging jeweils an Tobias Klauser, Lónard Kocan und Silvan Oesterle von der ETH Zürich, die zwar die Aufgabe nicht ganz erfüllt, dafür aber den interessantesten Denkansatz geliefert haben. Unter der Vorgabe „Learning from Dementia“ versuchen sie, eine Umgebung zu entwerfen, in der man sich mit Hilfe von groben Sinneseindrücken (z.B. Fassaden, die Farbe und Form wechseln) orientieren kann. Auch wenn die Projekte etwas vage bleiben: Man hätte sich mehr grundlegende Ansätze dieser Art gewünscht. „Die Architektur ist nicht nur ein Beruf, es ist eine geistige Haltung“ (Le Corbusier), stand auf dem Panel zu lesen.
Bauwelt, Fr., 2006.11.24
verknüpfte ZeitschriftenBauwelt 2006|45 Koolhaas und die 60er Jahre
![]()