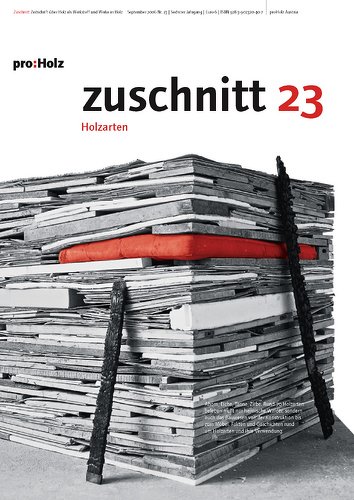Editorial
Die Vielfalt der Holzgewächse und ihrer Eigenschaften – weltweit und in Österreich – ist überwältigend, ihr im Detail gerecht zu werden unmöglich. Der Reiz, das Thema im Zuschnitt vorzustellen, hat also nichts mit einem Anspruch auf Vollständigkeit zu tun.
Vielmehr steht der Wunsch im Vordergrund, die Neugier am innovativen Umgang mit Holz, dessen Potenzial in konstruktiver und gestalterischer Hinsicht beeindruckend und noch lange nicht ausgeschöpft ist, zu wecken und eines der wesentlichen Grundthemen in der Architektur, nämlich das der Bedeutung und des Wesens von Material, zu behandeln.
Eva Guttmann
Inhalt
Zum Thema
Editorial
Eva Guttmann
Holz ≠ Holz
Eva Guttmann
Themenschwerpunkt
Nah bei den Bäumen
Gespräch mit Markus Faißt
Holzarten – Vorrat, Verbreitung und Aufkommen von Baumarten in Österreich
Martin Höbarth
Zu laut gejodelt, aber nicht verstummt
Nora G. Vorderwinkler
Gespräch – Vom Material in der Architektur
Adolf Krischanitz, András Pálffy, Gerhard Steixner, Bettina Götz und Richard Manahl im Gespräch mit Otto Kapfinger
So wie die Weißtanne es will – Geschichte und Gegenwart einer regionalen Besonderheit
Renate Breuß
Es kommt drauf an – Zur Dauerhaftigkeit unbehandelter Hölzer in der Außenanwendung
Notburga Pfabigan
Artenreich – Geschichte(n) vom Holz
Werner Kitlitschka
Laubholz tragfähig und edel
Wolfgang Leeb und Ulrich Hübner
Zu laut gejodelt, aber nicht verstummt
»Wir bauen eine Zirbenstube!« Was anfangs eher für bürointernes Amusement sorgte, fand kürzlich in Vorarlberg seine bauliche Umsetzung – und zwar mehrfach. Insgesamt sechs Zirbenstüble konzipierte die arge Riepl Riepl und Johannes Kaufmann als Aufenthaltsräume für die Bewohner eines Seniorenwohnheims in Dornbirn. Weitab vom gängigen Zirbenstuben-Klischee stehen die geräumigen Stüble für eine gelungene Neuinterpretation einer in Vergessenheit geratenen Holzart. Die derzeitigen Architekturtrends verheißen der Zirbe eine bereits einsetzende Renaissance.
Ursprünglich galt die Zirbe in den alpinen Regionen Mitteleuropas über Jahrhunderte als bevorzugte Holzart für den Innenausbau. Als die raumtypologische Entwicklung des Bauernhauses im 15. Jahrhundert erstmals die Trennung von Küche und Wohnraum hervorbrachte, gewann die Stube zunehmend an Bedeutung. Durch Holzverkleidungen an Decken und Wänden wurde diese zum wichtigsten Aufenthaltsraum des Hauses aufgewertet. Und als Holzart kam dabei meist die Zirbe zum Einsatz, denn ihre großen Bestände im hochalpinen Gebiet lieferten Rohstoff im Überfluss. Als Vorzug dieser weichen Holzart wurde ihre leichte Bearbeitbarkeit von Hand geschätzt. Die reichen Schnitzereien an Stubenelementen standen schon bald als Zeichen für Wohlstand. Zu den üblichen Hochzeitsgaben zählten reich dekorierte Truhen aus Zirbenholz zur Aufbewahrung wertvoller Gegenstände. Hier kam eine bemerkenswerte Eigenschaft des Materials zum Einsatz: dank seiner mottenabweisenden Wirkung ließen sich Festgewänder generationenlang unversehrt in den Truhen aufbewahren. Die Tradition der geschnitzten Zirbenstube entwickelte sich über Jahrhunderte weiter, bis ihr Image in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch exzessiven Einsatz im Namen eines missverstandenen Traditionsbewusstseins zusehends in die Rustikalecke gedrängt wurde.
Die Assoziationen der Zirbe mit üppig geschnitzten, funktionslosen Balkenimitaten und überbordend dekorierten Täfelungen, die bis heute Hotelsuiten und Gaststätten von beachtlichen Dimensionen zieren, hielten sich hartnäckig bis weit in die 1990er Jahre. Als Folge dieses Imageverlustes fand die heimische Kiefernart kaum mehr Absatz, große Bestände lagen brach. Doch eine längerfristige Überalterung der Zirbenbestände ist stets mit einer ökologischen Gefahr verbunden: die niedrigen und äußerst widerstandsfähigen Kieferngewächse sind nicht selten in steilen Hanglagen fest verwurzelt und erfüllen somit eine wichtige Schutzfunktion gegen Lawinen und Hangerosionen.
Einer gemeinsamen Initiative des Tiroler Waldbesitzerverbandes mit den Landesforstdirektionen von Nord-, Südtirol und der Schweiz ist zu verdanken, dass einer Überalterung der Schutzwälder entgegengewirkt werden konnte. Bei einer einberufenen Zirbentagung im Jahr 2000 wurden neben den Möglichkeiten einer Imagekorrektur auch geeignete Vermarktungsstrategien angedacht, um die Zirbe in der zeitgenössischen Architektur wieder zu etablieren. Dazu sollte das uralte Wissen um Materialverhalten und Wirkung des Zirbenholzes wissenschaftlich untermauert werden. Die Forschungsgesellschaft Joanneum Research in Graz führte dazu eine breit angelegte Versuchsreihe durch. Die daraus gewonnenen Ergebnisse lieferten unzählige Argumente, um die lange verkannte Holzart wieder erfolgreich zu vermarkten.
Im Vergleich mit anderen heimischen Nadelholzarten zeichnet sich die Zirbe durch ihr geringes Gewicht aus. Außerdem weist sie das geringste Quell- und Schwindverhalten auf, wodurch sie kaum zur Rissbildung neigt. Das zirbeneigene Terpen Pinosylvin wirkt nachweislich Pilzen und Bakterien entgegen. Zwischenzeitlich werden die wertvollen Holzinhaltsstoffe der Zirbe, die erwiesenermaßen eine äußerst positive und beruhigende Wirkung auf den menschlichen Organismus haben, in Form von Ölen, Seifen und Kissenfüllungen am Markt angeboten. Die eindrücklichsten Laborergebnisse der Grazer Studie belegen nämlich, dass der menschliche Biorhythmus in Räumen mit Zirbeninterieur messbar ruhiger arbeitet, so konnte bei »Zirbenbettschläfern« gar eine durchschnittliche »Ersparnis« von 3500 Herzschlägen pro Tag festgestellt werden. Der positive Einfluss reichte sogar so weit, dass bei den Testpersonen in Zirbenräumen keine Wetterfühligkeit nachweisbar war. Angesichts dieser erstaunlichen Forschungsergebnisse überrascht es kaum, dass die Wiedereinführung des Zirbenholzes beim Bau just in unseren gesundheits- und wellnessorientierten Zeiten erfolgversprechend anläuft.
Dass die positiven Eigenschaften der Zirbe zu wesentlich weitreichenderen Zwecken eingesetzt werden, beweisen die eingangs erwähnten Aufenthaltsbereiche für Betagte von Kaufmann und Riepl Riepl in der Dornbirner Seniorenresidenz. Um diese möglichst gemütlich zu gestalten, stand die Idee des »Vorarlberger Stubencharakters« anfangs tatsächlich im Vordergrund. In Gesprächen mit den künftigen Nutzern der Institution stellte sich heraus, dass die beruhigende Wirkung der Zirbe die heutigen therapeutischen Ansätze in der Altenbetreuung auf ideale Weise ergänzt: »Im modernen Pflegebereich versucht man zunehmend, die Sinne der HeimbewohnerInnen so lange wie möglich zu fördern. Durch den Einsatz der Zirbe wurde die Kombination des Vertrauten mit der Förderung des Geruchs- und Tastsinnes erreicht«, so Johannes Kaufmann. Eben dieser therapeutische Effekt wurde bis in den Garten weiterverfolgt: stark riechende Kräuter sollen die Erinnerungsfähigkeit von schwer dementen Patienten möglichst lange anregen.
Anwendungsgebiete, die dem Zirbenholz seine vielfältigen Talente in ihrem gesamten Umfang abverlangen, sind Bade- und Wellnessbereiche. In hygienischer, konstruktiver und regenerativer Hinsicht entfaltet die Zirbe hier ihr ganzes Können – und ihren charakteristischen Duft, der dank der hohen Konzentration an ätherischen Ölen als besonders lang anhaltend gilt. Diese überzeugenden Tatsachen führten zu einem Siegeszug der Zirbe bei Badezimmern, Schwitzboxen und Ruheräumen.
Die mannigfaltigen Vorzüge einer Zirbenausstattung genießt auch der Bewohner einer Hausmeisterwohnung in Lech am Arlberg, die vom Architektenteam Holzbox im Jahr 2004 ausgestattet wurde. Das maßgeschneiderte Minimalhaus wird dieser Bezeichnung in jeder Hinsicht gerecht: In einer gelungenen Kombination von Zirbeneinbauten und Elementen aus Schichtholzplatten wurde jeder Winkel des ehemaligen Autoliftgebäudes aus den 1980er Jahren auf optimale Weise genutzt. Der Hausmeister, ein überzeugter Wahlvorarlberger, ist von seinem praktischen Einmann-Haushalt begeistert: »Mein Wohlgefühl hier in Oberlech hängt sicher auch mit diesem Wohnraum zusammen.« Und tatsächlich bildet das rundum zirbenverkleidete Interieur des Baues inmitten der hochalpinen Vorarlberger Landschaft eine spürbar authentische Einheit. Armin Kathan vom Holzbox-Team zeigt sich von der Neuinterpretation der geschichtsträchtigen Holzart überzeugt: »Es werden ganz sicher noch weitere Anwendungen von Zirbe in unseren Projekten folgen.«zuschnitt, Mi., 2006.09.20
20. September 2006 Nora G. Vorderwinkler
So wie die Weißtanne es will
(SUBTITLE) Geschichte und Gegenwart einer regionalen Besonderheit
Die Bedingungen für die Weißtanne (abies alba) sind im Bregenzerwald günstig. Auf den Flysch- und Molasseböden erreicht die Weißtanne eine Bestandsdichte von rund 60%. Gut bestockt sind die nordwestlichen Schattseiten der langgezogenen Höhenrücken des Vorderwaldes und die dazwischen liegenden feuchten Schluchten der Achen. Die Vorliebe für niederschlagsreiche und schattige Gebiete verbindet die Tanne mit der Buche. Empfindlich reagiert sie auf Luftverschmutzung und Klimaschwankungen, Ursachen für den drastischen Rückgang des Tannenbestands in Europa. Im Bregenzerwald ist es primär der Wildverbiss, der eine fehlende Verjüngung nach sich zieht.
Die Tanne schmeckt hier nicht nur dem Wild. Aus dem von der Tannenhoniglaus angezapften Saft machen die Bienen den dunklen Weißtannenhonig (erhältlich in den Sennereien), aus den Tannenwipfeln wird ein bewährtes Hausmittel gegen Husten gekocht, der Bast ist der Kaugummi der Kinder. Beim Speckselchen ist die Verwendung von Tannenzweigen Geschmackssache, genauso wie bei den Käsebrettern. Die alten Sennen und Bauern geben der Weißtanne den Vorzug, im modernen Käsekeller in Lingenau lagern 30.000 Käselaibe auf Fichtenbrettern. Was den Unterschied genau ausmacht, ist schwer zu sagen, sicher ist, dass sich der Käse auf beiden Hölzern besser entwickelt als auf Kunststoff.
Die Weißtanne ist ein Baum mit tiefen Wurzeln und hat im Bregenzerwald ihre eigene Geschichte, kulturbildend ist sie für Mensch und Landschaft. Vieles hat man immer schon so gemacht, es funktioniert, das merkt man sich, das ergibt die kulturellen Ausdrucksformen. So wurden die schattseitigen Fassaden am Bregenzerwälder Haus bewusst mit Weißtanne verbrettert, die sonnseitigen mit Fichte. Auch die Dächer waren je nach Orientierung auf einer Seite mit Tannenschindeln, auf der anderen mit Fichtenschindeln bedeckt. Dass die Tanne Feuchtigkeit und Nässe besser verkraften kann, ist über einen differenzierten Einsatz an den alten Holzbrücken (konstruktiv gemischt, seitliche Verbretterung in Weißtanne) und über die Brunnenstuben belegt. Solange diese Praktiken noch lebendig sind, weiß man meist auch noch warum. Doch die Geschichte der Weißtanne hat ihre Brüche, wenn sich Produktions- und Lebensformen ändern, Prioritäten neu gesetzt und Einsatzbereiche vergessen oder – wie die Gegenwart zeigt – erweitert werden.
Eine jahrzehntelange Diskriminierung der Weißtanne ist primär mit den herkömmlichen Mitteln der Verarbeitung verknüpft. Das widerspenstige Holz nutzte das Werkzeug stark ab, beim Flößen und Bewegen der Stämme und Balken fiel zudem ein hoher Feuchtigkeitsgehalt ins Gewicht. Schwerer ist die Weißtanne nur in frischem Zustand, nach einjähriger Lagerung sind Tanne und Fichte gleich schwer. Die Neigung zum Splittern und Reißen setzt der Anwendung ihre Grenzen. Die Weißtanne ist keine Allroundkartoffel. Sie verlangt eine genaue Materialkenntnis und viel Sorgfalt in der Bearbeitung. Wer sich auf sie einlässt und so tut, wie das Material es will, wird dafür mit umsomehr Strahlkraft belohnt. Davon sind heute Architekten, Handwerker und Bauherren überzeugt. Nicht zuletzt dank jüngster Wiederbelebungsmaßnahmen von politischer und öffentlicher Seite.
Der Inbegriff einer verfeinerten Materialisierung in Weißtanne steht nahe dem Dorfplatz in Hittisau. Das dreigeschossige Wohnhaus für die fünfköpfige Familie eines Zimmermanns zeigt sich in vornehmer Zurückhaltung, aufrecht und großzügig. Der Holzbau ist Ausdruck einer gelungenen Zusammenarbeit der Architekten cukrowicz.nachbaur mit den Bauherren Brigitte und Hermann Nenning und basiert auf einem forschenden Umgang mit traditioneller Holzkultur. Subtil fließen Themen und Elemente der unmittelbaren Umgebung in neuer Form ein, in den Fassadengliederungen und Maßstäben, im selektierten und differenzierten Materialeinsatz. Verbaut wurde ausschließlich massives und unbehandeltes Holz, im Umfang von etwa 50 Tannen und Fichten, die alle im nahen Umkreis von Hittisau – großteils im eigenen Wald am Hittisberg – gewachsen sind. Die gesamten Holzbauarbeiten wurden vom Bauherrn eigenhändig in allerhöchster Qualität verarbeitet. Dahinter steckt die Haltung eines Handwerkers, der sein Material kennt, respektiert und liebt. Wenn er ein schönes Brett in seinen Händen halte, dann arbeite er anders, sagt Hermann Nenning. Ein schönes Weißtannenbrett hat enge Jahrringe und stammt von den beiden ersten, astarmen Blöcken. Für die beanspruchten Oberflächen ist es rift-halbrift eingesägt, in Verbindungen ist es auf Gehrung gearbeitet. Die sägerauen und unbehandelten, teils geschliffenen und geölten Böden sind in Nut und Kamm verlegt, im physischen Kontakt sind sie warm und seidig. Die Kultur der Pflege lässt Wände und Decken alle paar Jahre in neuem Glanz erstrahlen, wenn die unbehandelten Oberflächen mit Bürste, Wasser und Molke gefegt werden. Dass die Weißtanne mit ihren matten, grau-violetten Farbtönen auch im Alter nicht vergilbt, vielmehr eine schieferartige Patina entwickelt, ist eine ästhetische Besonderheit.
Das Haus und seine Räume sprechen eine eigene Sprache, leicht und fließend, fast wie ein Gedicht. Dafür wurden die Architekten, die Bauherren und der Zimmermann mit nicht weniger als drei Preisen ausgezeichnet, dem Preis für Neues Bauen in den Alpen, dem Bauherrenpreis und dem Holzbaupreis. Mit der Weißtanne stehen sie auf gutem Fuß.zuschnitt, Mi., 2006.09.20
20. September 2006 Renate Breuß
verknüpfte Bauwerke
Haus Nenning
Vom Material in der Architektur
Holz gehört zu den Materialien, die in der Architektur sowohl konstruktive als auch gestalterische Aufgaben übernehmen. Die verschiedenen Holzarten spielen je nach Eignung in beiden Bereichen eine Rolle. Das folgende Gespräch, wurde von Planenden geführt, die nicht als »Holz-ArchitektInnen« in Erscheinung treten, zum Material also einen neutralen Zugang haben. Hermann Czech, Adolf Krischanitz, András Pálffy, Gerhard Steixner und Bettina Götz und Richard Manahl sollten mit Otto Kapfinger ganz allgemein über die Frage des Materials in der Architektur und im Speziellen über den Einsatz bestimmter Holzarten oder deren Derivate diskutieren. Leider musste Hermann Czech kurzfristig absagen. Das Bild der Bar im Palais Schwarzenberg füllt nun zwar nicht die Lücke seiner Abwesenheit, kann aber als Beitrag »aus dem Off« verstanden werden. Das Gespräch, dessen offizieller Teil nach zwei Stunden endete, hatte von Anfang an eine Richtung eingeschlagen, die mit dem Thema Holzarten im engeren Sinn wenig zu tun hat. Vielmehr wurde es eine inspirierende Unterhaltung über das Wesen des Materials und des Entwerfens als ganzheitlicher Prozess und behandelt damit eines der Grundthemen in der Architektur.
Otto Kapfinger: In Österreich wird Holzbau heute auf sehr hohem Niveau betrieben. Mein Eindruck ist, dass dabei das Konzept meist bei der Optimierung der Leistungsform stehen bleibt, dass die Auseinandersetzung mit räumlichen und formalen Werten im Hintergrund bleibt. Wir wollen hier der Frage nachgehen, an welchem Punkt solche Aspekte ins Spiel kommen, wo das Material nicht nur »seiner Natur gemäß« korrekt behandelt wird, wo dann auch andere Dinge mitschwingen – Ausdruckswerte, die schlichtes Bauen zur Baukunst, zur Architektur machen können. Wir würden von euch und aus eurer Praxis gerne erfahren, wie ihr mit Material umgeht, warum ihr Holz oder ein anderes Material benutzt oder nicht benutzt. Materialien haben eine Kultur, eine Geschichte, verschiedenste Kontexte und Konnotationen, die sich ändern können. Materialien sind nicht unschuldig, nicht nur technisch »objektiv«, sondern voll von weniger quantifizierbaren Bedeutungen, und vielleicht könnt ihr in einer ersten Gesprächsrunde in diesem Sinn euren Zugang zum Material bzw. zum Material Holz darstellen.
Bettina Götz: Was uns am Holz generell gut gefällt ist seine Maßstabslosigkeit. Es ist in jede Richtung offen, das beginnt beim kleinen Schmuckstück und endet bei der großen Halle, es kategorisiert sich nicht selbst.
Richard Manahl: In erster Linie interessiert uns Holz als Plattenware. Man kann es mit fertiger Oberfläche kaufen und es ist vom Möbel- bis zum Hausbau einsetzbar. Insofern ist Holz sehr neutral und universal.
András Pálffy: In unserer Arbeit war es immer wichtig, dass es verschiedene Materialien gibt und zwar verschiedene Materialien in dem Sinn, als es verschiedene Reflexionsoberflächen gibt. Hier kommt also das Licht ins Spiel, und mit diesem Faktor bringt man sehr viel in Bewegung. Das ist aus meiner Sicht das Prinzip der Materialwahl, und hier kann sich Holz in den unterschiedlichsten Facetten natürlich sehr gut einfügen und bestimmendes Moment sein.
Gerhard Steixner: Ich denke, dass Materialien dann besonders gut zur Wirkung kommen, wenn sie kombiniert sind, und in diesem Zusammenhang ist Holz für mich ein hervorragendes Material. Man kennt es am besten, weil man sieht, wie es wächst, weil wir es verstehen und einen emotionalen Zugang dazu haben. Man kann viele konstruktive und gestalterische Funktionen daran binden, insofern ist es für mich auch ein sehr einfaches und wirtschaftliches Material.
Adolf Krischanitz: Ich hatte einen Onkel, der behauptete: »Ich esse Kartoffel nur in veredelter Form, nämlich in Form eines Schweinsbratens.« Ganz ähnlich führt beim Holz die Sublimierung über bestimmte andere Techniken und Vorgänge zu einem veränderten Produkt, das mich dann möglicherweise interessiert. Wichtig ist eine Offenheit in der Architektur, die nicht beliebig sein darf, und auf Holz trifft das sehr zu: Es ist vielgestaltig, aber nicht charakterlos, es ist in jeder Dimension glaubwürdig. Dass Biege-Zug- und Biege-Druckspannung gleich groß sind, verleiht ihm eine Neutralität, die für mich beinhaltet, dass sich das Material Holz von sich selbst emanzipiert.
Otto Kapfinger: Wir sind doch von der klassischen Moderne geprägt, und obwohl ihr jetzt alle in unterschiedlichen Ansätzen sehr positiv über das Material gesprochen habt, liegt in eurer Arbeit das Hauptaugenmerk nicht auf Holz. Ich glaube, dass die Moderne eigentlich holzfeindlich war, oder besser gesagt, dass sie auf Beton, Stahl, Glas fixiert war, und meine Frage lautet, ob eine solche Haltung nicht immer noch mitschwingt, gerade bei ArchitektInnen, die primär im städtischen Kontext leben und arbeiten, wo Holz weniger als struktiver Baustoff angewendet wird, sondern mehr im Bereich der Ausstattung, der Erzeugung von Stimmungen, in Interieurs, wo es eher um die Form als um die Leistung geht.
Adolf Krischanitz: Ich möchte dazu mehrere Dinge ansprechen: Ich habe mich in den späten 1970er Jahren mit amerikanischer Architektur auseinandergesetzt, die damals in einem Material »gedacht« wurde, das weder tragen noch lasten kann, nämlich in Karton. Diese gewichtslose Architektur war einerseits billig – ausgeführt in der regionalen, leichten Holzbautechnik und weiß gefärbelt –, andererseits war sie natürlich ein Abkömmling der puristischen Moderne, welche ebenfalls versucht hatte, die Materialität zu überwinden, alles Erzählerische des Werks zu abstrahieren. Auch das wunderbare Plischke-Haus am Attersee hat etwas Dematerialisiertes an sich, und damit komme ich zu dem, was ich am Anfang über Holz gesagt habe: Das Material emanzipiert sich von sich selbst, es kann seinen Materialstatus jederzeit aufheben, operiert nicht mit den Aspekten des Tragens und Lastens, sondern auf einer anderen Ebene, wo dieser Status zwar manchmal gezeigt wird, aber nicht immer und nicht um jeden Preis. Und dazu kommt noch, dass es Epochen gibt, in denen man mehr mit dem Holzcharakter gearbeitet hat, und solche, in denen man weniger damit gearbeitet hat. Im Barock gab es dann nur mehr die veredelte Form des Holzes, bis hin zur Umkehr – extensiv bemaltes Holz oder Holzimitationen aus Gipsstuck, und in der Moderne gab es dagegen den moralischen Anspruch der Materialehrlichkeit. Ich glaube, dass Holz ein fantastisches Material ist und man die Materiallastigkeit dosieren oder auch unterschiedlich verwenden kann. Ein Problem entsteht dann, wenn immer nur eine Seite gesehen wird, wenn die Leistungsform vollkommen ausgereizt wird und wenn das Semper’sche Prinzip, wonach es darum geht, das Material (und auch die Form) so weit zu treiben, dass es von sich selbst befreit wird, als unmoralisch empfunden wird. Da wird dann ganz streng an einen Werkstoff geglaubt, aber sinnliche Dichte, gestaltete Komplexität entsteht erst, wenn solcher Glaube überwunden wird.
Otto Kapfinger: Adolf Loos war ja auch ein großer Moralist, der viel über die Natur der Materialien gesprochen hat, er hat sich aber auch nicht gescheut, Holzelemente mit Primärfarben zu lackieren, optisch zu verfremden. Daraus ist eine prachtvolle Farbenwelt entstanden, etwa bei den Innenräumen im Haus Khuner oder beim Haus Müller in den oberen Etagen, die es bei den Holzhäusern heute nicht gibt. Es hat zwar in der Holzanwendung seither eine enorme technologische Entwicklung stattgefunden, aber die Diskussion über die Bandbreite der emotionalen, der kulturellen Wirkung muss nachgeholt werden.
Richard Manahl: Form und Wirkung haben auch immer mit der Frage zu tun, wie etwas gefügt ist. Eines der wenigen Projekte, das ich in letzter Zeit kennen gelernt habe und von dem ich denke, dass hier adäquat mit Holz in dieser Richtung gearbeitet wurde, ist die Markthalle von Miller & Maranta in Aarau. Hier wird ganz bewusst Holz verwendet, das Gebäude hebt sich aber durch die Art des Umgangs mit dem Material und die daraus entstandene Wirkung aus dem Holzbau heraus und entfaltet eine ganz neue Bedeutung. Hier wird Holz kulturell eingesetzt und formt ein Gebäude in jene Dimension, die man eben als Architektur klassifiziert.
Otto Kapfinger: Ich frage mich, unter welchen Voraussetzungen ihr eine Holzarchitektur entwerfen würdet, die sublim ist, die nicht nur korrekt ist, sondern auch Witz hat, und die insofern visionär wäre, als sie über das, was heute bei uns so ambitioniert und kompetent gebaut wird, hinausgeht, denn so etwas wie diese Markthalle, das gibt es bei uns eigentlich nicht – mit wenigen Ausnahmen, etwa die Arbeiten von Philip Lutz.
Bettina Götz: Unsere erste Auseinandersetzung mit Holz erfolgte im Rahmen einer Ausstellung. Dabei ging es um einen Wohnbau für Flüchtlinge. Gerade zu der Zeit kamen Brettsperrholzplatten auf den Markt, die uns sofort interessiert haben, weil sie sehr groß sind und man sie wirklich gut fügen und an jedem Punkt befestigen kann, ohne dass man eine besondere Ausbildung dafür braucht – das hat damals sehr gut gepasst. Aber erst jetzt haben wir unser erstes »richtiges« Holzhaus im Burgenland gebaut.
Gerhard Steixner: Diese Platte kann ja alles. Sie ist massiv, sie trägt und man schneidet einfach Löcher hinein. Damit imitiert man ein Mauerwerk, in das man Fenster schneidet – das ist aber eigentlich absurd.
Adolf Krischanitz: Das ist eben die Problematik der sogenannten Materialgerechtigkeit. Man entwickelt Materialien, die immer homogener werden, die immer perfektere Oberflächen, immer mehr Vorteile haben. Man entwickelt neue Werkstoffe, wie z.B. das Brettsperrholz. Das impliziert aber auch neue Entwurfsmethoden, eröffnet tektonische und formale Möglichkeiten, die mit dem Holzbau im klassischen Sinn nichts mehr zu tun haben. Und in diesem Moment geht es darum, die Möglichkeiten, die in dem Werkstoff enthalten sind, aufblitzen zu lassen, spür- und sichtbar zu machen.
Otto Kapfinger: Auch die klassische Moderne war stark von monolithischen Materialien (Stahl, Beton) und von apparativer Ästhetik inspiriert. Das Motiv der Bullaugen etwa kam aus dem Schiffsbau, wo in eine homogene Stahlplatte analoge Öffnungen gestanzt wurden. Dieses Motiv wurde nach 1918 aufgegriffen, dann aber meist im Ziegelbau umgesetzt – eigentlich fragwürdig, denn diese gestanzte, komplexe Öffnung hat wenig mit der Natur der horizontal geschichteten Wand zu tun.
Adolf Krischanitz: Jetzt sind wir genau bei der Frage, die Semper gültig beantwortet hat. Einerseits gibt es natürlich die Materialgerechtigkeit, andererseits die Entwicklung, die ein Material im Lauf der Zeit erfährt. Zum Dritten ist da auch noch der Formwille, der das Material sowohl »überhöhen« als auch »desavouieren« kann, indem das Material zu etwas anderem wird, zu einer raffinierteren Form. Wenn etwas nicht mehr materialgerecht ist, dann muss es etwas anderes sein, etwas Schlechtes oder etwas Gutes. Insgesamt geht es jedenfalls um diese Überwindung der rein technischen Komponenten von Materialien, die freilich auch in eine Artistik ausarten kann, die sinnlos ist, sich nur um sich selbst dreht. Es kann aber auch sein, dass das Material transzendiert, das heißt, dass es mehr darstellt als »ich bin so und so gemacht«, dass es Ausdruckswerte anspricht, dass es so etwas wie ein Symbol wird, und hier fängt eine künstlerische Facette von Architektur an.
Kurt Zweifel: Zum Thema »Sein und Schein«: Ich habe vor zwei Jahren ein großes Spanplattenwerk besucht, nachdem wir am Tag zuvor in einem Furnierwerk gewesen waren. Es war faszinierend zu sehen, mit welch großem Aufwand versucht wurde, möglichst präzise unregelmäßige Abbildungen von Holzoberflächen zu erzeugen, die anschließend auf Spanplatten aufgebracht wurden. Ich muss sagen, dass das Ganze in der Fläche täuschend echt ausgeschaut hat, das vorgetäuschte Bild aber sofort kippte, sobald diese Oberflächen auch über die Schnittkanten weitergezogen wurden.
Gerhard Steixner: Kürzlich habe ich den Katalog einer Pulverbeschichtungsfirma bekommen, die 20 verschiedene »Holzoberflächen« auf Stahl beschichten kann. Das reicht von Eiche über Douglasie bis zu Nuss und schaut perfekt aus. Es gäbe also wirklich alle Möglichkeiten, aus denen wir wählen könnten ...
Eva Guttmann: Warum entscheidet man sich als Architekt dann doch für Holz, für ein bestimmtes Holz oder auch genau nicht für Holz? Was schwingt da mit?
Adolf Krischanitz: Ein wesentlicher Aspekt ist das Weltvertrauen, das langsam schwindet. Wenn man auf die Chromleiste eines Autos greift und die ist warm, dann glaubt man nicht nur, dass irgend etwas mit dem Auto nicht stimmt, sondern auch, das irgend etwas mit einem selbst nicht stimmt. Wir werden von allen möglichen Seiten mit Fälschungen zugeschüttet, so dass wir das Urvertrauen in die Umwelt verlieren. Das ist auch beim Holz so: Wenn ich mir vorstelle, ich greife eine Holzoberfläche an und merke, das ist Stahl, da stimmt doch was nicht.
Otto Kapfinger: Im Sinn von Sempers »Stoffwechseltheorie«, dass die Kunstform immer durch Übertragung in ein anderes Material entstand, dass etwa Holzbaudetails in Stein oder textile Details in Metallformen verwandelt worden wären, nach dieser Theorie wäre das ja erlaubt ...
Adolf Krischanitz Dazu wäre aber eine gestalterische Transformation nötig. Die Griechen haben ja auch nicht geglaubt, dass ihre Tempel aus Holz sind ...
Otto Kapfinger: Bei Loos war es umgekehrt. Er sagte, Holz dürfe mit allem gestrichen werden, nur nicht mit Holzfarbe.
Adolf Krischanitz: Ich finde braun gestrichenes Holz faszinierend, aber dieser »holzbeschichtete« Stahl, das ist so primitiv, ein absoluter kultureller Kurzschluss, dass es unbrauchbar ist. Ich finde, eine Spanplatte, kann eine tolle Oberfläche sein. Sie täuscht nichts vor, sondern ist, was sie ist. Das finde ich sympathisch. Aber wenn ich einen Stahlträger mit Edelkastanienoberfläche habe, dann ist das problematisch, und wenn dann noch dazu jemand sagt, der Träger hängt in zehn Metern Höhe, den kann sowieso niemand berühren, dann beginnt man doch an allem zu zweifeln. Natürlich kann man mit so etwas spielen, aber zu solchen Dingen fällt mir einfach nichts mehr ein. Trotzdem glaube ich, dass auch im Umgang mit den Holzplatten kulturelle Formen entstehen müssen und werden.
Richard Manahl: Wir haben gar nichts gegen beschichtete Holzplatten. Die Betonschaltafeln waren überhaupt unser Einstieg ins Holz. Das ist ein wunderbares Material, es ist fertig, man kann es sofort als Fassade, als Möbel, was auch immer verwenden, man muss es nur zusammenschrauben.
Gerhard Steixner: Diesbezüglich bin ich wirklich ein Fundamentalist: ich hab noch nie eine Spanplatte verwendet und noch nie ein Fenster gemacht. Ein Fenster als Loch in der Wand – das ist veraltet. Ich verstehe die Fenster immer weniger.
Adolf Krischanitz: Bei der Renovierung der Villa Wesendonck in Zürich gab es die alten Fenster und Wände, und der Direktor meinte, wir bräuchten die Räume nur auszumalen. Wir haben recherchiert, welche Farbe ursprünglich verwendet worden war, und festgestellt, dass es sich um einen dreifachen Keimanstrich auf Baumwolle gehandelt hatte. Wir haben das übernommen und plötzlich bekamen die Wände eine Tiefe, auf die wir mit den Fenstern, die inzwischen weiße Rahmen hatten, reagieren mussten, indem wir sie dunkel gestrichen haben. Und dann hatten wir fast schwarze Fenster mit Messingbeschlägen und man hat plötzlich gesehen, was ein Fenster wirklich ist. Das hatte eine unglaubliche Wirkung und genau diese Art der Wirkung, diese Schichtung und Tiefe fehlt heute oft in der Architektur.
András Pálffy: Der Umgang mit Oberflächen ist etwas, das mich in letzter Zeit immer mehr stört. Die Oberfläche wird zu einem derart zentralen Thema gemacht, sie ist allen möglichen Formen der Interpretation, der Umwidmung unterworfen, und ich finde, es hat etwas absolut Zwänglerisches, irgendein Industriematerial zu nehmen, es umzuwidmen, zu verfremden und damit zu nobilitieren. Manchmal gelingt es, manchmal scheitert es, aber insgesamt ist die Wahrnehmung so an diese Außenhülle gebunden, dass ich mich frage, was ist dahinter. Da kippt etwas in zunehmendem Maße auseinander, und genau dieses Maß stört mich, weil daneben grundsätzliche Überlegungen untergehen, die das räumliche Gefüge betreffen – ob mit oder ohne Fenster. Architektonische Qualität kann sich niemals darüber definieren, ob ich Material so oder so behandle und in den Vordergrund stelle.
Otto Kapfinger: Das sind alles Aspekte, die unter der dichten Packung von Leistungsanforderungen, bei denen das Holz wunderbar mitspielt, oft zu kurz kommen und ich frage mich, ob man dem etwas entgegensetzen kann.
András Pálffy: Ich glaube, das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Alle, die hier sitzen und das Material in die Hand nehmen, würden etwas Unterschiedliches daraus machen. Diese Vielfalt ist wunderbar und ich bin mir vollkommen sicher, dass die Verwendung des Materials mit einer Selbstverständlichkeit erfolgen würde, die gar nicht auffiele oder sich in den Vordergrund drängen und »ich bin Holz« schreien würde. Trotzdem – und das ist die Klasse des Materials – wäre es ganz selbstverständlich da, mit den Mitteln der Zeit, so gefügt, dass es räumlich wirksam wird, eigenständig und befreit von irgendwelchen Konnotationen.
Eva Guttmann: Selbstverständlichkeit ist das eine, aber trotzdem macht es einen Unterschied, ob man sich für die eine oder die andere Oberfläche entscheidet – ob in der Fassadenhaut oder im Innenausbau.
András Pálffy: Ein Konzept ist so gut, wie es im Detail eingelöst wird, und damit hat die Oberfläche auch etwas zu tun. Aber das ist untrennbar in der Summe der Überlegungen enthalten und ich kann nicht sagen, diesmal nehmen wir Holz und das nächste Mal nehmen wir Stein, sondern so etwas entwickelt sich aus dem Gesamtprojekt.
Kurt Zweifel: In der Umsetzung, in der Detaillierung geht es schon auch um den Charakter von Materialien, um Oberflächen, die man wählt, um eine spezielle Wirkung zu erzielen, um Stimmungen zu erzeugen. Wie seid ihr – Hermann Czech und du – bei Swiss Re in Rüschlikon an diese Sache herangegangen?
Adolf Krischanitz: Hier war für uns die zeitliche Komponente ausschlaggebend. Die vorhandene Architektur ist zeitlich sehr inhomogen, es gibt die alte Villa, Anbauten und den Neubau von Meili und Peter, und wir haben gesagt, dass wir mit den Innenausbauten, mit den Möbeln um diese Zeitkomponente herum »zittern«. Wir sind so vorgegangen, dass wir »langsamere« Materialien – und dazu gehört Holz, das man lange anschauen muss, weil es ja auch langsam gewachsen ist – in den langsameren Bereichen, in den Hotelsuiten und Aufenthaltsräumen eingesetzt haben und schnellere Materialien in den Korridoren und den Zimmern, in denen man eher nicht so lange bleibt. Hermann Czech war primär für das Holz zuständig, das ist sozusagen sein Baustoff, den er mit einer großen Selbstverständlichkeit verwendet. Daraus ist ein sehr zeitloses Haus entstanden – alle sind fasziniert und niemand weiß genau, warum. Es ist aber tatsächlich ein Problem, wenn das Material zum zentralen Thema wird. Zentrales Thema kann nur der Raum sein, und der ist nicht greifbar. Das heißt, zentrales Thema kann nur das Nicht-Materielle sein und niemals das Materielle. Insofern ist ohnehin alles klar.zuschnitt, Fr., 2006.09.15
15. September 2006 Otto Kapfinger