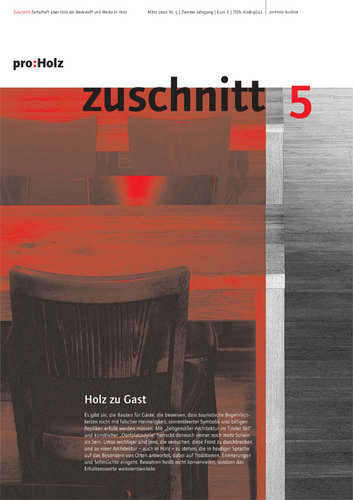Editorial
In ländlichen Regionen wurde der Gast immer mit Holz »bedient«. Traditionelle Bauweisen und Interieurs - naturgemäß mit Holz und Stein - eigneten sich bestens als Projektion einer heilen Welt, die der moderne, urban geprägte Großstadtmensch während weniger Wochen im Jahr zu finden hoffte. Bauen mit Holz wurde Teil einer touristischen Vermarktungsstrategie, die mit Bildern des Ruralen Sehnsüchte nach Heimeligkeit befriedigen will. Zeitgleich mit dem Verlust regionaler Identitäten - durch strukturelle Veränderungen und vermutlich auch im Zusammenhang damit - ist eine Urbanisierung touristischer Begehrlichkeiten zu bemerken. Diese beschränkt sich allerdings auf coole Events, am Lederhosenimage des alpinen Baustils kratzt sie kaum.
Dabei ist Erneuerung dort, wo Authentizität längst nicht mehr gegeben ist, wo Holz zur rein dekorativen Schablone verkommt, höchst an der Zeit. In seiner vielgesichtigen Materialität ist es durchaus in der Lage, Wirkung zu erzeugen mit Schlichtheit. Die Wärme, die es a priori in sich trägt, gibt genug her. Neben Atmosphärischem sprechen handfeste Motive für die Verwendung von Holz im alpinen Tourismus. Moderne, leistungsstarke Holzwerkstoffe und neue Technologien ermöglichen einen hohen Grad an Vorfertigung. Die Vorteile der Fabrikation ganzer Wandelemente und Raumzellen in der Werkstatt liegen auf der Hand: In der witterungsunabhängigen Halle kann unter optimalen Bedingungen mit Unterstützung computergesteuerter Maschinen schnell und präzise gearbeitet werden. Die Montage, der »Rohbau« bis zum schützenden Dach, erfolgt in wenigen Tagen. Neubauten wie das Apartmenthaus Lechblick in Warth, das Zuschnitt vorstellt, entstehen in der kurzen Schönwetterperiode alpiner Regionen.
Extremer in den Bedingungen für die Errichtung und mit höheren Ansprüchen auf Wetterfestigkeit, eignet sich vorgefertigter Holzbau für Schutzhütten im schwer zugänglichen hochalpinen Raum. Dort, wo es keine Zufahrtsmöglichkeiten gibt, wo schlechte Fundierungsmöglichkeit zu Leichtbau und instabile Wetterlagen zu rascher Montage zwingen, können der hohe logistische Planungsaufwand und der Zwang zu äußerster Ökonomie, der der Präfabrikation immanent ist, zu hoher Reife führen. In dieser Baukategorie gibt es Erneuerungsbedarf, aber noch wenige gebaute Vorbilder. Die Berghütte auf dem Plateau de Saleinaz im Schweizer Wallis, die Zuschnitt zeigt, könnte ein solches sein.
In die urbane Gastlichkeit, in städtische Cafés und Restaurants, kehrt Holz nach Jahren der Unterrepräsentanz verstärkt zurück. Es tritt nicht länger nur als Möbel auf. Sorgfältig abgestimmte Hölzer werden flächig eingesetzt: als Wandtäfelung, exquisit ausgewählter Fußboden und raumbildendes Element. Holz bedient den Gast wieder - mit Atmosphäre ganz ohne Schnickschnack. Karin Tschavgova
Inhalt
Zum Thema
Editorial Karin Tschavgova
Gastkommentar Benedikt Loderer
Komm, bleib! Laute und leise Holztöne alpenländischer Gastfreundschaft
Autor: Bernhard Tschofen
Projekte
Apartmenthaus Lechblick Warth, Vorarlberg
von Christian Lenz
Aus der Landschaft heraus, in die Landschaft hinein
Text: Walter Zschokke
Weinlokal solo vino Innsbruck
von Thomas Giner und Erisch Wucherer
La leggerezza del benessere
Text: Gabriele Reiterer
Berghütte am Plateau de Saleinaz
Wallis, Schweiz
von Brigitte Widmer und Stéphane de Montmollin
Höhenflug und geglückte Landung
Text: Martin Tschanz
Heuriger Klein Engersdorf, NÖ
von Reinhard Haslwanter und Peter Fellner
Frisch, leicht und bekömmlich
Text: Karin Tschavgova
Gespräch
Von der Elastizität des Holzes
Arno Ritter mit Hermann Czech und Gregor Eichinger über Holz und Gastlichkeit
Aus der Landschaft heraus, in die Landschaft hinein
Exakt am Hang situiert, bietet das Apartmenthaus seinen Gästen eine Aussicht über das Tal bis nach Lech am Arlberg. 14 Apartments in zwei verschiedenen Größen stehen zur Auswahl. Die Grundrisse erstrecken sich über die gesamte Gebäudetiefe, jeder Einheit ist eine kleine Terrasse vorgelagert. Die Gäste sind autonom, da die gesamte Infrastruktur wie Rezeption im nahegelegenen Gasthof untergebracht ist. Das Haus ist in Massiv-Holzbauweise errichtet - eine Mischkonstruktion aus Holzständern und eingezogenen Betondecken. Außen wurden geölte Lärchenholzbretter für die Fassade verwendet, innen kommt Holz bei Decken und Böden zum Einsatz. Das Gebäude erfüllt die Kriterien eines Niedrigenergiehauses und wurde mit dem österreichischen Staatspreis für »Tourismus und Architektur« 2000 ausgezeichnet.
Am südöstlichen Siedlungsrand des Wintersportortes Warth sitzt das längliche Gebäude exakt an der Hangkante, so dass die Aussicht aus den Apartments und von den breiten Balkonen nicht nur zu den gegenüberliegenden Berggipfeln und nach Lech am Arlberg, sondern auch ins Tal hinunter und hinauf reicht. Eine beneidenswerte Position für das Frühstück vor dem Pistenvergnügen. Den gerade geschnittenen Baukörper bedeckt eine Horizontalschalung aus geölten Lärchenholzbrettern. Nach oben schließt ihn ein flaches Pultdach ab. Während sich vorn die Balkone dreigeschoßig über die gesamte Breite ziehen und sogar über die Hausecken hinausgreifen, wird die Rückseite von den drei kragenartig vorstehenden Wetterschirmen der Eingänge rhythmisiert. Sie blicken auf eine kurze Gasse, die auf der anderen Flanke räumlich von der ins Terrain eingefügten und erdüberdeckten Einstellhalle definiert wird. Diese Verankerung in die Topographie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal guter alpiner Architektur. Die Proportionen des Gassenraumes auf der Zugangsseite entsprechen jenen dörflicher Verhältnisse, während die Gesamtgestalt auf der Aussichtsseite auf Fernsicht konzipiert ist. Mit minimalen Mitteln gelingt es, einen architektonisch klaren Ausdruck zu schaffen.
Das betriebliche Konzept für die zwölf kleinen und zwei etwas größeren Apartments verzichtet auf den sorgenden Hotelier. Die Karten zum Öffnen der elektronisch gesperrten Türen werden den Mietern per Post zugeschickt, oder sie können sie in einem Herbergsbetrieb im Ort abholen. Im übrigen sind sie autonom. Der Bauherr Mag. Wolfgang Hefel hat möglichst schlanke administrative Strukturen angestrebt. Der Erfolg bestätigt seine unternehmerischen Überlegungen.
Die Konstruktion für das Bauwerk nützt die vielfältigen Eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen und verwendet dazu Beton für schall- und brandhemmende Elemente, die zugleich konstruktiv aussteifend wirken. So bestehen die Stiegenhausschalen und die trennenden Scheiben zwischen den Apartments aus 20cm armiertem Beton, während für Außenwände, Decken und Böden Holz zum Einsatz kam. Wiederum zur Verminderung der Schalldurchlässigkeit wurde eine Holzverbunddecke gewählt, denn bei einem Vorgängerbau, dem Doppelwohnhaus in Schwarzach/Vorarlberg, machte der Architekt die Erfahrung, dass die Schalldämmwerte bloß mit Betonpflastersteinen auf einer Gummiauflage über der Brettstapeldecke nicht ganz erreicht wurden. Im Sinne einer intelligenten Kombination der Materialien wurde daher eine Verbundkonstruktion gewählt, bei der der gewichtige, schalldämmende Ortbeton auch statisch wirksam wird. Holz übernimmt den Zug, Beton den Druck. Zuunterst in der Decke befindet sich daher eine 12cm starke Brettstapelplatte, deren Unterseite bereits fertig gehobelt ist. Darauf liegen 10cm armierter Beton, mit dem Holz schubfest verbunden durch spezielle, halb ins Holz eingedrehte Schrauben. Es folgen 3cm Split, 2,5cm Trittschallmatten, auf der 3,5cm starke Heraklith-Platten aufliegen, zwischen denen die Staffeln des Schiffbodens gleichsam schweben. Die Lärchenbretter des Bodens liegen somit auf dem Heraklith auf und Lastabtragung und Schalldämmung sind perfekt.
Es spricht viel Erfahrung und Ingenieurgeist aus dieser Konstruktion, die bis auf den Beton in Trockenbauweise ausgeführt werden konnte. Ebenso wurden die Treppen aus Holz vorgefertigt und als Ganzes von oben in die Stiegenhausschalen eingesenkt. Natürlich galt diese Art der Werkstattvorfertigung auch für die Fassaden, die stückweise, samt den Fenstern mit dem Kran in Position gebracht wurden. Der Aufbau der Fassadenelemente beginnt von innen nach außen wieder mit einer 12cm starken Kantelwand, wie die Brettstapel auch genannt werden. Sie werden von hölzernen, auf Zug belasteten Dübeln zusammen gehalten. Was zuvor mit eingeleimten Gewindestangen aufwändiger erzielt wurde, kann nun mit gepressten und getrockneten Holzdübeln erreicht werden, die im Holz der Kantel aufgehen unddarin über Haftreibung festsitzen. Bisher hielt sich das Arbeiten des Holzes in den vorgesehenen Grenzen. Auch hier ist die Innenseite gehobelt und somit fertig. Nach außen folgen eine 16mm OSB-Platte, 16cm Steinwolledämmung, eine weitere 16mm OSBPlatte, die Konterlattung mit Hinterfüftung und die Außenschalung.
Die Konstruktion verbindet eine positive innere und äußere Anmutung mit hohen Wärmedämm- und Speicherwerten und erlaubt dank Vorfertigung eine kürzere Bauzeit, was in schneesicheren Bergregionen von Bedeutung ist, denn Zeit ist hier viel Geld, wenn die Baustelle über den Winter steht. Die zeitgenössische, sorgfältig proportionierte architektonische Erscheinung, die druchdachte Konstruktionsweise mit Holz und das in die Zukunft weisende, betriebliche Konzept gaben den Ausschlag, dass dem 1999 fertiggestellten Bauwerk im Jahr 2000 der Staatspreis Architektur und Tourismus verliehen wurde. Damit ist die kulturelle Botschaft allerseiten angelangt: Architekten, Bauherren, Herbergsbetreiber und auch Gäste schätzen innovative Holzkonstruktionen und ihr ebenso zeitgemäßes Erscheinungsbild.zuschnitt, Fr., 2002.03.15
15. März 2002 Walter Zschokke
verknüpfte Bauwerke
Appartmenthaus Lechblick
La leggerezza del benessere
Als räumliche und delikate Ergänzung des bereits bestehenden italienischen Esslokals »solo pasta« wurde letztes Jahr das »solo vino« in Innsbruck eröffnet. Zwei Zugänge verbinden die beiden gastlichen Lokale. Der lange schmale Raum des »solo vino« ist mit Regalwänden umgeben, die das große Weinsortiment zur Geltung bringen. Boden, Tische und Regale sind aus dem unbehandelten Holz der Kupfereiche gefertigt. Der Faktor Zeit wird die rohen Oberflächen bald mit einer Patina überziehen. Einzig an der Decke wurden MDF Platten verwendet. Die Stühle sind nach dem Entwurf (1926) des Schweizer Architekten Max E. Häfeli ausgeführt.
Innsbruck hat ein außergewöhnliches Lokal erhalten. Kürzlich hat hier eine Ergänzung des ein Jahr jungen italienischen Esslokals solo pasta eröffnet. Die Genese des neuen, anliegenden solo vino vollzog sich sozusagen unter den allerbesten Voraussetzungen. Ein gereifter architekturkonvertierter Bauherr, dessen erstes Lokal von sofortigem und anhaltendem Erfolg gekrönt war, sowie die kongeniale Zusammenarbeit mit einem Architektenteam mit ausgeprägten italophilen Affinitäten haben ein gastronomisch-architektonisches Gesamtkunstwerk entstehen lassen. Lag dem älteren solo pasta noch manch gastronomisch bedingter Vernunftgedanke zugrunde, entstand das danebenliegende kleine Weinlokal mit viel Lust und Freude. Das ist mehr als spürbar.
Die Architekten Thomas Giner und Erich Wucherer reüssierten bereits beim Speiselokal - einem schmalen durch die ganze Gebäudetiefe laufenden Raum mit zwei gegenüber liegenden Eingängen. Der Schankbereich liegt in der Mitte, er bildet das Gelenk für beide Lokalräume. Das solo vino verfügt zwar über einen eigenen Eingang, ist jedoch mit dem Esslokal über zwei Zugänge räumlich verbunden.
Auch im solo vino fand das graubraune, schlammfarbige Holz der seltenen Kupfereiche Verwendung, es bestimmt die Atmosphäre in hohem Ausmaß. Der schmale Raum ist mit Regalwänden förmlich ausgekleidet. Hier lagert die Essenz des Lokals, Weine aus sämtlichen Regionen Italiens, deren Angebot studiert und im Sortiments- und Preisvergleich auf kleinen Täfelchen selbst ausgesucht werden kann. Ebenfalls aus unbehandeltem Holz sind die langen Tische und der Boden. Die rohe, unbehandelte, edel-asketische Kupfereiche erweckt gleichzeitig die Empfindung von Dichte und Leichtigkeit, von Masse und Zurückhaltung. Dem unbehandelten Holz werden die Jahrewie vielen Weinen im solo vino- ausgezeichnet bekommen. Die Patina wird es noch verschönern. Als Kontrast wurde die Decke aus dem industriellen Produkt MDF gefertigt. Für die Holzarbeiten verantwortlich zeichnet der Innsbrucker Tischler Gerhard Höckner. Die Stühle sind Entwürfe aus 1926 von Max E. Häfeli, einem Schweizer Architekten der Klassischen Moderne. Das Licht, darunter Pendelleuchten aus gerostetem Stahl, wurde speziell für dieses Lokal in Zusammenarbeit mit Halotech entwickelt.
Der unprätentiöse Umgang mit dem Raum und das feine Gespür für Form und Material verbindet sich hier mit viel passione, eben jener ganz einfachen und gleichzeitig so schwer beschreibbaren irdischen Sinnlichkeit. Diese gelungene Symbiose ist dem solo vino ebenso eigen wie dem solo pasta. Hier trifft in Abwandlung zu: Auf alles ist Bedacht genommen und die Selbstverständlichkeit wirkt befreiend.zuschnitt, Fr., 2002.03.15
15. März 2002 Gabriele Reiterer
verknüpfte Bauwerke
Solo Pasta - Solo Vino
Höhenflug und geglückte Landung
Auf einer Höhe von 2.691 Meter über dem Val Ferret bietet die neue Berghütte Cabane de Saleinaz Platz für fünfzig Alpinisten. Neben Aufenthalts- und Schlafräumen und Küche umfasst der schlichte Neubau auch einen abgetrennten Bereich für den Hüttenwart.
Der Bau ist auf die extremen Wetterverhältnisse ausgerichtet. In der Windschneise situiert, bietet er kaum Angriffsflächen. Bei geschlossenen Fenstern wirkt die Hütte wie ein kleiner Holzklotz in der gewaltigen und rauen Landschaft. Alle Elemente, einschließlich Verkleidung und Fenster wurden im Tal vorgefertigt und mittels Helikopter auf das Plateau gebracht. Durchgehende Gewindestangen aus Chromstahl verbinden die Struktur mit dem Fundament. Die leichte Konstruktion, eine Fachwerkstruktur mit innenliegender Beplankung aus Tannen-Dreischichtplatten, erreicht größtmögliche Stabilität. Die geschoßhohen Tafeln sind direkt im Verbund gesetzt. In nur drei Tagen konnte der Bau auf den Betonsockel montiert werden.
Der Neubau der Cabane de Saleinaz (cabane ist das französische Wort für Hütte) sitzt wie die Konstruktion aus dem Jahr 1893, die sie ersetzt, auf einer Felsnase hoch über dem Val Ferret. Sie bietet fünfzig Alpinisten eine einfache, zweckmäßige Unterkunft. Das Programm umfasst neben Aufenthalts- und Schlafräumen eine professionelle Küche und einen abgetrennten Bereich für den Hüttenwart, wobei auch ein reduzierter Betrieb ohne Wartung möglich ist.
Die Architektur der neuen Hütte nimmt bewusst Themen des Altbaus in zeitgemäßer Weise wieder auf. Die extremen Windkräfte der exponierten Lage bestimmen den Ausdruck des Hauses. Optimal in die Windrichtung gedreht, bietet es mit seiner minimierten Profilierung den Stürmen kaum Angriffsmöglichkeiten. Besonders mit geschlossenen Fensterläden wirkt es wie ein abstrakter Körper, der, ähnlich einem Holzklötzchen in einem Baumassemodell, eher ein Symbol für ein Haus als ein wirkliches Gebäude zu sein scheint. Seine reine Geometrie steht als ein Zeichen menschlicher Präsenz in Kontrast zur gestaltund maßlosen Natur.
Ist das Haus dagegen bewohnt, öffnet es sich und verliert seine Härte. Die freie Anordnung der Fenster folgt streng den Innenräumen und spiegelt gleichzeitig die moderne Technologie des Holzbaus wider. Dabei wurden die Elemente in der Werkstatt inklusive innerer und äußerer Verkleidung und der Fenster im Tal vorfabriziert. Die Länge der Zimmerei reichte gerade aus, die Längsfassaden von fast 20 m auszulegen und als Ganzes vorzufertigen. Sie wurden dann wieder in Einzelteile, optimiert nach Gewicht und Fläche für den Helikopter, zerlegt. Ihre Struktur besteht aus einem Fachwerk, das durch eine innenliegende Beplankung aus Tannen-Dreischichtplatten ausgesteift wird. Um größtmögliche Stabilität zu erreichen, sind die geschoßhohen Tafeln analog zu Mauersteinen im Verbund gesetzt. Anders als im traditionellen Holzständerbau sind damit die Fassaden von einem dominierenden Raster befreit, was in der freien Fassadengestaltung zum Ausdruck kommt. Die horizontalen Kräfte werden durch Holzzapfen übertragen. Zusätzlich verankern durchgehende Gewindestangen aus Chromstahl die ganze Struktur mit dem Fundament und sichern die relativ leichte Konstruktion zusätzlich gegen die Stürme.
Während sich die vertikalen Elementfugen in der Hülle aus wetterbeständigem Lärchenholz nicht abzeichnen, zeigt eine horizontale Überschuppung der Bretter den zweigeschoßigen Aufbau. Die kubische Erscheinung des Körpers wird nur so weit durchgesetzt, als sie nicht mit den Bedingungen des Ortes in Konflikt tritt. Genau dies wäre jedoch bei einer ungeschützten Horizontalfuge oder dem Verzicht auf Präfabrikation der Außenhaut der Fall. Mit der gewählten Bauweise konnte der Holzbau nach den Vorarbeiten für den Betonsockel in nur dreieinhalb Tagen montiert werden - ein entscheidender Vorteil bei den extremen Witterungsbedingungen der Baustelle. Ohne spektakulär zu sein, ist die neue Hütte oberhalb des Saleinaz-Gletschers mit ihrer Thematisierung der Tradition, der spezifischen Bedingung des Ortes, der Materialien und des Fertigungsprozesses ein exemplarischer Beitrag zur aktuellen Schweizer Architektur, gerade weil keiner dieser Aspekte vordergründig dominiert, sondern alle in eine kohärente Gestaltung integriert sind.zuschnitt, Fr., 2002.03.15
15. März 2002 Martin Tschanz
verknüpfte Bauwerke
Berghütte am Plateau de Saleinaz