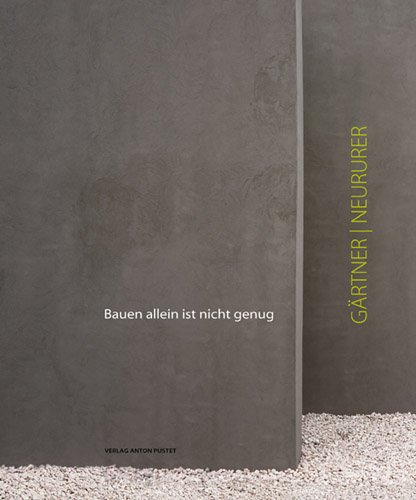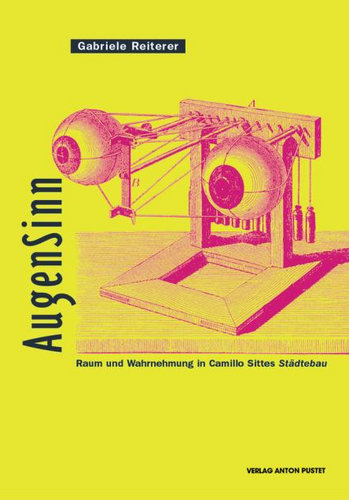Wie baut man „alpin“?
Von der Faszination alter Bauernstuben, der Gleichgültigkeit im Umgang mit der Landschaft und einer Gegenwart, in der alles besser werden soll: die Alpen zwischen Massentourismus,Sünden der Vergangenheit und neuem Nachhaltigkeitsbedürfnis.
Von der Faszination alter Bauernstuben, der Gleichgültigkeit im Umgang mit der Landschaft und einer Gegenwart, in der alles besser werden soll: die Alpen zwischen Massentourismus,Sünden der Vergangenheit und neuem Nachhaltigkeitsbedürfnis.
In den 1970er-Jahren poppte im Tiroler Raum eine schräge Idee auf. Teile alter Bauernhäuser, meist die getäfelten Stuben, wurden abgetragen und in neu erbaute Villen oder Hotels implantiert. Ein Stück bäuerliche Geschichte im Haus galt als stylish. Auch der Vater war einmal in Sachen Bauernstuben unterwegs. Mit einem Transporter fuhr er das Teil aus dem Zillertal über den Brennerpass von Nord- nach Südtirol. Für seinen Freund, den Architekten.
Der Architekt war viel bei uns zu Gast. Er rauchte Pfeife, sprach über Le Corbusier und dessen Proportionssystem, den Modulor. Die Stube baute er dann in sein eigenes Haus in Meran ein. Dieses war ein Bauwerk von charmanter Modernität, die mich damals begeisterte. Eingangs rechterhand lag ein großes Wohnzimmer mit riesiger Glasfront und Blick in einen üppig wuchernden Garten. Stahlrohrmöbel verströmten den Geist neuen Bauens. Linkerhand vom Eingang führte eine Holztür in die Welt bäuerlicher Geschichte, eben in das alte Stübl.
Die seltsame Grille der Bauernstuben fiel nicht zufällig in die Zeit der größten Ignoranz gegenüber traditionellen alpinen Welten. Sie spiegelte eine zerrissene, ausgefranste Identität von bäuerlicher Landschaft und Kultur. Im Bauernstubenphänomen begegneten einander eine an Ironie grenzende Inszenatorik und gleichzeitige Sehnsucht nach echter regionaler Identität.
Jener freimütige Umgang mit dem bäuerlichen Erbe war eine kurze, aber heftige zeitgeistige Erscheinung. Manieristische Gesten waren allerdings im alpinen Raum nichts Neues. Die überzeichnete Romantisierung bäuerlicher Geschichte trat durch die Jahrhunderte immer wieder bizarr in Erscheinung. Und ab den 1970er-Jahren glichen die bäuerlich-rustikalisierten Neubauten in den Dörfern der Tiroler Täler grinsenden, mit roten Balkongeranien verzierten Fratzen. Die brennenden Lieben, so hieß die Scharlachlichtnelke am Balkon umgangssprachlich, überzeichneten eine potemkinsche alpine Welt. In jenen Dekaden des 20. Jahrhunderts begann der endgültige Ausverkauf von alpiner Landschaft und Kultur. Er stoppte erst eine Sekunde vor dem Kollaps. Dabei hatte einst alles vielversprechend begonnen.
Im frühen 19. Jahrhundert zeichnete sich in Europa eine Neubewertung ab. Ein vormals ideal konstruiertes Bild der Natur trat in den Hintergrund. Landschaft wurde malerisch und sinnlich erlebbar. Diese „Entdeckung“ des Gefühls für die Natur wurde zum Fundament einer ganzen reformistischen Bewegung. Sie stellte sich gegen die entmenschlichenden Folgen der Industrialisierung. Der rasenden Geschwindigkeit des technokratischen Fortschritts wurde zivilisationskritisch die unberührte Reinheit der Natur gegenübergestellt.
England lag damit vorne, da hier die Industrialisierung bereits sehr früh einsetzte. Eine neue Kunst feierte Gefühl und Sinnlichkeit. William Turners atmosphärische Bilder waren Oden an die Leidenschaft. Natur boomte. Country life und country stylewurden zu geflügelten Worten. Das Konzept des englischen Landschaftsgartens spiegelte die befreite Natur.
Auf dem Kontinent war man vorsichtiger und distanzierter. Zwischen Mensch und Landschaft lagen noch unsichtbare Grenzen. Die Berge waren eine Art Kulisse, von der latent Gefahr dräute. Die alpinen Grandhotels des 19. Jahrhunderts waren in die Natur versetzte, abgezirkelt urbane Mikrokosmen. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Alpen schließlich immer populärer. Die Natur wurde Gefühlsquelle und Inspiration. Zunehmend erschloss eine breitere Schicht die als gesund und heilsam erachtete Kraft der Berge.
Durch die stampfende Maschine, nämlich die neue Eisenbahn, hielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine weitere Veränderung Einzug. Die technische Transportneuerung produzierte eine gewaltige raum-zeitliche Veränderung: Durch die Geschwindigkeit der Eisenbahn wurde Landschaft anders als früher wahrgenommen. Nun zeigte die durch Bewegung bereicherte Szenerie nicht mehr das Ganze, sondern die Abfolge.
Dieser Blick, nämlich das Panorama, ist ein Schlüsselbegriff für die Wahrnehmung des 19. Jahrhunderts. Er war ein Ergebnis der Eisenbahn. Dem neuen Transportmittel folgte die große infrastrukturelle Erschließung der alpinen Räume. Den Beginn der touristischen Entwicklung Tirols etwa markierte die Errichtung der Brenner- und Pustertalstrecken durch die k.k. Südbahngesellschaft in den Jahren 1867 bis 1871. Die neuen Bahnstrecken erschlossen landschaftlich reizvolle Regionen wie das Hochpustertal und die Dolomitengebiete. Dann ging es Schlag auf Schlag. Theodor Christomannos, ein Cousin des Griechischlehrers von Kaiserin Elisabeth, gründete 1890 den „Verein für Alpenhotels“. Das war der Auftakt der Tiroler alpinen Grandhotellerie.
Eine weitere wichtige Voraussetzung zur touristischen Erschließung der Berge steuerten die neuen Seilschwebebahnen bei. 1908 zählte die Kohlerer Bahn bei Bozen neben dem Wetterhornaufzug in der Schweiz zu den ersten Seilbahnbauten der Welt. Vier Jahre später baute der Wiener Architekt Gustav von Birkenstaedt unter Mitarbeit des jungen Franz Baumann die Südtiroler Vigiljochbahn, eine hohe technische Herausforderung, die im Wesentlichen über trial and error bewältigt wurde.
Während sich der Tourismus in den Alpen bis zum Ersten Weltkrieg noch in überschaubaren Dimensionen abspielte, wurde die Zwischenkriegszeit zur expansiven Epoche. Eine neue Sport- und Freizeitgeneration trat auf den Plan. Der Adel hatte abgedankt. Die bürgerliche Gesellschaft erkor den Sport und die Berge zu ihrem Schauplatz. Eine ebenfalls neue Unternehmerschicht prägte den Tourismus. Die Hoteliers agierten fortschrittlich und innovativ. Die herausragende klassische Architekturmoderne in Tirol ist nicht zuletzt dem Innovationsgeist jener Bauherren zu verdanken. In jenen Jahren bestimmte ein expansives und noch ausgewogenes Feld die Erschließung der Alpen.
Der Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg öffnete die Schleusen zum alpinen Massentourismus. Die Folgen eines mangelnden Bewusstseins für den Umgang mit Landschaft und Natur sind problematische Erbgüter aus jenen Dekaden. Der Fernsehmehrteiler „Piefke-Saga“ aus den 1990ern ironisierte die Befindlichkeiten. Die fiktive Figur des deutschen Industriellen Karl-Friedrich Sattmann verbeißt sich darin gemeinsam mit dem Bürgermeister einer Tiroler Gemeinde in ein profitgieriges Unternehmensprojekt. Am Ende gelangt das Abwasser der Produktionsanlage im fatalen Kreislauf über die Schneekanonen in das Grundwasser des Dorfes und verseucht die Bewohner. Nur allzu ähnlich war die Geschichte Felix Mitterers der Realität. Ökonomische Interessen ohne Rücksicht auf Verluste prägten jene Zeit ungebremsten Aufschwungs.
Ein neues Bewusstsein für die sensible Balance von Natur, Landschaft und Tourismus entstand vor allem durch die Krise der Tourismusindustrie in den späten 1980ern. Sie führte zum Umdenken und zu neuen Konzeptionen. Ablesen lässt sich ein neues und nachhaltiges Bewusstsein an der Architektur. Peter Zumthor etwa setzte mit der Therme in Vals 1996 neue regionale Standards. In der archaischen Landschaft Graubündens entstand mit dem Bau ein wagemutiges und ikonisches Projekt der Moderne.
Das neue Bauen in den Alpen spiegelte ein Gleichgewicht von Mensch und Natur. Qualität ersetzte zunehmend die Quantität. Protagonisten sind, um nur einige wenige zu nennen, Mario Botta, Gion Caminada, Rainer Köberl, Valerio Olgiati und Peter Märkli. Zu den Höhepunkten im hochalpinen Bauen, technologisch gereift, formal beeindruckend, gehört auch Andrea Deplazes' futuristische neue Monte-Rosa-Hütte in den Walliser Alpen. Während beim Bau der alten Monte-Rosa-Hütte noch die Maulesel die Lasten der Bauteile über den Gletscher trugen, lief der Bau der neuen Hütte über eine lückenlose Logistikkette aus Schienen, Straßen und, im letzten Streckenteil, über den Gletscher, per Helikopter. In Südtirol wiederum hat jüngst die kupferummantelte Schwarzensteinhütte der Architekten Stifter+Bachmann eine neue Dimension des Bauens im hochalpinen Raum eröffnet.
Und wo steht der Alpentourismus heute? Der Band „Alpenreisen“, herausgegeben von Kurt Luger und Franz Rest, geht der Befindlichkeit der alpinen Bergwelt nach. Als „Ort des guten Lebens“, die Wortwahl ist der neueren Soziologie entnommen, wolle man sich das Land der Berge bewahren. Raumtransformationen, Trends, Veränderungen, Kontexte, Ökologie, Nachhaltigkeit sind die Themen, die sich im Lebensraum Alpen stellen. Experten aus einem schillernden Reigen von Disziplinen kommen dabei zu Wort. Der beeindruckende Band wird der komplexen Lage und der vielfältigen Sachverhalte gerecht. „Alpenreisen“ ist, und wird es wohl lange bleiben, das gültige Standardwerk zur Welt des alpinen Raumes.
Die Frage nach einem angemessenen Umgang mit alpinen Landschaften ist Gegenstand anhaltender Verhandlungen. Die Architektur ist dabei gleichsam eine Metapher. Ging es vormals eher um einen entsprechenden Stil, stehen gegenwärtig Technologie, Transformationen, kulturelle und ökologische Verträglichkeit im Vordergrund. Formalästhetische Fragen sind komplexen Kontexten und Metamorphosen sozialen und geopolitischen Wandels gewichen.
Die alpine Landschaft bildet seit je herausfordernde Bedingungen. Weitab von urbanen Zentren definieren dörfliche Strukturen oder Einzellagen, regionale, gesellschaftliche und soziokulturelle Faktoren den Handlungsspielraum. Konstruierte Landschaft, kulturelle Befindlichkeit, technologische und ökologische Bedingungen, die Überformung bäuerlicher Kultur in Richtung einer Dienstleistungsgesellschaft sind die problematischen Themen. So wie sich neue Wege im Tourismusmanagement abzeichnen, wie Nachhaltigkeit und wertschätzender gedeihlicher Umgang mit dem Erbe der Kulturlandschaft gepflegt werden können, werden sich plausible Antworten finden lassen.
Zurück zu den Bauernstuben: Die prominenteste Bezugsquelle für die bäuerlichen Versatzstücke waren die Walder-Brüder aus dem Osttiroler Villgratental. Sie betrieben einen florierenden Handel mit alten Stuben. Die schwatzten sie den Bauern ab, boten Ersatz mit Resopal und verkauften gegen hohe Summen.
In den 1980er-Jahren dann gerieten sie in die Schlagzeilen. Freilich nicht mit den Stuben. Die Walder-Brüder waren die wohl berühmtesten Wilderer des 20. Jahrhunderts. Pius fand einen gewaltsamen Tod durch den Jäger Johann Schett. Durch einen Schuss in den Hinterkopf niedergestreckt. Was hätte Ludwig Ganghofer, der große Alpendramatiker, zu all dem gesagt? „Alle Torheit ist ein Umweg zur Klugheit“, schrieb er 1885. Möge dies für die Zukunft der Alpen gelten.
Spectrum, Sa., 2018.10.20