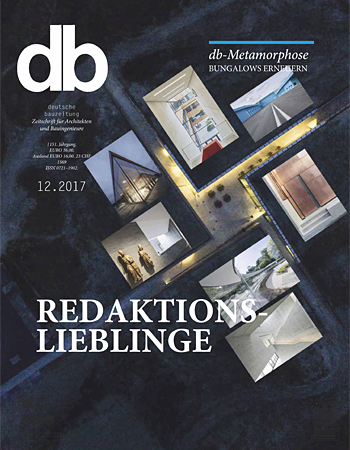Editorial
Nun ist es wieder so weit! Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir laden Sie zu einer Entdeckungsreise zu den Lieblingsgebäuden der db-Redakteure ein. Alle Projekte stellen wir Ihnen dabei unter dem gewohnt architekturkritischen Blickwinkel der db vor. Folgen Sie uns auf den nächsten Seiten zum nahezu unsichtbaren Weltkriegsmuseum von BIG in die dänische Provinz, zu einer rundum gelungenen Stadtreparatur nahe der niederländischen Grenze und einem luftigen Pavillon mit tragenden Glaswänden hinter derselben, weiter zu einem vermeintlich fertiggestellten Umspannwerk in München, einem prägnanten Depot der städtischen Straßenreinigung Augsburg sowie zum tief eingegrabenen Depotgebäude der Tiroler Landesmuseen. | Die Redaktion
Kraftvoll und zurückhaltend
(SUBTITLE) Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland in Vreden
So ein Stück Architektur erwartet man nicht in der Provinz. Glückwunsch an die Stadt Vreden: In einer sorgfältigen Mischung aus angemessenen Lösungen für die Erfordernisse des alten Städtchens und eigenständigem Stil haben Pool Leber Architekten aus München mit dem Kulturhistorischen Zentrum »kult« ganz selbstverständlich die Aufgabe erfüllt, die Mitte der Stadt zu reparieren und einen Identifikationsort für Bürger und Besucher zu schaffen.
Der Neubau des Kulturhistorischen Zentrums »kult« steht am zentralsten Ort von Vreden. Hier treffen die wichtigsten historischen Bereiche der Stadt aufeinander: der ehemalige Immunitätsbereich eines Damenstifts, das im 9. Jahrhundert gegründet wurde, und die alte Handels- und Hafenstadt Vreden. Zugleich ist dies die Mitte der zurzeit entstehenden Kulturachse, die die moderne Stadt stärker zusammenbinden soll. Seit Längerem verfolgt die Verwaltung das Ziel, die ruhige Kleinstadt an der niederländischen Grenze zu modernisieren.
Leitidee ist, die kulturellen Kostbarkeiten aus Vredens 1200-jähriger Geschichte durch eine »Kulturachse« zu verbinden, kommerzielle Nutzungen dagegen örtlich klar zu beschränken. Die Kulturachse führt, keinen Kilometer lang, vom Marktplatz aus über den Platz zwischen der Stiftskirche, der Pfarrkirche St. Georg und dem neuen, zentralen Stadtbaustein kult, hinweg über den Stadtgraben und das Flüsschen Berkel, durch dessen Au und bis hin zur markanten Rundsporthalle aus Sichtbeton, die auch für Konzerte genutzt wird. In der Berkel befand sich über Jahrhunderte hinweg ein Hafen, wichtiger Umschlagplatz für hochwertigen Sandstein und Textilien aus dem Münsterland sowie Waren aus den Niederlanden, z. B. Delfter Fliesen; noch heute ist im flachen Wasser seine Form auszumachen. Auch durch Sprache und historische Lebensumstände waren und sind Westmünster- und Niederländer eng verbunden, und es ist ganz normal, zu einem Tagesausflug mal eben über die Grenze zu kommen.
Die erste Annäherung von der Flussseite hinterließ bei den Architekten einen prägenden Eindruck, erzählt Martin Pool: Nebel stand über den Gewässern, dahinter ragten die Kirchen und die Dächer der Häuser auf – das von vielen niederländischen und flämischen Bilder bekannte Motiv, »vom Land in die Stadt« zu kommen. Diese mittelalterliche Stadtstruktur war denn auch für den Entwurf entscheidend.
Heterogene Einheit
Vom Mittelalter ist zwar der Stadtgrundriss erhalten geblieben, jedoch fast keine Bauwerke. Die britischen Luftangriffe vom März 1945 haben u. a. die Stiftskirche sowie ein kurzes Stück Stadtmauer mit Armenhaus und Pulverturm aus dem 14. bzw. 16. Jahrhundert überdauert. Diese erhielten in den 70er Jahren Anbauten, außerdem wurden auf dem teilweise aufgeschütteten Stadtgraben in den 70er und 80er Jahren Neubauten errichtet, die das Landeskundliche Institut Westmünsterland und das regionalhistorische Hamaland-Museum, zu dem noch das Bauernhaus-Freilichtmuseum in der Berkelaue gehört, umfassten. Ein Zusammenhang zwischen diesen stadthistorischen Standorten war trotz des kompakten Stadtkerns kaum wahrzunehmen, denn mittendrin, am zentralen Platz der Stadt, machte sich ein Jugendheim breit. Die Entscheidung, dieses abzureißen, war richtig und essenziell.
Der Platz ist nun von einer austarierten Gruppe raumbildender, voluminöser Einzelbauten umstanden und markiert deutlich das Zentrum der Stadt. Wie sehr, zeigte sich beim Richtfest: Platz und angrenzende Grünfläche waren von Bürgern belagert, was Pfarrer und Gemeindemitarbeiter sehr überraschte. Von einer eher privaten Nische hat sich der Bereich – wie geplant – zum belebten Aufenthaltsort gewandelt. Das Pfarrhaus, ein typisches Einfamilienhaus aus rotem Klinker, früher zwischen Kirchen und Jugendheim sicher richtig, wirkt nun allerdings etwas fehl am Platz.
Der Museumsneubau vorne am Platz dockt jetzt an den 80er-Jahre-Bau an, der wiederum mit dem Armenhaus und dem Pulverturm verbunden ist. Diese Verkettung holt den etwas abgelegenen Rest Stadtmauer wirkungsvoll nach vorne ins Zentrum. Richtung Stadtgraben wurde die Öffnung zwischen 70er- und 80er-Jahre-Bauten geschlossen. Dadurch entstand ein kleinerer innerer Hof, der eine Betrachtung des auf seine ursprüngliche Erscheinung zurückgeführten Armenhauses ermöglicht und zugleich als Tageslichtquelle dient.
Ursprünglich hatten die Architekten vor, die Fassaden aus den 70er und 80er Jahren zu belassen, dies wäre aber zu unruhig geworden. Nun überziehen Kohlebrandklinker eines regionalen Herstellers fast das gesamte Gebäude. Obwohl damit sehr lange Fassaden entstanden sind, kommt nirgends Monotonie auf. Einerseits werden in den Altbauten zeittypische, auch zuvor bereits vorhandene Elemente aufgegriffen, andererseits setzen sich die einzelnen Baukörper durch Bewegungen in der Fassade und v. a. in den Dächern voneinander ab. Mit spannendem Ergebnis: Das Ensemble changiert – sowohl nach außen als auch im Innern – zwischen »großes Gebäude« und »kleine Stadt«.
Neben viel mehr Raum für die Exponate des Hamaland-Museums (Hamaland bezeichnet in etwa die historische hiesige Region, deren größerer Teil heute niederländisch ist) wird das Ensemble verbesserte Arbeits- und Studierbedingungen für die Nutzer der bestehenden landeskundlichen Institute bieten; die Verwaltung der Kultur- und Kreispflege sitzt hier, die beispielsweise für (auch grenzüberschreitende) Bildungsveranstaltungen zuständig ist, außerdem wurden das Stadtarchiv Vreden und das Kreisarchiv Borken zusammengeführt (Stadt und Kreis teilten sich auch die Baukosten im Verhältnis 30:70). Nicht zuletzt bietet das kult Räume für öffentliche Veranstaltungen. Daher auch der Name des neuen Stadtbausteins: »kult« als Akronym für »Kultur und lebendige Tradition«. Diese Nutzungsvielfalt war teils ganz pragmatisch durch Förderbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen bedingt (Museen allein werden nicht gefördert). V. a. aber gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen durch die Zusammenlegung deutlich effektiver und dynamischer als zuvor.
Lebendiges Wechselspiel
Zentraler Raum des Neubaus ist das Foyer, das zugleich als Teil der Kulturachse konzipiert ist. Und tatsächlich fließt der Außenbereich durch den luftigen und sehr hellen Raum hindurch – selbst die beiden Eingänge wirken als gleichwertige Tore, der jeweiligen Annäherung angemessen. Wie der Platz vor dem Haus dient auch das Foyer als Verteiler in alle Richtungen: Von hier aus ist das vielteilige Ensemble durch den direkten Blick tief ins Gebäude und nach oben bis unters Dach sogleich zu erfassen. Obwohl es über drei Geschosse offen ist, hat es eine exzellente Akustik und sich damit als gefragter Raum für Konzerte, Lesungen und Versammlungen etabliert.
So, wie es jetzt ist – dreigeschossig und mit großem Oberlicht –, thematisiert das Foyer auch die zwei wichtigsten Abweichungen vom 2013 ausgeschriebenen Wettbewerb, die sich das (zunächst zweitplatzierte) Büro erlaubte. Es war geplant, eine fensterlose Ausstellungsebene quer durch das 1. OG aller Häuser zu legen. Die Architekten konnten jedoch die Bauherren davon überzeugen, dass es klüger sei, jedes Haus als Einheit zu belassen – nicht nur von der historischen Integrität her, sondern auch klimatisch und konstruktiv. Letztlich erwies sich diese Variante im VOF-Verfahren auch als kostengünstiger – u. a. weil so viel Bausubstanz wie möglich belassen wurde, bis hin zu gut erhaltenen Bodenfliesen in den 70er-Jahre-Bauten. Um genügend Ausstellungsfläche zu erhalten, schlugen die Architekten zwei gestapelte Ebenen vor. Eine elegante Lösung, denn so bekamen die beiden Schwerpunkte des Museums, die weltliche Stadt und das ehemalige Stift, einen jeweils eigenen Bereich. Das bedeutete allerdings auch, dass der jetzt dreigeschossige Kopfbau gegenüber den Kirchen stärker ins Gewicht fallen würde. Doch dem wirkten die Architekten mit einigen klugen Eingriffen entgegen: mit der niedrigen Eingangszone, den graubraunen Klinkern und den zwei unterschiedlich geneigten Dächern – zum Platz hin flacher, in die Straße zu den anderen Gebäuden hinein steiler. All das erfüllt trotz des großen Volumens das Ziel der Architekten, ein »Hintergrundgebäude« zu schaffen. Zugleich kopieren diese Dächer nicht einfach das Vorhandene – sie passen zur Handschrift, die den gesamten Neubau durchzieht und damit das Museumsgebäude als eigenständige Einheit ausweist.
Präzise Inszenierungen
Die wertvollen Ausstellungsstücke und ihr Schutz vor UV-Licht bedingten die zweite ursprüngliche Forderung der Bauherren nach einer »Black Box«. Es war aber auch gewünscht, den Bau auf die Kirchen bzw. den Berkelhafen zu beziehen. Nonchalant schlugen die Architekten vier große Fenster vor, die genau diese Blicke inszenieren. Und der Parcours der Ausstellungsgestalter Thöner von Wolffersdorff, Augsburg, bindet sie thematisch perfekt ein – zur großen Begeisterung der stellvertretenden Leiterin des kult, Ulrike Brandt. Die Abbildung eines »Berkelzomp« etwa, ein flaches Boot, ist in Originalgröße – knapp 13 m – auf die lange Außenwand direkt neben die Fenster gesetzt. Aus diesen sieht man das Hafenbecken, in Wirklichkeit und durch Ferngläser, in denen per Animation Schiffe auf dem Flüsschen segeln. Außer den Fenstern versorgt das zentrale Treppenhaus die Ausstellungsräume mit Licht, das durch Öffnungen sowie Stellwände gefiltert wird.
Hierdurch entstehen in überraschender Unmittelbarkeit nebeneinander sehr unterschiedliche Grade von Intimität und Offenheit. Besonders wirkungsvoll ist das rund um das wertvollste Stück der Sammlung gelungen. Die sogenannte Sixtus-Kasel, ein über 1 000 Jahre altes Messgewand des Heiligen Sixtus, dürfte eigentlich gar kein Licht treffen. Der Raum, der eigens für sie geschaffen wurde, hat komplett schwarze Wände und einen sehr dunklen Fußboden. Erst wenn man ihn betritt, wird die Kasel extrem sparsam beleuchtet. Doch nur ein paar Schritte trennen diese konzentrierte Dunkelheit vom hellsten Punkt des Gebäudes: den beiden wandhohen Fenstern, die die zwei Kirchengebäude inszenieren. Überwältigend!
Effektvolle Reduktion ist ein durchgängiges Merkmal der Ausstellung und ergänzt damit den Museumsbau perfekt. So ist auch die zweite Seite des DG gestaltet: Der rund 6 m hohe Raum ist durch eine endlos lange, extrem schlanke Betonstütze geteilt, die den Blick wie in klassischen Kathedralen nach oben bis unter den First lenkt. In der gesamten Ausstellung werden bewusst nur ausgewählte Stücke gezeigt, die umso größere Aufmerksamkeit erfahren. Manche Themen sind mit Absicht auch nur überblicksweise angerissen, weil sich in der Region eine andere Institution auf eins davon spezialisiert hat. Der regionale Bezug definiert diesen Ort auch noch anderweitig: Die Erläuterungstexte stehen auf Deutsch und – nein, nicht Englisch – Niederländisch an den Wänden.db, Fr., 2017.12.01
01. Dezember 2017 Dagmar Ruhnau
Zeichen der Wertschätzung
(SUBTITLE) Wertstoffhof und Strassenreinigungsdepot in Augsburg
Ein zeitgemäßes städtisches Straßenreinigungsdepot unter einem Dach mit einer Wertstoffsammelstelle zu verwirklichen, ist sowohl technisch als auch organisatorisch deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. KNERER UND LANG Architekten entwickelten dafür in Augsburg in regem Austausch mit dem Bauherrn eine ebenso funktionale wie gestalterisch prägnante und überzeugende Lösung, ohne dabei die Nutzer aus dem Auge zu verlieren.
Die Stadt Augsburg möchte den Bereich Straßenreinigung und Abfallwirtschaft durch eine Neustrukturierung nachhaltig und wirtschaftlich ausrichten. Um die Anzahl der Standorte für die Wertstoffsammlung sowie für die Infrastruktur der Straßenreinigung zu reduzieren, wurden drei Neubauten – strategisch günstig auf das Stadtgebiet verteilt – als kombinierte Wertstoff- und Straßenreinigungsdepots ausgeschrieben. Das erste davon ist bereits seit 2012 in Betrieb, das Depot am Holzweg von KNERER UND LANG Architekten hat im Dezember 2016 seinen Dienst aufgenommen und der dritte Neubau wird derzeit errichtet. Durch das Integrieren von Waschanlagen und Streusalzlagern, die bislang ebenfalls an separaten Standorten untergebracht waren, sollen Fahrten vermieden und damit auch der Kraftstoffverbrauch und Emissionsausstoß der Fahrzeugflotte verringert werden. Die Personalräume der Straßenreinigung an den vormaligen, in die Jahre gekommenen Standorten bedurften überdies einer deutlichen Verbesserung.
Die drei Neubauten wurden an Standorten geplant, an denen die anfallenden Geruchs- und Lärmemissionen anrainerverträglich gestaltet werden konnten. Kleinere innenstadtnahe und sanierungsbedürftige Depots und Wertstoffhöfe können nun nach und nach aufgegeben werden.
Augsburg, die drittgrößte Stadt Bayerns, ist v. a. durch ihren sehenswerten historischen Stadtkern bekannt, hat aber auch eine lange Geschichte als Industriestandort. So nahm mit der »Schüleschen Kattunfabrik« 1771 die erste Textilmanufaktur auf dem europäischen Kontinent ihren Betrieb auf. Seit dem 20. Jahrhundert und bis heute prägt die Maschinenbauproduktion das Stadtgebiet mit ausgedehnten Industrie- und Gewerbearealen v. a. zwischen der Kernstadt und den im Laufe der Jahrzehnte eingemeindeten Teilorten. So auch im Norden Augsburgs, wo der Holzweg die beiden Stadtteile Oberhausen und Löwenbräu miteinander verbindet und dabei den Wechsel von Industrie und Gewerbe im Süden hin zu Kleingartenanlagen im Norden markiert. An einer Ecke, an der der Holzweg als Brücke über die vierspurige B17 führt, lag bereits seit Jahren ein Festplatz brach. Mit ihm fand die Stadt Augsburg nach aufwendiger Suche endlich auch im Norden des Stadtgebiets ein Baugrundstück für einen Depotneubau, das sowohl die erforderliche Größe als auch eine sehr gute Verkehrsanbindung aufweist.
Wagenburg der Strassenreiniger
Um das vorgegebene umfangreiche Raumprogramm auf dem vormaligen Festplatz unterzubringen, rückten KNERER UND LANG Architekten – nach einem VOF-Verfahren beauftragt – die Außenkanten ihres U-förmigen Gebäudes bis an die mehrfach verschwenkten Baugrenzen heran. Seine Fassaden zeigen sich dadurch entlang des Holzwegs und zur B17 hin besonders plastisch. Analog zu den amorphen Umrissen wurde – statt einer Abtreppung – eine Verschleifung der unterschiedlichen erforderlichen Gebäudehöhen gewählt. Vom Holzweg aus betrachtet führt dies zusammen mit der Holzlattenbekleidung, die nur punktuell von wenigen Fensteröffnungen unterbrochen wird, zu einer äußerst abstrakten Wirkung. Die Absicht der Architekten, die Dimension des Baukörpers mittels »weicher« Materialisierung und Farbwahl etwas zu entschärfen, ist nachvollziehbar: Durch die Tiefenwirkung des Fassadenaufbaus verliert das beträchtliche Bauvolumen tatsächlich an Wucht und lenkt die ganze Aufmerksamkeit des ortsunkundigen Besuchers auf die Zufahrt an dem Gebäudeabschnitt, an dem die Fensteröffnungen – da nicht durch die Holzlatten kaschiert – als solche zu erkennen sind. Hier wird aus dem Volumen ein Gebäude. Im Moment der Einfahrt erschließt sich das Gebäude im Nu: Ein riesiger asphaltierter Hof wird, statt von Holzlatten wie außerhalb, nun von einer leuchtend blauen Trapezblechfassade U-förmig gefasst. Fensteröffnungen, Türen und Tore, im selben Farbton beschichtet, verweisen durch ihre variierenden Größen darauf, dass sich hier unterschiedliche Nutzungen nebeneinander aufreihen.
Die bewegte Oberkante der äußeren Fassade findet rund um den heiter stimmenden Hof ihr Pendant im Auf und Ab eines angemessen deutlich wahrnehmbaren Dachüberstands. Im Norden, direkt gegenüber der Einfahrt, wandelt sich dieser sehr elegant zur einfachen Überdachung der orangefarbenen Wertstoffcontainer.
17 Container und fünf Pressen sind ordentlich in einer Reihe aufgestellt und durch ihre übergroßen Beschriftungen – von Elektroschrott bis Papier – problemlos auffindbar. Hier im vorderen Teil des Hofs zwischen Wertstoffen und dem Personalgebäude wird geparkt und werden Wertstoffe entladen. Der hintere Bereich des insgesamt 11 000 m² großen Areals ist den Straßenreinigern vorbehalten: Der Hofbereich dient als Rangierfläche, rechts und links befinden sich die beiden Fahrzeughallen für 30 kleinere sowie 17 große Fahrzeuge, ergänzt durch zwei Waschanlagen.
Die Fahrzeughallen sind jeweils mit doppelter Tiefe ausgeführt, sodass abhängig von der Jahreszeit wechselnde Aufbauten oder Fahrzeuge für Reinigungs- bzw. Winterdiensteinsätze direkt dahinter abgestellt werden können. Eine Fußbodenheizung gewährleistet ein Temperaturniveau von mindestens 5 °C, um auch bei eisiger Witterung ohne Verzug mit dem Winterdienst beginnen zu können. Die Halle zur Lagerung von Streusalz zwischen den Fahrzeughallen schließt das Gebäude-U nach Westen hin als Hochpunkt ab. Hier lagert sowohl reines Streusalz für Straßen als auch ein Salzsplittgemisch für Geh- und Radwege. Holzschalungen schützen die Betonwände vor dem aggressiven Schüttgut. Die beeindruckende Dimension des Raums erlaubt das Kippen eines Sattelzuganhängers, wofür eine lichte Höhe von 9 m benötigt wird.
Neben den einzuplanenden Aufprallkräften und teilweise erheblichen Spannweiten sprach auch der Feuchteeintrag durch die beiden Waschanlagen gegen die ursprünglich favorisierte Holzkonstruktion. Stattdessen kam eine Mischbauweise aus Ortbeton und Betonfertigteilen zum Einsatz. Die tragende Struktur zeigt sich ebenso sorgfältig ausgeführt und geplant wie die größtenteils sichtbar geführten, zahlreichen Leitungen der Haustechnik. Von der Abwasserwiederaufbereitung der Waschanlagen über die Wärmerückgewinnung aus der Abluft des Personalgebäudes bis hin zur PV-Nutzung auf den extensiv begrünten Dachflächen: Bei der Haustechnik wurde Wert auf den Vorbildcharakter des städtischen Gebäudes gelegt.
Angemessen
Besonders die Qualität der Aufenthaltsräume und Umkleiden sei im neuen Gebäude deutlich besser als an den vormaligen Standorten, berichtet der Leiter des »Wertstoff- und Servicepunkt Holzweg« Bedros Isler. Im OG des Personalgebäudes ermöglicht ein Ruheraum den Straßenreinigern ein kurzes Nickerchen in der Pause.
Der helle Aufenthaltsraum und eine gut ausgestattete Küche im EG bieten beste Voraussetzungen für eine angenehme Frühstückspause. Wie die Sozialräume zeigen sich auch die Büros und der Besprechungsraum schnörkellos und großzügig und dank durchdachter Details sehr haltbar. Viel Tageslicht, weiß geschlämmtes Sichtmauerwerk und ein graubrauner Kautschukbelag schaffen eine angenehm aufgeräumte Atmosphäre.
Austausch und Abstimmung zwischen Planern und Bauherrn während des ganzen Planungsprozesses seien intensiv gewesen, meint Architektin Eva-Maria Lang und lobt die konstruktive Zusammenarbeit. Wenn dabei die Bedürfnisse der Hauptnutzer des Gebäudes, die bei Wind und Wetter Straßen und Plätze von Unrat und Schnee befreien, angemessen und respektvoll behandelt werden, dann kann gelungene Architektur auch als Zeichen der Wertschätzung betrachtet werden. In Augsburg am Holzweg kann man sich davon ein Bild machen.db, Fr., 2017.12.01
01. Dezember 2017 Martin Höchst
Wege in die Geschichte
(SUBTITLE) Tirpitz-Museum in Blåvand (DK)
Ein neues Museum an der jütländischen Küste setzt sich mit dem unter deutscher Besatzung entstandenen Atlantikwall auseinander. Das zum überwiegenden Teil unterirdisch in die Dünenlandschaft eingefügte Ausstellungsgebäude reagiert antithetisch auf den benachbarten Bunker und schafft ein überzeugendes, zeitgenössisches Gegengewicht.
Der Leuchtturm von Blåvandshuk im Südwesten Jütlands markiert den westlichsten Punkt Dänemarks. Die langen Sandstrände machen die Gegend zu einer beliebten Ferienregion, wozu zweifelsohne auch der Umstand beiträgt, dass man mit dem Auto von der deutschen Grenze aus nur zwei Stunden hierher benötigt. Die Fahrt geht an Esbjerg vorbei, man umrundet die Bucht von Ho, passiert das mit Cafés, Geschäften und Supermarkt auf die Versorgung von Touristen ausgerichtete Blåvand und gelangt dann, die Dünen- und Heidelandschaft durchquerend, zum Strandparkplatz am Leuchtturm. Unweit von diesem steht in den Dünen ein weiterer Turm. Es handelt sich dabei um den Betonunterbau einer Funkmessanlage aus der Zeit der deutschen Besatzung – weithin sichtbares Zeichen für die strategische Bedeutung, die dieser Region Dänemarks beigemessen wurde.
Durchstreift man die Dünen, so sieht man überall Überreste deutscher Befestigungsanlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Auch der Strand ist übersät mit Bunkern, Resten einer Heeres-Küstenbatterie, die, da direkt auf dem Sand betoniert, z. T. in den Boden eingesunken sind und wie gestrandete Wale erscheinen. Bei den Befestigungsanlagen handelte es sich um Teile des Atlantikwalls, der auf Befehl Hitlers zwischen 1942 und 1944 entstand und sich von der französisch/spanischen Grenze bis zum äußersten Norden Norwegen erstreckte. Ziel der niemals fertiggestellten Verteidigungslinie war es, die Westflanke des Deutschen Reichs und der von Deutschland besetzten Länder vor einer vermuteten Invasion der Alliierten zu schützen. Als diese sich tatsächlich im Juni 1944 ereignete, erwies sich der Atlantikwall als völlig wirkungslos: Die Landemanöver zielten auf wenig befestigte Strandabschnitte ab und nicht auf die gesicherten Hafenstädte und erfolgten auch nicht wie vermutet an der schmalsten Stelle des Ärmelkanals. Und einmal überrannt, waren die statischen Befestigungen des Walls aufgrund der geringen Verteidigungstiefe ohne jeglichen Nutzen. So wurde noch im Juli 1944 mit einer weiteren Verstärkung der Festungsanlagen begonnen, der sogenannten »Tirpitz-Stellung« (Tarnname: Vogelnest).
Teile der Stellung wurden nach dem Krieg beseitigt, doch die beiden gewaltigen Geschützbunker blieben in den Dünen erhalten. Im südlichen wurde 1991 eine kleine Ausstellung über den Atlantikwall eingerichtet. Auf Dauer befriedigte die Präsentation jedoch nicht, und außerdem wünschten sich die Verantwortlichen weitere Ausstellungsfläche für küstenbezogene Themen, um die Attraktivität des Orts zu stärken. So entschied man 2012 die Errichtung eines eigenen Museumsgebäudes in der Dünenlandschaft in unmittelbarer Nachbarschaft des Bunkers und beauftragte das dänische Architekturbüro BIG, das wohl am stärksten Garant dafür war, den Slogan, der heute auf der Homepage prangt, »En topattraktion i verdensklasse« (Eine Weltklasse-Topattraktion) Wirklichkeit werden zu lassen. Tirpitz, wie das neue Museum heißt, wurde am 30. Juni dieses Jahres nach dreijähriger Bauzeit eingeweiht. Die Finanzierung wurde größten Teils durch Stiftungen ermöglicht.
Ober- und Unterwelt
Bjarke Ingels ist ein brillanter Promotor seiner Architektur. Es gelingt ihm, auf komplexe Fragestellungen Antworten zu finden, die, weil unerwartet, zunächst irritieren, aber dann dadurch überzeugen, dass sie so bildhaft und klar sind, als hätte es nie eine andere Lösung geben können. Vielleicht ist das von ihm gerne für das Tirpitz-Museum verwendete Bild einer kreuzförmig eingeschnittenen gebackenen Kartoffel, die unter der Schale ihr weiches Inneres zeigt, allzu platt, aber tatsächlich erweist sich der neue Baukörper als Antithese zum Bunker: Während dieser massiv ist, sich hermetisch zeigt und als Fremdkörper in der Dünenlandschaft steht, stellt sich das Museum filigran und offen dar und ist in seinen wesentlichen Teilen in den Boden eingetieft, mithin unsichtbar, und verschmilzt mit der Landschaft. Vom Parkplatz aus führt ein geschwungener Weg am Bunker vorbei durch die Dünenlandschaft. Von Süden aus betritt man das Areal des neuen Ausstellungsbaus. Dieses gibt sich durch vier Einschnitte in einer künstlichen Topografie zu erkennen: Von allen vier Himmelsrichtungen aus führen gerade Wege windmühlenartig versetzt auf einen zentralen Platz zu. Die Wege werden von Glasfronten flankiert, die zum Platz hin kontinuierlich bis auf eine Höhe von max. 6 m ansteigen und letztlich die Seitenwände von prismatischen Oberlichtern bilden, deren diagonal geführte Dächer von Erde bedeckt sind.
Oberirdisch ergibt sich die Struktur einer versetzt, entlang der Kanten aufgeschnittenen Pyramide. Vermittels einer Stahlbrücke hinter der Tür im nordöstlichen Prisma gelangt man zum Kassentresen, neben dem sich auf gleicher Ebene das Café befindet. Ein diagonaler Treppenlauf leitet hinunter zum Foyer, das direkt unter dem zentralen Platz auf der unteren Ebene liegt und den Zugang zu allen Ausstellungsbereichen ermöglicht. Hier wiederholt sich der oberirdische Grundriss: Vier rechteckige Säle gruppieren sich um das zentrale Foyer.
Verbindungsgänge und Nebenräume trennen diese vier Ausstellungsbereiche voneinander, doch lassen sie sich bei Bedarf auch mittels rückwärtigen Durchgängen ringförmig zusammenschalten. Betreten werden die Säle aber üblicherweise vom Foyer aus: Die vier Wände sind drehbar gelagert. Damit öffnen sich Zugänge für die Besucher und zugleich dringt – sofern die »Oberlichter« nicht verdunkelt sind – auf diese Weise Licht in das ansonsten tiefdunkle Foyer ein.
Ein Blick auf den Grundriss verdeutlicht die überaus logische Grundstruktur: Ein rechteckiges Betonvolumen wird durch die vier windmühlenflügelartig angeordneten Säle untergliedert. Die schräg geführten Decken, ebenfalls vor Ort betoniert, kragen im EG zur Mitte hin freitragend aus und bilden die Unterkonstruktion der prismatischen und bewachsenen Hügel, die jeweils zweiseitig zum Eingangshof hin verglast sind. Zum Sichtbeton der Konstruktion treten auf der Ausstellungsebene gewalzte Stahlplatten als Bekleidung der nach innen orientierten Wände. In verwandelter Form nutzt BIG also die Baumaterialien des Bunkers, der ja den eigentlichen Grund für die Errichtung des Ausstellungsgebäudes darstellt und den man über den nach Süden führenden unterirdischen Gang erreicht. Der Bunker ist zweigeschossig, von 3,5 m dicken Betonmauern umgeben – insgesamt wurden dort rund 2 000 m³ Beton verbaut – und hätte eigentlich als Unterkonstruktion für den Geschützturm mitsamt den beiden Kanonen dienen sollen. Die Nebenräume, die den Zentralraum auf allen vier Seiten umgeben, waren für technische Einrichtungen sowie als Lagerräume für Munition und Zünder vorgesehen.
Inszenierung als Obsession
Die Gestaltung aller Ausstellungsbereiche wurde dem in Utrecht ansässigen Büro Tinker Imagineers übertragen. Dies setzte ein Konzept um, das völlig auf Texttafeln und Beschriftungen verzichtet. Sämtliche Informationen werden an Audiostationen über individuelle Audioguides abgerufen. Diese Art der Vermittlung ist Geschmackssache, bringt aber auf jeden Fall ein etwas ratloses Zappen mit sich, da es viele Hörstationen gibt und man nicht recht weiß, wo wichtige Informationen und wo eher Nebensächliches vermittelt wird. Im Übrigen treten die niederländischen Gestalter getreu ihrem Büronamen nicht als Szenografen auf, die Objekte in Szene setzen, sondern als »Imagineers«, die Erzählungen erfinden und Bildwelten dazu erschaffen. Besonders penetrant wirkt das im Ausstellungsbereich »Geschichten der Westküste«, der ohnehin schon mit Ausstellungselementen überfrachtet ist und alle halbe Stunde einem Sound- und Lichtspektakel Raum bietet, in dem sich Projektionen und dreidimensionale Elemente mischen. Die zweite Ausstellung (»Gold der Westküste«) ist dem Thema Bernstein gewidmet, die dritte (»Eine Armee aus Beton«) den Menschen am Atlantikwall. In einer Szenografie, die den versinkenden Bunkern am Strand von Blåvandshuk nachempfunden ist, kann man sich anhand der Biografien von sechs Personen in die Zeit zurückversetzen, in welcher der Wall gebaut wurde. Es geht um einen jungen deutschen Marinesoldaten, der Rommel bewundert, einen anderen Deutschen, der als Deserteur von Dänen versteckt wird sowie einen dritten, der sich in die dänische Küchenhilfe Anna verliebt. Und dann ist da noch Nielsen, der als dänischer Ingenieur im Auftrag der Organisation Todt Bunker baut und Anna, deren Eltern wegen des Festungsbaus ihr Haus verlieren …
Der vierte Ausstellungsbereich, eigentlich für Sonderausstellungen vorgesehen, dient derzeit als Auditorium. Da hier keine Einbauten vorgenommen wurden, zeigt er das räumliche Konzept von BIG und seine von außen kaum zu ahnenden Dimensionen am deutlichsten: 10 560 t Beton und 600 t Armierungsstahl wurden verbaut. Die Architekten aus Kopenhagen haben ein robustes Konzept entwickelt, das im Ausstellungsbereich eine hohe Flexibilität gewährleistet, auf den Bunker intelligent mit einer antithetischen und komplementären Strategie reagiert und überdies überzeugend in die Dünenlandschaft eingefügt ist. Durch die versetzten Wege ist der Hof im Zentrum windgeschützt und wird in diesen Tagen Anfang November trotz stürmischem Wetter und sich ballenden Wolkenformationen als Picknickplatz frequentiert. Man kann das Gelände dann in alle Richtungen verlassen – oder auch auf die Dächer hinaufsteigen und über die Landschaft blicken.db, Fr., 2017.12.01
01. Dezember 2017 Ulrike Kunkel