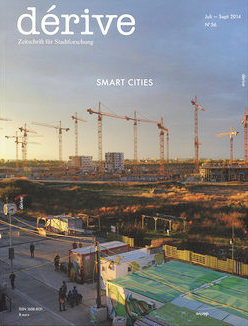Editorial
Immer wieder kommt es in dérive-Heften vor, dass sich neben dem offiziellen Schwerpunkt, dessen Titel auf dem Cover prangt, durch thematische Querverbindungen netzwerkartig ein zweiter, quasi inoffizieller focal point ungeplant und trotzdem nicht zufällig ergibt. In der vorliegenden Ausgabe zu Smart Cities hat sich Rio de Janeiro informell ins Zentrum gerückt. Es beginnt mit Rios so genanntem Operation Center (siehe Foto S. 23), in dem die öffentlichen Räume der Stadt zentral überwacht und die Arbeit von rund 30 Einrichtungen koordiniert werden.
Als Top-Produkt des Smart-City-Konzerns IBM findet das Operation Center im Schwerpunkt wiederholt Erwähnung. Dieser zentrale Kontrollraum ist als Investition im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2014 und den Olympischen Spiele 2016 zu sehen, womit die Verbindung zu Stephan Lanz’ Artikel Mega-Events, Mega-Geschäfte, Mega-Proteste: Die Städte und die Spiele in Brasilien gelegt wäre. Lanz schreibt darin über unternehmerische Stadtentwicklungsstrategien, die Wiederkehr einer autoritären Wohnpolitik, Rios Law-and-Order-Politik und den neuen Kampf um die Stadt. Eine weitere Querverbindung neben Smart City und Fußball-WM ergibt sich in der Beschäftigung mit den Favelas: Derya Özkan zeichnet in ihrem Artikel Gecukondo Chic – Urban Poverty as Cultural Commodity die Veränderung des Bildes von informellen Siedlungen im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte nach und beschreibt Phänomene wie slum tourism, poorgeoisie oder die zunehmende Begeisterung für »informally created spaces«.
Mit dem offiziellen Schwerpunkt des Heftes stellen wir uns – gemäß dem Motto »Einer muss es ja machen« – der Smart-City-PR-Lawine entgegen und eröffnen die überfällige kritische Debatte zum Technologie-getriebenen Smart-City-Hype. Wird sie doch wie kaum eine andere der »adjectified cities« (Judith Ryser) mit überdimensional großem Engagement von Politik und Wirtschaft beworben. Judith Ryser lässt in ihrem Artikel Planning Smart Cities ... Sustainable, Healthy, Liveable, Creative Cities ... Or Just Planning Cities? diese Entwicklungen Revue passieren und unternimmt den nicht ganz einfachen Versuch, die Unterschiede zwischen Smart City, Green City, Sustainable City (und wie sie alle heißen) herauszuarbeiten.
Anne-Katrin Fenk und Gesa Königstein haben für ihren Beitrag zum Schwerpunkt ein Zitat von T.S. Elliot gewählt: »Where is the knowledge we have lost in information«. Die AutorInnen kritisieren, dass ArchitektInnen und PlanerInnen sich immer öfter in der Rolle eines urbanen Mechatronikers wiederfinden und werfen einen Blick auf die Auseinandersetzung mit dem Thema Smart City in Indien. Besonders erfreulich im Hinblick auf das Durchforsten des Sprudelsprechs zur Smart City ist auch der Beitrag von Adam Greenfield, Verfasser des äußerst empfehlenswerten Pamphlets mit dem ebenso knappen wie eindeutigen Titel Against the Smart City. In seinem Text wirft er den Agenten der aktuellen, smarten Stadtplanungsvision vor, ihr Konzept auf einem »inappropriate Model of optimization« aufzubauen: »Even where technical systems are concerned, there’s no such thing as abstract, across-the-board optimization.« Hilfreich für seine Analyse in
Sachen Brauchbarkeit des Konzepts für das gute urbane Leben, so Greenfield, war eine einfache Frage: WWJJD – What would Jane Jacobs do?
Für den Abschluss des Schwerpunkts zeichnet Sebastian Raho verantwortlich, der Die stille Politik der großen Utopie analysiert und sich speziell mit der Rolle der EU bei der Implementierung von Smart City Policies und der Situation in Österreich auseinandersetzt.
Im Magazinteil findet sich – neben den bereits erwähnten Beiträgen von Derya Özkan und Stephan Lanz – ein Artikel von Elke Krasny, der sich mit dem Begriff des Pioniers und der Entwicklung seiner Bedeutung auseinandersetzt. Im Zentrum ihrer »kritischen urbanen Analytik zwischen Etymologie und Epistemologie« steht dabei der Raumpionier, der im Stadtdiskurs – von Gentrification bis Zwischennutzung – regelmäßig auftaucht und zu einer zentralen Figur geworden ist.
Manfred Russo schlägt mit der aktuellen Folge seiner Serie zur Geschichte der Urbanität nach neun Teilen über die Postmoderne ein neues Kapitel auf: Stadt-Handeln. Performative Strategien. In Teil 1 geht es um Stadtsucht und Stadtverdrossenheit.
Das Kunstinsert dieser Ausgabe hat Anna Jermolaewa gestaltet, die sich in ihren Arbeiten regelmäßig mit unterschiedlichen Ökonomien und Machtsystemen beschäftigt. Der Titel ihres Inserts lautet Panadero (Bäcker) und zeigt Fotos der Arbeit eines durch Havanna ziehenden Brotverkäufers. Mehr dazu von Paul Rajakovics und Barbara Holub auf S. 32.
Bereits zum fünften Mal findet im Oktober unser Stadtforschungsfestival urbanize! statt. Gegründet anlässlich des zehnjährigen Erscheinens von dérive ist es damit mittlerweile selbst zum Jubilar geworden. Das ur5anize! Festival 2014 widmet sich unter dem Motto »Safe City« vom 3. bis 12. Oktober Fragen der Sicherheit im urbanen Raum und untersucht den Bedeutungswandel des Begriffs ebenso wie tatsächliche Anforderungen an eine gesicherte Lebensführung. Neben der Beschäftigung mit der rasanten Entwicklung von Überwachung und Kontrolle und den dahinter stehenden Macht- und Profitmechanismen, liegt ein besonderer Schwerpunkt der 5. Festivalausgabe auf Möglichkeiten der Herstellung sozialer Sicherheit in Zeiten der Krise und auf den potenziellen Chancen für ein Erstarken der Stadtgesellschaft durch neue soziale urbane Bewegungen. Alternative Konzepte zur Erhöhung der subjektiven Sicherheit werden ebenso ins Rampenlicht gerückt wie internationale Bottom-up-Initiativen und -Netzwerke, um Aufschlüsse über alternative Formen zur Herstellung von Sicherheit zu gewinnen.
Das Detail-Programm wird im August auf www.urbanize.at veröffentlicht. Eine urbanize-Veranstaltung können Sie sich aber schon jetzt dick im Kalender anstreichen: Am 10. Oktober im Wien Museum begrüßen wir den Stadtforscher und Geographen Stephen Graham, Super-Experte in Sachen military urbanism, zu einem Vortrag über die höchst bedenkliche Militarisierung öffentlicher Räume.
Doch vorerst wünschen wir einen schönen Sommer und eine anregende Lektüre, mit der wir sie zwar nicht smarter, aber jedenfalls wiser machen wollen!
Christoph Laimer, Elke Rauth