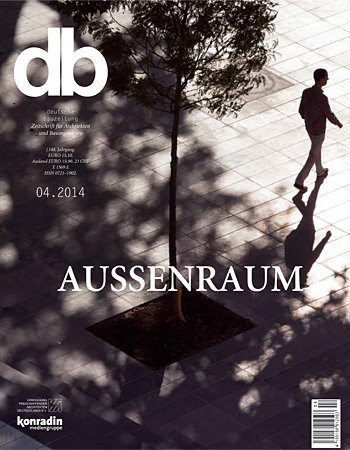Editorial
Ob im Park, auf einem Platz oder einer Promenade, Menschen begegnen sich mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. So will der eine nur schnell von A nach B, der andere sucht einen Platz zum Hinsetzen und Verweilen, der nächste für Spiel und Sport. Daher sollte die Gestaltung des Außenraums stets facettenreich sein und vielerlei Nutzungs angebote machen. Dabei trägt eine durchdachte Gestaltung und dauerhafte Materialisierung von Mobiliar und Belägen ebenso zu einer hohen Aufenthaltsqualität bei wie z. B. das ausgewogene Verhältnis von versiegelter Fläche zu Schatten spendendem Grün oder die Beleuchtungssituation nach Einbruch der Dunkelheit.
Als Schnittmenge individueller Interessen darf der Außenraum nicht von seiner Umgebung losgelöst behandelt werden. Dass sich eine ausführliche Analyse und Auseinandersetzung mit dem Ort lohnt, zeigen die in dieser Ausgabe kritisch betrachteten Projekte in Paris, Berlin, Rotterdam, Göttingen und in einer belgischen Klosteranlage. | Martin Höchst
Politikwechsel
(SUBTITLE) Neugestaltung der »Place de la République« in Paris (F)
Bei der konsequenten Neuordnung des zweitgrößten Platzes von Paris wiesen Politiker und Planer den Autoverkehr in seine Schranken, sehr zum Gewinn von Fußgängern und Radfahrern. Seine neue unaufgeregt, großzügige Gestaltung lässt von der ruhigen Mittagspause bis hin zur Großveranstaltung beinahe alles zu.
Frankreichs Staatspräsident François Mitterand suchte seinen Ruhm u. a. mit dem »Grand Louvre« zu mehren, Nicolas Sarkozy mag das für Kinderkram gehalten haben und lancierte gleich das epochale Projekt »Grand Paris«. Die Präsidenten der Grande Nation hoffen nicht zu Unrecht, als Bauherren vom Glanz ihrer Hauptstadt etwas abzubekommen. Doch derzeit läuft ihnen der Maire de Paris klar den Rang ab. Bertrand Delanoë, seit 2001 Bürgermeister – und das als erster »Linker« nach 1871 – setzte sich für seine Amtszeit ganz andere Ziele: Die Luftverschmutzung in Paris soll bis 2020 um 50 % gesenkt, der Autoverkehr um 40 % reduziert werden. Und die Bilanz Delanoës, der bei den Kommunalwahlen 2014 nicht mehr kandidiert, kann sich sehen lassen: Er ließ eine neue Tram als fast geschlossenen Ringverkehr um das Zentrum bauen, das Fahrradverleihsystem »Vélib« einrichten, autofreie Tage verordnen, 700 km neue Fahrradwege bauen, Strandanlagen am rechten und Fußgängerzonen am linken Ufer der Seine anlegen. Delanoë verhalf Paris in rasantem Tempo zu einer urbanen Qualität, die mehr und mehr unter Autodreck- und -lärm sowie der Aggressivität genervter Autofahrer verloren schien.
Der gesamte öffentliche Raum in Paris profitiert nun von einem Paradigmenwechsel, dem sich auch Boris Johnson in London oder Michael Bloomberg in New York verschrieben haben: Eine neu organisierte Mobilität bietet die Voraussetzung dafür, dass sich Menschen auf Plätzen und Straßen – und damit in ihrer Stadt – wieder wohlfühlen können und nicht wie gehetzte Hasen ihre Haken durch das Verkehrsgestrüpp schlagen müssen.
Der Paradigmenwechsel in der Stadtreparatur bedarf des angesprochenen politischen Willens und der Machtfülle, um ihn durchzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die Place de la République sondern auch das Projekt des Uferabschnitts Les Berges, das ebenfalls in dieser Ausgabe vorgestellt wird (s. S. 26-31), zu sehen.
Republikanische Werte
Mit der stattlichen Größe von 280 x 120 m gehört »République« zu den großen Plätzen von Paris. Baron Haussmanns Verwaltung hatte 1865 eine längsrechteckige Kontur vorgesehen, die von Gabriel Davioud geplant wurde – einem erfahrenen Architekten, dem man schon die Places Saint Michel und du Châtelet verdankte.
Zu dieser Zeit hieß République noch »Place du Château d'Eau«, und man baute schnell, um zur Weltausstellung 1867 etwas vorzeigen zu können. Doch als am 4. September 1870 die neue Republik ausgerufen wurde, war der Platz noch eine Baustelle. Erst die Weltausstellung 1878 drängte zur Entscheidung. Eugène Viollet-le-Duc, seit 1874 im Conseil Municipale, wurde zur dominanten Figur des »Second Empire«, und gerade hier, an der Place du Château d'Eau, betonte er die soziale Struktur der Umgebung, die von Arbeitern bewohnt wurde und sich als Ort republikanischer Werte und Einrichtungen eignete. So wurde ein Wettbewerb für eine »Marianne« mit drei Figuren – Liberté, Fraternité, Égalité – ausgelobt, den die Brüder Léopold und François Morice gewannen. Seit dem 14. Juli 1883 dominiert die Marianne als 9,5 m hohe Bronzestatue auf einem mehr als 15 m hohen Sockel den Platz, den man 1889 zur Place de la République umbenannte.
Belastet
Bei République stoßen drei Arrondissements mit eigenen Maires aneinander, heute kreuzen sich hier fünf Metro-Linien, vier Buslinien und sieben Verkehrsachsen. Zuletzt nahm der motorisierte Verkehr zwei Drittel der Platzfläche in Beschlag – ein unhaltbarer Zustand in einem dicht bebauten und bewohnten Quartier, den das Atelier Parisien d’Urbanisme und die Direction de la Voirie et des Déplacements der Stadt zusammen mit dem Verkehrsverbund RATP grundlegend analysierte. Anschließend begannen 2008 die politischen Planungsgespräche, und bereits 2009 wurde der Umbauwettbewerb für fünf eingeladene Arbeitsgemeinschaften aus Architekten und Landschaftsarchitekten ausgelobt. 2010 folgte eine Überarbeitungsphase und 2011 stand die Planungskonzeption fest – im Juni 2013 eröffnete Delanoë den Platz.
Platz für alle(s)
Als ich mich mittags mit dem Projektleiter Vincent Hertenberger auf der Südostseite der Marianne treffe, steht die Sonne bereits im Süden und verleiht der glatten Platzoberfläche einen hellen, aber nicht grellen Schimmer – schöneres Licht kann man sich kaum vorstellen. Wer Paris noch aus den 90er Jahren kennt, staunt: Als Fußgänger ist man hier auf einmal König, und es ist nicht mehr lebensgefährlich, vom Rand zur Mitte des Platzes zu gehen. Im Gegenteil, es bereitet Vergnügen, denn die Aufmerksamkeit wird nicht mehr vom Verkehr beansprucht, man kann die Augen gefahrlos schweifen lassen, darf stehen bleiben, Skatern zuschauen und wer weiß was. Und was noch mehr beeindruckt: Es sieht so aus, als sei alles schon immer so gewesen.
Das Wichtigste: Der motorisierte Verkehr, der zuvor den Platz einschnürte und um die Marianne herum halbierte, ist im Wesentlichen an die nordwestliche Seite verlegt worden. Dadurch ließ sich der gesamte Platz als Fläche für Fußgänger, Fahrradfahrer und Skater freiräumen, die im Sinne eines »shared space« aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Konsequent ließen die Architekten den ganzen, 2 ha großen Platz mit unterschiedlich großen Betonplatten belegen (12 beziehungsweise 14 cm dick, drei Größen: 192 x 68 cm, 95 x 34 und 48 x 17 cm). Richtung Osten ist der Platz kaum spürbar abschüssig, was aber partiell mit deutlich sichtbaren Stufen aufgefangen wird.
Im Sommer beschatten teilweise erneuerte Platanenreihen den Platz, auch Zierkirschen sind dazugekommen. Alt und Neu ergänzen sich auch im Stadtmobiliar aufs Beste. Auffällig sind 24 neue, robuste Massivholzbänke; hier setzt man sich nicht vorübergehend hin, hier möchte man eigentlich gern sitzenbleiben – so grob die Bänke im ersten Moment wirken, so deutlich tragen sie zur erstaunlich ruhigen Alltagsatmosphäre des Platzes bei. Im Sommer stehen zusätzlich Stahlstühle zur Verfügung. Die alten Métro-Eingänge blieben genauso erhalten wie einzelne, restaurierte Leuchten. Vereinzelt und am Platzrand durchgängig, ragen neue, nadelförmige Leuchten empor, die mit farbigen Lichtspielen dezent für Ab- wechslung sorgen können. Das ganze Stadtmobiliar ist harmlos, unauffällig, sympathisch – »comme il faut«.
Nicht aus Angst vor der Leere, sondern um auf dem Platz eine Differenzierung zu schaffen, entstand auf der Westseite ein kleiner Pavillon in sehr zurückhaltender Architektursprache. Das rundum verglaste Medien-Café »Mode & Médias« (mit den Architekten NP2F) steht in der Längsachse am Rande eines sehr flachen Wasserfelds, das mit Nebeldüsen bestückt ist und auf dem sich im Sommer Kinder en masse vergnügen. Jetzt im Winter ist es jedoch nicht gefüllt, weil es ebenfalls mit Betonplatten belegt ist, erweisen sich die Beckenränder dann allerdings als kleine Stolperkanten. Das Café bietet geschützte Außenplätze mit einem weiten Blick über dieses Becken hinweg auf den ganzen Platz – sofern keine Veranstaltungen stattfinden.
Die Freude am leeren, ruhigen Platz darf über eine seiner Funktionen nämlich nicht hinwegtäuschen. Ob öffentliche Konzerte, Ausstellungen, Feste, Versammlungen: Für all das ist die Place de la République explizit auch gedacht. Salopp gesagt: Es soll auch Leben in die Bude.
Verkehrt
Paris setzte mit Baron Haussmann im 19. Jahrhundert Stadtplanungsmaßstäbe. Die deutschen Stadtplanungsstrategen dieser Zeit, Camillo Sitte, Karl Henrici und Josef Stübben, kannten Paris, schätzten aber v. a. die Rolle des Verkehrs sehr unterschiedlich ein. Stübben erwies sich als Realist und maß ihm hohe Bedeutung bei. Wer konnte ahnen, dass Menschen mit dem Automobil ihre Städte ruinieren würden? Was mit der Place de la République gelungen ist, setzt erneut Maßstäbe. Die Fläche des motorisierten Individualverkehrs wurde um ein Drittel reduziert – und dieses Drittel den Fußgängern und Radfahrern unspektakulär und nicht auftrumpfend zugeschlagen. Auf höchster politischer Ebene wird ohne Umschweife benannt, dass eine Stärkung der Fußgänger und Radfahrer zulasten der Autofahrer gehen muss – eine Erkenntnis, die in Deutschland ein Tabu bricht. Fritz Kuhn, grüner Oberbürgermeister von Stuttgart, ließ in den gegenwärtigen Debatten um ein neues Verkehrsentwicklungskonzept seiner Stadt wissen: »Eine pauschale Politik gegen das Auto ist mit mir nicht zu machen.« Schade eigentlich.db, Do., 2014.04.03
03. April 2014 Ursula Baus
Spielen statt parken
(SUBTITLE) Umnutzung eines Parkdecks zum Quartiersplatz in Göttingen
Der neue Treffpunkt einer Wohnsiedlung der 70er Jahre schafft auf dem vormaligen Parkdeck einer Siedlungsgarage einen wohltuenden und identitätsstiftenden Stadtraum, der seinen Nutzern mit seiner eigenständigen Gestaltung vielfältige Angebote macht.
Der im Westen Göttingens gelegene Stadtteil Grone besteht zum einen aus der kleinteiligen Struktur des vormaligen Dorfkerns im Norden und zum anderen aus großmaßstäblichen Wohnsiedlungen, die seit den 70er Jahren südlich davon entstanden. Diese Bereiche Grones werden neben ihrem großen Wohnanteil v. a. durch die hohe Konzentration ihrer größtenteils einkommensschwachen Bewohnerschaft geprägt. Den daraus resultierenden gesellschaftlichen Problemen versucht die Stadt mit öffentlichen Fördermitteln auch seitens der EU, des Bundes und des Landes Niedersachsen entgegenzuwirken. So wurde bereits 2007 im Rahmen des »Soziale Stadt«-Konzepts in Grone-Süd ein Nachbarschaftszentrum errichtet.
In Grone-Nord zeichnete sich schon seit längerer Zeit ein Sanierungsstau ab und dies besonders deutlich in einem Quartier des ehemaligen Gewerkschaftskonzerns »Neue Heimat« aus den 70er Jahren, das aus heutiger Sicht deutliche stadtplanerische Mängel aufweist. Dem seinerzeit vorherrschenden Ideal einer modernen Stadt folgt die räumliche Trennung von Wohnen und öffentlichen Einrichtungen entlang der St.-Heinrich-Straße: Während sich im Westen Kindertagesstätte, Schule, Sporthallen, Kirche und Supermarkt aufreihen, stehen im Osten entlang der Quartiersachse ausschließlich Wohnungsbauten. Immerhin zeigen sich mittlerweile die Fassaden der üppig durchgrünten Wohnblöcke saniert, und ein kleiner bestehender Teich wurde jüngst ebenfalls wieder hergerichtet. Außer wenigen Spielplätzen für Kleinkinder beschränkte sich der öffentliche Raum jedoch bislang im Wesentlichen auf breite Stichstraßen mit einem Übermaß an Parkplätzen – es mangelte an Begegnungsflächen mit Aufenthaltsqualität.
An zentraler Stelle des Areals befand sich eine baufällige Quartiersgarage, deren Oberdeck schon seit etlichen Jahren gesperrt war. Die Renovierung des Bestands oder der Neubau eines neuen, höheren Garagenhofs mit zusätzlichen überdachten Stellplätzen standen für die Verwaltungsgesellschaft des Wohnkomplexes zur Disposition. Für deren Projektpartner war Fabian Lippert von LKA Lippert Kavelly Architekten aus Berlin schon öfter tätig und bekam so die Gelegenheit, einen Quartierplatz auf dem Parkdeck umzusetzen. Lediglich 40 Stellplätze des unteren Niveaus der Bestandsgarage mussten, behördlich vorgeschrieben, bestehen bleiben. Nach einer Vorstudie erhielt er den Direktauftrag, 1,70 m über Straßenniveau einen Ort der Begegnung mit Spielmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten zu planen.
Neue Mitte
Der 2013 eingeweihte Quartiersplatz schafft eine Mitte für die Nachbarschaft und vermittelt zudem stadträumlich zwischen den Geschosswohnungsbauten und den westlich liegenden Einfamilienhäusern. Der Straßenecke im Nordwesten folgend wird er an zwei Seiten über eine umlaufende Treppe aus Betonfertigteilen erschlossen. Um jedoch die Grundstücksgrenze nicht zu überschreiten, fällt diese im Steigungsverhältnis 19/26 cm recht steil aus. Trotz der baugenehmigungsrelevanten Geländer an ihren Stirnseiten, bzw. über der Garageneinfahrt, mutet das Podest wie ein Miniatur-Tempel der Maya an und lässt sich dadurch kaum übersehen. An den beiden Seiten zum Blockinnern vermitteln begrünte Böschungen, die im Winter offensichtlich bereits als Rodelhügel genutzt wurden, zur anschließenden Vegetation. Eine Zick-Zack-Rampe gewährt hier auch barrierefreien Zugang zur Platzebene, auf der zwei schlank detaillierte und räumlich wirkungsvoll versetzt angeordnete Pergolen wunderbar in ihrer Maßstäblichkeit mit den benachbarten fensterlosen Gebäudestirnseiten korrespondieren.
Die beiden Stahlkonstruktionen sollen die Bewohner durch ihre Tiefenstaffelung auf das Plateau locken und dienen außerdem einer Tischtennisplatte sowie einer u-förmigen Sitzbank als Witterungsschutz. Ihre abgehängten Leuchtkästen spenden abends einerseits direktes Licht, tauchen den Platz andererseits in ein von den mit Edelstahlblech bekleideten Dachuntersichten reflektiertes, indirektes Licht. Während zwei Sitzgruppen mit Brettspieltischen sich älterem Publikum anbieten, können kleinere Kinder eine Tafelfläche mit Kreidezeichnungen bemalen oder die beiden dauerhaften Bodenzeichnungen für Himmel und Hölle auf dem federnden Untergrund des hellen Gummibelags in Beschlag nehmen. Hell zeigen sich auch die nach Eigenentwürfen mit Weißzement betonierten, minimalistischen Möbel und die Treppenstufen. Sämtliche dunkel beschichteten Stahlelemente sowie der asphaltgraue Plattenbelag des kleinen Vorplatzes mit seinen in Anthrazit durchgefärbten Betonbänken stehen dazu effektvoll im Kontrast.
Diese »Unfarbigkeit« der Anlage wird jedoch durch ein farbiges Bodenbild gebrochen, das sich beinahe über die ganzen gut 1 000 m² der oberen Ebene erstreckt: Gerade und geschwungene Linien bilden als ineinander verschränkte Buchstaben das Wort »GRONE«. Das »E« definiert dabei ein Federballfeld. Erdacht hat dieses heitere und identitätsstiftende Schriftlogo Ina Geißler, die auch an der Müllbox und den Außenpfeilern der Tiefgarage neonrot-leuchtende Farbakzente gesetzt hat. Die Künstlerin und ihr Mann, Architekt Fabian Lippert, haben bereits einige Projekte gemeinsam verwirklicht.
Dünne Decken
Ohne Bestandsunterlagen gestaltete sich der Umbau als konstruktive Herausforderung. Die massiven Brüstungen des Parkdecks wurden abgebrochen; dank des Kunstgriffs der breiten Treppe und der Anböschung konnte auf eine weitläufige Absturzsicherung verzichtet werden. Lediglich zu den umliegenden Hauszeilen übernehmen Ortbetonwände diese Funktion. Das ehemals weitgehend offene untere Parkgeschoss wurde, abgesehen von vier Lüftungsgittern zur Entrauchung im Brandfall, beinahe vollständig mit Betonfertigteilen geschlossen.
Die Änderung der Verkehrslast von 3,5 KN/m² (Parkplatzfläche) auf 5 KN/m² (Versammlungsstätte) bedingte – angesichts der bestehenden schwach bewehrten, 10 cm dicken Betondecke aus Pi-Platten – sowohl die Lage der Pergolen auf das Stützraster der Garage abzustimmen als auch einen möglichst leichten Bodenaufbau zu verwenden. Zur Verringerung der Eigenlast wurde zudem die marode Asphalt-Abdichtung abgeschliffen. Unterhalb des wasserdurchlässigen Gummi-Oberbelags überbrückt nun ein druckfester, kunststoffgebundener Glasschaum (ebenfalls wasserdurchlässig) den bis zu 30 cm großen Abstand zur Betonkonstruktion darunter. Da die meisten der bestehenden Felder der Betondecke bereits für eine Entwässerung geeignete Neigungen aufwiesen, wurde lediglich bei den wenigen waagerechten Elementen ein »Rücken« aufgespachtelt und anschließend eine durchgehende Dichtungsebene aufgebracht. Aus dieser Ebene schließlich wird das anfallende Oberflächenwasser dem naheliegenden Teich zugeleitet.
Ausnahmeerscheinung
Selten genug hat ein Architekt eine solch umfassende Gestaltungsfreiheit wie Fabian Lippert bei der Umnutzung des Parkdecks. Dass er seine Chance nutzte, zeigt sich u. a. am variantenreichen, sorgfältig geplanten und spielerisch anmutenden Umgang mit dem Werkstoff Beton – egal ob schalungsglatt, sandgestrahlt, gesäuert oder geschliffen – für die möglichst robuste Außenmöblierung. Die Motive von Pyramidenstumpf und Raute kehren bei näherer Betrachtung in etlichen Details (Sitzbänke, Lampenabhängung, Rolltor, Geländermaschen) wieder.
Den Anwohnern, die sich den Platz bereits zu eigen gemacht haben, kann man zum Quartierstreffpunkt nur gratulieren. Großes Lob gebührt auch der Wohnungsgesellschaft, die als Bauherr beim Quartiersplatz Grone neben wirtschaftlichen offensichtlich auch gestalterische Ansprüche ernsthaft verfolgte.db, Do., 2014.04.03
03. April 2014 Hartmut Möller
Rheinpark in Köln
Egal in welchem Zustand, die Kölner lieben ihren Rheinpark. Nach den Höhepunkten der Bundesgartenschauen 1957 und 1971 verwahrloste er zwar jeweils zunehmend, doch ging nur wenig dabei verloren. Seit einigen Jahren engagieren sich Stadt und Bürger dafür, das außergewöhnlich vielfältige gartengestalterische Erbe zu erhalten.
´Die Idee aus der Uferlandschaft zwischen Deutzer Messe und Mühlheimer Hafen einen Volkspark zu machen, stammt bereits aus den 20er Jahren. Schon damals schuf man hier einen Park mit funktionaler Zweigliederung: Spiel und Sport auf weiten Auenwiesen sollten den Großstädtern gut tun, ein gärtnerisch stärker kultivierter Bereich hinter dem schützenden Deich Ruhe und Kontemplation ermöglichen. Doch der Zweite Weltkrieg hinterließ auch auf dem Rheinparkgelände nur Bombenkrater und Trümmer. Und während ringsum die Stadt wieder aufgebaut wurde, entsorgte man hier den Schutt, der bald zu unübersehbaren Halden angewachsen war. Als Köln sich für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 1957 bewarb, war der Wunsch groß, an dieser Stelle endlich wieder Raum für Spiel und Erholung zu schaffen.
Modelliert
»Blumen blühen am Rhein« hieß es, als die Gartenschau im April 1957 eröffnet wurde, doch die Pracht der 2,5 Mio. Pflanzen war nur eine ihrer zahlreichen Facetten. Unter der künstlerischen und technischen Oberleitung des städtischen Gartenbaudirektors Kurt Schönbohm waren die Trümmerberge und der Deich auf einem 2,3 km langen Streifen entlang des Rheins zu einer reizvoll welligen Landschaft modelliert worden, die vom Ufer aus leicht anstieg und unattraktive Ansichten von Hafen und Industrie verbarg. Schönbohm, der seinen Rahmenplan aus Elementen der prämierten Wettbewerbsbeiträge des Architekten Rembald von Steinbüchel-Rheinwall, der Gartenarchitekten Günther Schulze und Joachim Winkler und der Landschaftsarchitektin Hertha Hammerbacher erarbeitet hatte, verteilte unterschiedlich gestaltete Themeninseln, deren Dichte und Grad an Gestaltung zum Ufer hin abnahmen, über das Areal. Damit griff er zwar die historische Zweigliederung des Parks wieder auf, vermied jedoch den vormalig harten Bruch zwischen Landschaft und Garten. Mit der Rheinseilbahn, einem Sessellift und der Kleinbahn »Trans-Rheinpark-Express«, fügte er der Gartenschau noch eine attraktive technische Ebene hinzu.
Bis heute wurde an der seit 1989 denkmalgeschützten Anlage des Rheinparks nur wenig verändert. Man sieht dem Park jedoch an, dass er etlichen Hochwasserständen ebenso widerstehen musste wie dem Flächenfraß durch die angrenzende Messe und benachbarter Industrie. Seit 1966 »überfliegt« die Zoobrücke den Park an seinem Nordende und das Dauerrauschen der sechsspurigen Autobahn wurde Teil seiner Geräuschkulisse. Auch die BUGA von 1971 auf demselben Gelände hinterließ ihre Spuren. Doch gelang es, das Gesamtkunstwerk von 1957 nicht zu überzeichnen: dasselbe Planungsteam um Schönbohm ergänzte und modernisierte vorsichtig den Bestand.
Als großes Problem stellte sich in den 80er Jahren jedoch das fehlende Nachnutzungskonzept für das Gartenschaugelände heraus. Der Stadt fehlten die Mittel, und so ließ sie Beete verwildern und Sichtachsen zuwachsen, sanierungsbedürftige Spielgeräte wurden abgebaut und nicht mehr ersetzt, die Cafés standen leer. Nach und nach verblasste das Erscheinungsbild der einst so eleganten und modernen Parklandschaft. Erst großes bürgerschaftliches Engagement führte dazu, dass der Erhalt des Rheinparks zum lokalpolitischen Thema wurde. Nach einer umfangreichen Analyse wurde die Sanierung schließlich angegangen, sodass der Rheinpark sein 50-jähriges Bestehen im Jahr 2007 in einem angemessenen Zustand feiern konnte.
Hierarchielos
2001 saniert und neu bespannt prägt die leichte Überdachung (Frei Otto 1957) des Tanzbrunnens, das sogenannte Sternwellenzelt, noch heute die Rheinansicht des Parks. Nur als temporäres Eingangsbauwerk der Gartenschau geplant war hingegen der eindrucksvolle mit einem 700 m² großen Glasseide-Segel überspannte Stahlbogen, ebenfalls von Frei Otto, und wurde danach wieder abgebaut. Das Rosencafé im Norden des Parks (Fritz Ruempler) und das Restaurant Rheinterrassen (Hans Schilling) blieben zwar erhalten, doch Erweiterungen und Umbauten schränken mittlerweile deren Lesbarkeit und Zugänglichkeit erheblich ein. Wer den Park heute besucht, wird den Schwund der Architektur dennoch kaum bemerken, so beeindruckend sind die Weite und Vielschichtigkeit der Anlage. Großzügige geschwungene Wege durchziehen das Gelände und verknüpfen die einzelnen Themeninseln, Rosengarten, Flamingoteich, Spielhügellandschaft, Brunnengarten, um nur einige zu nennen, miteinander. Hier wurde das Bild einer neuen Zeit gezeichnet, ohne Hierarchie, ohne Raster, ohne Brüche.
Auch Architektur und Landschaft standen und stehen gleichberechtigt nebeneinander. Im Rosengarten wurden nach Entwürfen von Schulze und Winkler fünf Lauben gebaut, einfache Stahlkonstruktionen, die an drei Seiten mit Glas verkleidet waren. Im Laufe der Jahre mussten zwar die Gläser entfernt werden, doch die filigranen, weiß gestrichenen Stahlskelette zeigen noch heute, wie groß der Wunsch danach war, das Gebaute auf ein Minimum zu beschränken, es aufzulösen, damit es mit seiner Umgebung eins werde. Ähnlich reduziert gestaltet und von hoher grafischer Wirkung sind auch die Pergolen an den Wasserterrassen von Hertha Hammerbacher und die »Windharfen« ihrer Tochter Merete Mattern im Staudengarten.
Betoniert
Zur gestalterischen Einheit von Architektur und Landschaft trägt auch die abwechslungsreiche und sehr prägnante Verwendung von Beton bei. Fast könnte man von einem Fest für den Beton sprechen, mit so viel Ideenreichtum und Mut zum Experiment wurde er überall präsentiert. Der Werkstoff erlaubte neue Farben und Formen, strukturierte Oberflächen, filigrane Konstruktionen und er war günstig, schnell verfügbar und sehr modern. Und durchaus langlebig, wenn auch im Alter nicht unbedingt schöner, wie sich an der Vielfalt der erhaltenen Plattenbeläge, Treppenelemente und Brunneneinfassungen zeigt.
Ein trauriges Schicksal erleidet das Park-Café (Steinbüchel-Rheinwall), das im Ensemble mit Tropenhof, großem Blumengarten und Wassergarten das Zentrum der ursprünglichen Parkanlage gebildet hat. Auch heute noch führt das dreigeschossige Gebäude, das entgegen vielfacher Behauptungen keineswegs nur für eine temporäre Nutzung errichtet worden war, mit geschwungenen Terrassen, filigranen Rampen, fliegendem Dach und überschlanken Stützen das stilistische Repertoire der 50er Jahre vor. Doch seit Jahrzehnten verfällt der leer stehende Bau zusehends, eine wirtschaftliche Nutzung zu finden scheint unmöglich, seine Zukunft ist weiter ungewiss.
Immer wieder galt es, im Rheinpark individuelle Lösungen zu finden, die Geschichte und Gegenwart gleichermaßen gerecht werden. Bei der Sanierung der charakteristischen Pflasterungen, Betonverbundsteinen, Klinker und Grauwacke, geht die Stadt sehr zurückhaltend vor und ersetzt nur, was zur Gefahr wird. Denn einmal angehoben, so zeigt es sich, lassen sich die inzwischen mürben Beläge kein zweites Mal verlegen. Der Erhalt einzelner Parkelemente wie die Kieselmosaike des Brunnengartens ist sogar so aufwendig, dass er nur durch die Arbeit eines Unterstützervereins gesichert werden kann. Und ob die kostbaren Bronzestatuen aus den 50ern, die zunehmend häufig zerstört werden, weiter in der öffentlichen Grünanlage stehen können, muss noch entschieden werden. Als wahre Publikumsmagneten haben sich indessen über alle Jahrzehnte hinweg die großen, außergewöhnlich gestalteten Spielplätze und die variantenreichen Wasserspiele erwiesen.
Wirklich störend in dieser bunten Collage von Parkelementen sind die Gestelle der sogenannten Schaufenster mit Einblicken in die Geschichte des Parks, die vor einigen Jahren an den schönsten Stellen platziert wurden. Eine Grünanlage wie der Rheinpark in Köln braucht jedoch kein didaktisches Mobiliar, vielmehr soll er entdeckt werden und überraschen dürfen.db, Do., 2014.04.03
03. April 2014 Uta Winterhager