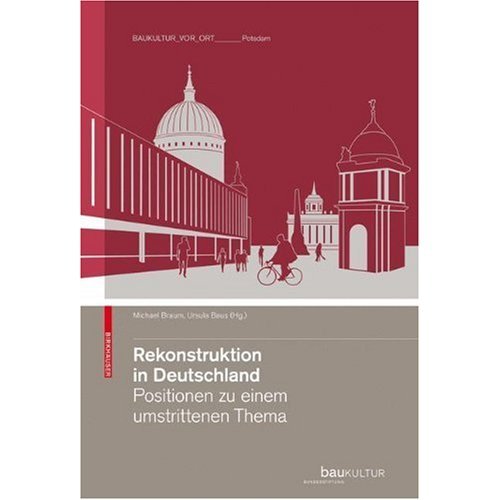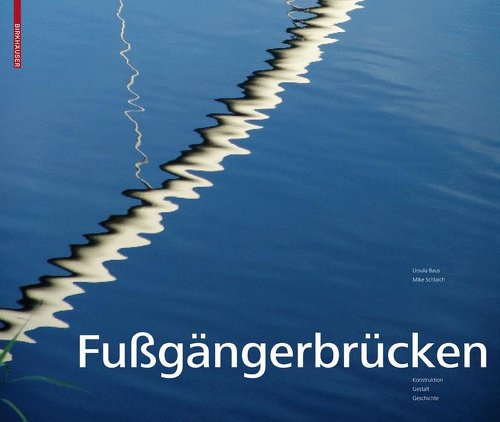Bei der konsequenten Neuordnung des zweitgrößten Platzes von Paris wiesen Politiker und Planer den Autoverkehr in seine Schranken, sehr zum Gewinn von Fußgängern und Radfahrern. Seine neue unaufgeregt, großzügige Gestaltung lässt von der ruhigen Mittagspause bis hin zur Großveranstaltung beinahe alles zu.
Bei der konsequenten Neuordnung des zweitgrößten Platzes von Paris wiesen Politiker und Planer den Autoverkehr in seine Schranken, sehr zum Gewinn von Fußgängern und Radfahrern. Seine neue unaufgeregt, großzügige Gestaltung lässt von der ruhigen Mittagspause bis hin zur Großveranstaltung beinahe alles zu.
Frankreichs Staatspräsident François Mitterand suchte seinen Ruhm u. a. mit dem »Grand Louvre« zu mehren, Nicolas Sarkozy mag das für Kinderkram gehalten haben und lancierte gleich das epochale Projekt »Grand Paris«. Die Präsidenten der Grande Nation hoffen nicht zu Unrecht, als Bauherren vom Glanz ihrer Hauptstadt etwas abzubekommen. Doch derzeit läuft ihnen der Maire de Paris klar den Rang ab. Bertrand Delanoë, seit 2001 Bürgermeister – und das als erster »Linker« nach 1871 – setzte sich für seine Amtszeit ganz andere Ziele: Die Luftverschmutzung in Paris soll bis 2020 um 50 % gesenkt, der Autoverkehr um 40 % reduziert werden. Und die Bilanz Delanoës, der bei den Kommunalwahlen 2014 nicht mehr kandidiert, kann sich sehen lassen: Er ließ eine neue Tram als fast geschlossenen Ringverkehr um das Zentrum bauen, das Fahrradverleihsystem »Vélib« einrichten, autofreie Tage verordnen, 700 km neue Fahrradwege bauen, Strandanlagen am rechten und Fußgängerzonen am linken Ufer der Seine anlegen. Delanoë verhalf Paris in rasantem Tempo zu einer urbanen Qualität, die mehr und mehr unter Autodreck- und -lärm sowie der Aggressivität genervter Autofahrer verloren schien.
Der gesamte öffentliche Raum in Paris profitiert nun von einem Paradigmenwechsel, dem sich auch Boris Johnson in London oder Michael Bloomberg in New York verschrieben haben: Eine neu organisierte Mobilität bietet die Voraussetzung dafür, dass sich Menschen auf Plätzen und Straßen – und damit in ihrer Stadt – wieder wohlfühlen können und nicht wie gehetzte Hasen ihre Haken durch das Verkehrsgestrüpp schlagen müssen.
Der Paradigmenwechsel in der Stadtreparatur bedarf des angesprochenen politischen Willens und der Machtfülle, um ihn durchzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die Place de la République sondern auch das Projekt des Uferabschnitts Les Berges, das ebenfalls in dieser Ausgabe vorgestellt wird (s. S. 26-31), zu sehen.
Republikanische Werte
Mit der stattlichen Größe von 280 x 120 m gehört »République« zu den großen Plätzen von Paris. Baron Haussmanns Verwaltung hatte 1865 eine längsrechteckige Kontur vorgesehen, die von Gabriel Davioud geplant wurde – einem erfahrenen Architekten, dem man schon die Places Saint Michel und du Châtelet verdankte.
Zu dieser Zeit hieß République noch »Place du Château d'Eau«, und man baute schnell, um zur Weltausstellung 1867 etwas vorzeigen zu können. Doch als am 4. September 1870 die neue Republik ausgerufen wurde, war der Platz noch eine Baustelle. Erst die Weltausstellung 1878 drängte zur Entscheidung. Eugène Viollet-le-Duc, seit 1874 im Conseil Municipale, wurde zur dominanten Figur des »Second Empire«, und gerade hier, an der Place du Château d'Eau, betonte er die soziale Struktur der Umgebung, die von Arbeitern bewohnt wurde und sich als Ort republikanischer Werte und Einrichtungen eignete. So wurde ein Wettbewerb für eine »Marianne« mit drei Figuren – Liberté, Fraternité, Égalité – ausgelobt, den die Brüder Léopold und François Morice gewannen. Seit dem 14. Juli 1883 dominiert die Marianne als 9,5 m hohe Bronzestatue auf einem mehr als 15 m hohen Sockel den Platz, den man 1889 zur Place de la République umbenannte.
Belastet
Bei République stoßen drei Arrondissements mit eigenen Maires aneinander, heute kreuzen sich hier fünf Metro-Linien, vier Buslinien und sieben Verkehrsachsen. Zuletzt nahm der motorisierte Verkehr zwei Drittel der Platzfläche in Beschlag – ein unhaltbarer Zustand in einem dicht bebauten und bewohnten Quartier, den das Atelier Parisien d’Urbanisme und die Direction de la Voirie et des Déplacements der Stadt zusammen mit dem Verkehrsverbund RATP grundlegend analysierte. Anschließend begannen 2008 die politischen Planungsgespräche, und bereits 2009 wurde der Umbauwettbewerb für fünf eingeladene Arbeitsgemeinschaften aus Architekten und Landschaftsarchitekten ausgelobt. 2010 folgte eine Überarbeitungsphase und 2011 stand die Planungskonzeption fest – im Juni 2013 eröffnete Delanoë den Platz.
Platz für alle(s)
Als ich mich mittags mit dem Projektleiter Vincent Hertenberger auf der Südostseite der Marianne treffe, steht die Sonne bereits im Süden und verleiht der glatten Platzoberfläche einen hellen, aber nicht grellen Schimmer – schöneres Licht kann man sich kaum vorstellen. Wer Paris noch aus den 90er Jahren kennt, staunt: Als Fußgänger ist man hier auf einmal König, und es ist nicht mehr lebensgefährlich, vom Rand zur Mitte des Platzes zu gehen. Im Gegenteil, es bereitet Vergnügen, denn die Aufmerksamkeit wird nicht mehr vom Verkehr beansprucht, man kann die Augen gefahrlos schweifen lassen, darf stehen bleiben, Skatern zuschauen und wer weiß was. Und was noch mehr beeindruckt: Es sieht so aus, als sei alles schon immer so gewesen.
Das Wichtigste: Der motorisierte Verkehr, der zuvor den Platz einschnürte und um die Marianne herum halbierte, ist im Wesentlichen an die nordwestliche Seite verlegt worden. Dadurch ließ sich der gesamte Platz als Fläche für Fußgänger, Fahrradfahrer und Skater freiräumen, die im Sinne eines »shared space« aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Konsequent ließen die Architekten den ganzen, 2 ha großen Platz mit unterschiedlich großen Betonplatten belegen (12 beziehungsweise 14 cm dick, drei Größen: 192 x 68 cm, 95 x 34 und 48 x 17 cm). Richtung Osten ist der Platz kaum spürbar abschüssig, was aber partiell mit deutlich sichtbaren Stufen aufgefangen wird.
Im Sommer beschatten teilweise erneuerte Platanenreihen den Platz, auch Zierkirschen sind dazugekommen. Alt und Neu ergänzen sich auch im Stadtmobiliar aufs Beste. Auffällig sind 24 neue, robuste Massivholzbänke; hier setzt man sich nicht vorübergehend hin, hier möchte man eigentlich gern sitzenbleiben – so grob die Bänke im ersten Moment wirken, so deutlich tragen sie zur erstaunlich ruhigen Alltagsatmosphäre des Platzes bei. Im Sommer stehen zusätzlich Stahlstühle zur Verfügung. Die alten Métro-Eingänge blieben genauso erhalten wie einzelne, restaurierte Leuchten. Vereinzelt und am Platzrand durchgängig, ragen neue, nadelförmige Leuchten empor, die mit farbigen Lichtspielen dezent für Ab- wechslung sorgen können. Das ganze Stadtmobiliar ist harmlos, unauffällig, sympathisch – »comme il faut«.
Nicht aus Angst vor der Leere, sondern um auf dem Platz eine Differenzierung zu schaffen, entstand auf der Westseite ein kleiner Pavillon in sehr zurückhaltender Architektursprache. Das rundum verglaste Medien-Café »Mode & Médias« (mit den Architekten NP2F) steht in der Längsachse am Rande eines sehr flachen Wasserfelds, das mit Nebeldüsen bestückt ist und auf dem sich im Sommer Kinder en masse vergnügen. Jetzt im Winter ist es jedoch nicht gefüllt, weil es ebenfalls mit Betonplatten belegt ist, erweisen sich die Beckenränder dann allerdings als kleine Stolperkanten. Das Café bietet geschützte Außenplätze mit einem weiten Blick über dieses Becken hinweg auf den ganzen Platz – sofern keine Veranstaltungen stattfinden.
Die Freude am leeren, ruhigen Platz darf über eine seiner Funktionen nämlich nicht hinwegtäuschen. Ob öffentliche Konzerte, Ausstellungen, Feste, Versammlungen: Für all das ist die Place de la République explizit auch gedacht. Salopp gesagt: Es soll auch Leben in die Bude.
Verkehrt
Paris setzte mit Baron Haussmann im 19. Jahrhundert Stadtplanungsmaßstäbe. Die deutschen Stadtplanungsstrategen dieser Zeit, Camillo Sitte, Karl Henrici und Josef Stübben, kannten Paris, schätzten aber v. a. die Rolle des Verkehrs sehr unterschiedlich ein. Stübben erwies sich als Realist und maß ihm hohe Bedeutung bei. Wer konnte ahnen, dass Menschen mit dem Automobil ihre Städte ruinieren würden? Was mit der Place de la République gelungen ist, setzt erneut Maßstäbe. Die Fläche des motorisierten Individualverkehrs wurde um ein Drittel reduziert – und dieses Drittel den Fußgängern und Radfahrern unspektakulär und nicht auftrumpfend zugeschlagen. Auf höchster politischer Ebene wird ohne Umschweife benannt, dass eine Stärkung der Fußgänger und Radfahrer zulasten der Autofahrer gehen muss – eine Erkenntnis, die in Deutschland ein Tabu bricht. Fritz Kuhn, grüner Oberbürgermeister von Stuttgart, ließ in den gegenwärtigen Debatten um ein neues Verkehrsentwicklungskonzept seiner Stadt wissen: »Eine pauschale Politik gegen das Auto ist mit mir nicht zu machen.« Schade eigentlich.
db, Do., 2014.04.03
verknüpfte Zeitschriftendb 2014|04 Aussenraum
![]()