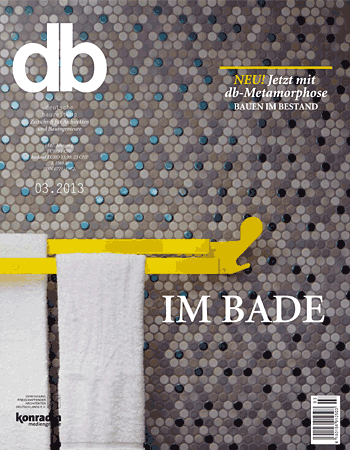Editorial
Ob zur Hygiene oder zur Entspannung, Baden gehört seit Jahrtausenden zum menschlichen Dasein. Die bauliche Ausformung von Bädern ist dabei ökonomischen und kulturellen Einflüssen ausgesetzt und spiegelt die Haltung einer Gesellschaft zu Körperpflege und Badekultur wider. Gleich welch spezifischer Nutzung Bäder gerecht werden müssen, gilt es, diesen Orten trotz aufwendiger technischer Ausstattung die passende Atmosphäre zu verleihen. Wir stellen Projekte vor – vom Sportbad mit Wellnessbereich über ein Mineralbad und ein Hamam bis hin zu Gästebädern im Hotel und privaten »Nasszellen« –, die individuell auf diese Herausforderung reagieren. | Martin Höchst
Wohlbefinden für alle
(SUBTITLE) Hallen- und Freibad mit Wellnessbereich in Graz (A)
Statt ein im Quartier beliebtes Hallen- und Freibad von Grund auf zu sanieren, entschied sich die Stadt Graz für die wirtschaftlichere Variante eines Neubaus. Entstanden ist ein Sportbad mit Wellnessbereich, das sich sowohl durch ein komplexes Raumprogramm als auch durch seine leichte und lichtdurchflutete Atmosphäre auszeichnet. Die Besucher strömen aus allen Stadtteilen.
Es war lange bekannt: Hallenbad und Sauna der Badeanlage aus den 70er Jahren waren desolat, ihr Betrieb nur mit extrem hohen Kosten aufrechtzuerhalten. Ein umfassendes Sanierungskonzept erwies sich als zu teuer und nicht in allen Punkten umsetzbar. Die Verwirklichung eines Orts modernster Badefreuden im einst bedeutenden Arbeiterbezirk Eggenberg im Grazer Westen scheint uns heute folgerichtig, ist aber dennoch bemerkenswert, weil sie auch als Bekenntnis der Stadt gelesen werden kann, sich das kommunale Angebot an Freizeitgestaltung viel Geld kosten zu lassen. Von Anfang an wurden bei diesem Projekt »Nägel mit Köpfen« gemacht – die Stadt als Bauherr und die Freizeitbetriebe der Stadtwerke als Auftraggeber erarbeiteten gemeinsam ein ambitioniertes Programm, Kosten wurden annähernd richtig geschätzt (was heute nicht immer selbstverständlich ist) und ein zweistufiger, EU-weit offener Wettbewerb wurde ausgeschrieben. Wassersportverbände, Schulen und sportliche Einzelkämpfer sollten mit einem wettkampftauglichen 50-m-Becken im Hallenbad angezogen werden, Freunde von Dampfbad und Saunakultur mit einem »Update« des Angebots von der einfachen Sauna bis hin zum bestausgestatteten Wellnessbereich.
fasch&fuchs.architekten konnten den Wettbewerb für sich entscheiden. Hemma Fasch, Gründerin und Miteigentümerin des heute in Wien ansässigen Büros, ist selbst im Grazer Bezirk Eggenberg aufgewachsen. Ihr stadträumliches Konzept sah als eines von wenigen Projekten vor, das geforderte Bauvolumen an die straßenseitigen Grundstücksränder im Norden und Osten zu rücken, um den Becken und Liegewiesen des Freibereichs damit Abschluss und Intimität zu geben. Der langgestreckte, mehrfach sanft geknickte Baukörper formt eine Geste ausgebreiteter Arme und gibt sich damit einladend oder bergend – je nachdem, von welchem Standort aus man ihn betrachtet. Seine zum Straßenraum hin weitgehend geschlossene Fassade aus geschuppten Metallpaneelen in unterschiedlichen Blautönen unterstreicht die Schutzfunktion. In der Diktion der Architekten gleicht das Gebäude der geöffneten Schale einer Muschel: von einer Seite uneinsehbar und verschlossen, zur anderen – nach Süden und Westen hin – weit geöffnet, seinen Inhalt ins beste Licht gerückt. Und tatsächlich war die Metapher der Auster namensgebend.
Entkoppelt und verbunden zugleich
Die horizontale und vertikale Organisation der Grundrisse spiegelt die Zweigeteiltheit der Funktionen deutlich wider: Die beiden divergierenden Raumprogramme von Hallenbad und Spa sind kreuzungsfrei voneinander getrennt, aber so angeordnet, dass der Zugang zu beiden im Zentrum liegt und der Übergang von einem zum anderen möglich ist. So kann auch, wer den Wellnessbereich bucht, von dort über die Schwimmbad-Garderobe im UG direkt in die Schwimmhalle gelangen.
Zum Haupteingang an der Schnittstelle der beiden Funktionsbereiche führt ein deutlich ansteigender Vorplatz mit Wartebänken. Vor dem Besucher liegen die Kasse, dahinter das Selbstbedienungs-Restaurant mit dem direkten Durchgang zum Freibad für den Sommerbetrieb, seitlich der Zugang zum Wellnessbereich und der Abgang in die Garderoben für Individualschwimmer. Sportler erreichen ihre Umkleiden unter der Tribüne über einen gesonderten Zugang. Die Garderoben geben dem Besucher bereits eine treffliche Vorschau auf das, was ihn danach in der Schwimmhalle erwartet. Sie sind hell, fröhlich, übersichtlich und bis ins Detail mit erstaunlicher Sorgfalt gestaltet. Schließfächer wurden zu farbig fein nuancierten Blöcken mit siebbedruckten Glasflächen als Hülle zusammengefasst.
Eine Glaswand ermöglicht schon vom Foyer aus einen ersten Überblick über die beeindruckend große, bis zu 11 m hohe Schwimmhalle, die, als Volumen sanft ins Gelände modelliert, ein Geschoss tiefer erschlossen wird. Der Logik der klaren Trennung unterschiedlicher Bereiche folgt auch die vertikale Schichtung der Funktionen. Über dem Foyer wurde die Verwaltung positioniert – getrennt vom öffentlichen Bereich, jedoch über ein Atrium im Blickkontakt zum Geschehen am Eingang. Das Gesundheitszentrum für Massagen und Anwendungen wiederum bildet eine Funktionseinheit für sich, die zwar über dem Wellnessbereich liegt und von dessen Ruhezone aus zugänglich ist, jedoch auch einen eigenen Zugang von außen hat, der es vom Bade- und Saunabetrieb entkoppelt.
In der Grundrisskonzeption der einzelnen Bereiche folgen die Architekten einem Gestaltungsprinzip, das jede ihrer Arbeiten kennzeichnet: Offenheit, Transluzenz und Transparenz. Sie legen Raumfolgen mit visueller Durchlässigkeit an oder verbinden Bereiche zu einem fließenden Raumkontinuum und schaffen es, selbst die Grenze zwischen Innen- und Außenraum in eine kaum merkliche Trennlinie zu verwandeln.
Modelliertes Raumvolumen
Eine Spezialität von fasch&fuchs.architekten ist die Entwicklung der Gebäudequerschnitte, die man nicht besser als in den Worten des renommierten österreichischen Architekturpublizisten Otto Kapfinger beschreiben kann: »Sie entwerfen Gebäude wie Karosserien, wie kompakte Chassis für leichte Cabriolets, die ihre Sehnen und ihren Knochenbau spüren lassen, die sichtbar auf Sonne und Wetter, auf Stadt und Gelände reagieren können.«
Für ihre kompakten Gehäuse, die zugleich leicht und filigran wirken, entwickeln die Architekten mit Vorliebe Stahltragwerke – in langjähriger befruchtender Zusammenarbeit mit den Tragwerksplanern von werkraum wien. Das Primärtragwerk der Schwimmhalle besteht aus ebenen, geknickten Stahlfachwerkträgern im Abstand von etwas mehr als 10 m, das Dach über der Verteilerzone und dem Wellnesstrakt ist mit Formrohrträgern überspannt. Dem Grundriss des Gebäudes folgend variieren die Trägerspannweiten zwischen 40 m in der großen Halle und 10 m an seinem schmalen Ende, das mit einer Außensauna und dem Zugang zu den Tauchbecken im Saunagarten markiert ist. Straßenseitig lagern die Fachwerkträger auf stählernen Zweibeinen auf, während das Dach an der Gartenfassade, die sich nach Süden hin weit aufspreizt, von Pendelstützen getragen wird, die in ihrer Neigung dem Verlauf der Glasfront folgen. Die große Auskragung des Dachs ist nicht nur Schutz vor der hochstehenden Sommersonne, sie wirkt auch günstig auf das Verformungsverhalten der Struktur. Gedämmte Sandwichelemente zwischen den Trägern mit innen liegenden Rippen als Verstärkung und der für den Transport optimierten Breite von 290 cm bilden nicht nur die innere Schicht der Gebäudehülle, sondern wirken als konstruktiv aussteifende Scheiben.
Leichtigkeit und Farbe
In der Schwimmhalle und im Spa ist die weiß lasierte Dachuntersicht der modularen Elemente je nach Standort durch untergehängte Membranpaneele verdeckt, die – rautenförmig geknickt und mikroperforiert – nicht nur akustisch wirksam sind, sondern auch ein plastisches Bild ergeben. Über variantenreiche farbige Hinterleuchtung können so abends in der Halle abseits der Askese des Wettkampfs stimmungsvolle Szenarien erzeugt werden, die den sportlichen Aspekt des Schwimmens in den Hintergrund treten lassen. Darüber hinaus ist Farbe in der Möblierung der Schwimmhalle nur akzentuierend eingesetzt: bunte Sitzpolster auf der dunklen Tribüne, ein eigens entworfenes, gegossenes Sitz- und Liegemöbel und der Ton des Wassers im Stahlbecken sind Farbtupfer im sonst dominierenden strahlenden Weiß. Kleine Eingriffe wie die Beheizbarkeit der Tribünenstufen, die dadurch als Liegeflächen genutzt werden können, steigern den Komfort.
Der Wellnessbereich ist als organisch geformte offene Raumsequenz für 180 Personen ausgelegt. Trotz seiner beeindruckenden Größe sorgt die differenzierte Gestaltung der verschiedenen Bereiche von Aktivität
und Ruhe, von der Garderobe bis zur Außensauna, für die jeweils angemessene Atmosphäre und erweist sich tagsüber als ungewöhnlich lichtdurchflutet. Er wird beidseitig und von oben belichtet: partiell von der Straßenseite, wo stabförmig gedämmte Glaspaneele Einblicke verhindern, und von der verglasten Parkseite, wo der gut angenommenen Saunagarten durch eine Hecke und ein Höhensprung im Gelände vor Blicken aus dem Freibad geschützt ist. An dieser Wohlfühloase mit ihrer Abfolge von unterschiedlichen Becken, Saunen, Tepidarien, Liegeflächen und der ins Raumvolumen eingehängten Ruhezone zeigt sich die Leidenschaft der Architekten besonders gut, spannenden, vielgestaltig und abwechslungsreich modellierten Raum zu schaffen. Das Anthrazitgrau des Steinzeugbodens ist eine kluge, unverzichtbare Wahl. Es findet auch Verwendung an der Deckenuntersicht der niedrigeren Zone und der Oberfläche der Feuergrotte, die vom Innenbecken aus erkundet werden kann, und bildet die Klammer, die den überbordenden Farb-, Form- und Materialeindruck des ersten Blicks bändigt und Ruhe und Einheit zu vermitteln vermag.
Es wäre ein Missverständnis, aus den ungewöhnlichen Raumfiguren von fasch&fuchs.architekten abzuleiten, dass es ihre Intention ist, einen unverwechselbaren Personalstil zu kreieren oder in jedem Fall originell sein zu wollen. Wer ihre Bauten näherer Betrachtung unterzieht, wird erkennen, dass jedem Konzept die genaue Kenntnis und Analyse des Orts vorangeht. Dass geforderte Funktionen zwar streng hinterfragt und unorthodox interpretiert werden, aber Funktionalität immer ein wichtiger Parameter des Entwurfs bleibt. Mit dem erfreulichen Effekt, dass Bauherr und Auftraggeber des Grazer Bads mit sichtbarem Stolz und ohne Einschränkung von einem rundum gelungenen Bauwerk mit sehr guten Besucherzahlen sprechen, das mittels effizientem Haustechnik- und Energiekonzept im Betrieb kostensparender als das alte, kleinere Bad sein kann.db, Do., 2013.02.28
28. Februar 2013 Karin Tschavgova
Baden auf dem Berg
(SUBTITLE) Mineralbad und Spa in Rigi-Kaltbad (CH)
Mario Bottas Mineralbad soll zukünftig als wichtiger Anziehungspunkt auf dem wohl berühmtesten Aussichtsberg der Schweiz dienen. Der Anlage ist es aber nur bedingt gelungen, dem Ort atmosphärisch gerecht zu werden – ganz abgesehen davon, dass die Ausblicke aus dem Innern des Bads eher enttäuschen.
Seit dem 19. Jahrhundert zählt der Ausflug auf den Rigi zum klassischen Programm eines jeden Schweiz-Touristen. Zwischen Vierwaldstätter- und Zugersee gelegen, ist das Bergmassiv gut zu erreichen; zwei Zahnradbahnen sowie Luftseilbahnen garantieren die bequeme Erschließung. Der höchste Gipfel, Rigi-Kulm, ist lediglich 1 797,5 m hoch – doch dank der »Insellage«vor den eigentlichen Alpen eröffnet sich den Besuchern ein fantastisches Panorama, das die Alpen mit ihren Viertausendern ebenso einschließt wie die Voralpenregion. Kein Wunder, dass das Bergmassiv des Rigi, das in Teilen je dem Kanton Schwyz und dem Kanton Luzern zugehört, zum Inbegriff des Aussichtsbergs und nachgerade zu einem nationalen Mythos geworden ist.
Wandel des Tourismus'
Kaum irgendwo so deutlich wie hier indes offenbart sich der stete Wandel der touristischen Bedürfnisse. Heute besuchen den Rigi 600 000 Besucher jährlich, eine zunächst imponierende Zahl. Der Großteil davon sind allerdings Tagestouristen, und so gibt es lediglich 300 Gästebetten hier oben – im Gegensatz zu mehr als 2 000, welche für die Zeit um 1900 belegt sind, als die Besucher noch länger auf dem Berg weilten. Begünstigt durch die Dampfschiffverbindung über den Vierwaldstätter See nach Luzern hatte im 19. Jahrhundert der Besucherverkehr begonnen, der nach der Eröffnung der Zahnradbahnen von Vitznau (1871) und Arth-Goldau (1875) in die Höhe schnellte. Die einst bescheidenen Herbergen auf dem Rigi wurden entweder großzügig erweitert oder durch luxuriöse Grand Hotels ersetzt. Der Boom des Rigi-Tourismus' endete mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs schlagartig, und aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage gelang es in den Folgejahrzehnten nicht, an die goldenen Vorkriegsjahre anzuknüpfen. So hatte der Schweizer Heimatschutz, dem die Luxushotels als deplatzierte, städtische Importarchitektur seit jeher ein Dorn im Auge waren, nach dem Zweiten Weltkrieg Erfolg mit seiner Initiative, den Rigi zu »bereinigen«; einzig das seit Mitte des 19. Jahrhunderts mehrfach erweiterte Hotel Bellevue auf dem 1 450 m hohen Bergsattel in Rigi-Kaltbad blieb von der Abrisswelle verschont, fiel jedoch 1961 einer Brandstiftung zum Opfer. In der Hochkonjunkturphase der 60er Jahre begann in Kaltbad, das inzwischen zu einer bevorzugten Ferienhausdestination avanciert war, nach Plänen des Architekten Justus Dahinden der Neubau einer Anlage, die man heute als Resort bezeichnen würde: ein um eine Platzanlage gruppierter Hotelkomplex mit Hallenbad, Sportbereichen und Ferienwohnungen, realisiert als Sichtbetonkonstruktion unter expressiv geschichteten dunklen Eternitdächern. Die sogenannte Hostellerie auf dem Rigi kam jedoch nicht in Schwung und wurde zum dauerhaften Problemfall.
Nach weiteren vergeblichen Anläufen entwickelte schließlich 2004 der Bauunternehmer Peter Wüest in Absprache mit den Besitzern des schwächelnden Resorts ein ehrgeiziges Konzept, Rigi-Kaltbad wieder zu einem touristischen Hotspot auf dem Rigi werden zu lassen. Dieses basierte auf drei Bausteinen: der Sanierung der nunmehr als »Hotel Rigi-Kaltbad« firmierenden Resorts, einem Neubau mit Ferienwohnungen am früheren Standort des Bellevue – und einem der Öffentlichkeit zugänglichen Bergbad unter dem »Dorfplatz« der Anlage. Der Auftrag zu dem Bad wurde Mario Botta erteilt, der zu dieser Zeit gerade das Grand Hotel Tschuggen in Arosa durch die »Bergoase«, das mit 30 Mio. CHF (ca. 24 Mio.Euro) teuerste Spa der Schweiz, erweiterte.
Die Gemeinde Weggis, die den Dorfplatz erworben hatte, stellte zwar Mittel für dessen Neuanlage auf dem Botta-Bau zur Verfügung, doch durch den Rückzug des Generalunternehmers drohte auch dem neuen Projekt das Scheitern. Erst nach einer Redimensionierung sowie des Hinzuziehens der Badbetreiber von »Aqua-Spa-Resorts« und der MLG Generalunternehmung aus Bern sowie des Unternehmers Rolf Kasper bog das Vorhaben auf die Zielgerade ein.
Vom Kaltbad zum Warmbad
Baden auf Rigi-Kaltbad hat, worauf der Ortsname hindeutet, eine lange Tradition. Seit dem 16. Jahrhundert war die hinter dem Resortgebäude entspringende Quelle als heilkräftig bekannt; die erste Kapelle entstand zwischen den Felsen, die um 1800 durch einen heute noch bestehenden Neubau ersetzt wurde. Tauchten die frühen Pilger in freier Natur im kalten Wasser unter, so integrierte man im Hotelbau des frühen 19. Jahrhunderts Badezellen. An diese Tradition will das »Mineralbad & Spa Rigi-Kaltbad« anknüpfen, wobei das Quellwasser im Wellness-Zeitalter auf angenehme 35 °C erwärmt wird. Im Kern handelt es sich bei Bottas Projekt um eine boxartige, in den Hang eingelassene Stahlbeton-Struktur, die entweder vom Dorfplatz auf dem Dach über einen zylindrischen Treppenturm oder direkt vom UG des Hotels aus erschlossen wird. Von der Kasse mit Café aus gelangt man über die Garderobe und die Duschen in den Hauptraum des Bads mit einem 30 m langen Becken, das sich bergseitig in vier halbkreisförmigen Becken mit diversen Sprudelanwendungen fortsetzt. Ähnliche Raumnischen flankieren auch die östliche Stirnseite des Bads, an der das Becken knickt und sich in einem Freibereich fortsetzt. Licht erhält das Innere durch die als »Kristalle« den Dorfplatz rhythmisierenden Oberlichter sowie die vollständig verglaste und mit horizontalen Steinlamellen über einer Stahlunterkonstruktion versehene Südfassade. Eine zweite Treppenspindel führt hinunter zum Kräuterdampfbad mit Ruheraum, der – um den »Ort der Ruhe und Entspannnung« nicht zu stören – erst ab dem Alter von 16 Jahren zugänglich ist. Während sich in der Sauna der gestalterische Anspruch eher bescheiden zeigt, beeindruckt das grottenartige Kristallbad mit seinem Deckenhimmel aus blauem Stucco Lucido und dem hohen zentralen Lichtschacht.
Für Mineralbäder gibt es in der Schweiz eine unschlagbare Referenz: die Therme Vals von Peter Zumthor. Obwohl konzeptionelle Ähnlichkeiten bestehen (entlegener Ort in den Bergen, Einbettung in den Hang, Revitalisierung eines Hotekomplexes) gelingt es Botta nicht annähernd, eine vergleichbare atmosphärische Dichte zu erzielen. So wird der transitorische Bereich der Umkleiden nicht zu einem spannungsvollen Prolog, an dem man das tägliche Leben hinter sich lässt und in eine andere Welt eintaucht, sondern offenbart die Atmosphäre eines Hallenbads der 70er Jahre – wenn auch mit perfekt schweizerisch verarbeiteten Materialien. Auch die aus akustischen Gründen installierte Decke aus Ahornlamellen im Hauptgeschoss des Bads will schlicht nicht zur Monumentalität des Steins passen.
Aber auch die Verwendung des Steins selbst ist problematisch. Das neue Bad auf dem Rigi will den Stein inszenieren, so wurde das Äußere mit gespaltenen, das Innere mit polierten oder sandgestrahlten Platten bekleidet. Der Stein hat aber mit dem Ort nichts zu tun: Weil der Rigi aus dem Konglomeratgestein Nagelfluh besteht, das als Baumaterial völlig ungeeignet ist, wählte Botta einen hellgrauen Granit, der aus der Nähe von Domodossola auf der Südseite des Simplon stammt; 500 t davon wurden über die Zahnradbahn nach Rigi-Kaltbad gebracht. Das ist für ein »Felsenbad« auf dem Rigi, welches die archaische Kraft des Bergs inszenieren will, zumindest fragwürdig.
Immerhin stammt das Wasser aus der historischen Quelle – und für die Stückholzheizung wird das Holz des Bergmassivs genutzt; bei Spitzenbedarf können überdies Pellets zugeführt werden.
Und noch ein weiterer Faktor mindert den Genuss: der mangelnde Ausblick. Beeindruckende Blicke auf die Umgebung bieten sich nur vom Außenschwimmbecken oder vom Dorfplatz aus. Nach Süden wird der Ausblick ansonsten von der Rückseite des zusammen mit dem Resort entstandenen Terrassenwohnriegels verstellt, sodass man aus den Ruheräumen in einen wenig inspirierenden Zwischenbereich blickt und das Alpenpanorama mehr ahnt denn sieht.
So hinterlässt der Neubau des Bades einen ambivalenten Eindruck. Damit das Bad die Gewinnzone erreicht, werden 100 000 Besucher pro Jahr bei einem Eintrittspreis von 35 CFH (ohne Zeitbegrenzung) benötigt. Ob das gelingt, wird die Zukunft zeigen; ambitioniert ist es allemal.db, Do., 2013.02.28
28. Februar 2013 Hubertus Adam
Zeitgemässer Bäderwechsel
(SUBTITLE) Hamam im Volkshaus in Zürich (CH)
Ein Bad im Wandel: Nach 100 Jahren als Wannen- und Duschbad für die einfachen Leute des Quartiers, eröffnete 2012 die zum Hamam umgebaute Bäderabteilung des Volkshauses in Zürich. Die neue Gestaltung vereint Unverwechselbarkeit mit einer dem Ort angemessenen Robustheit.
1906 fand in Zürich eine Volksabstimmung statt: Zur Debatte stand neben dem Bau des Kunsthauses am reichen Zürichberg auch die Realisierung eines Volkshauses im Arbeiterviertel Aussersihl. Die Vorlage wurde angenommen, die Einweihung des Volkshauses erfolgte am 18. Dezember 1910. Der Bau von Johann Rudolf Streiff und Gottfried Schindler im Schweizer-Heimatschutz-Stil bündelte eine Reihe von Funktionen: ein alkoholfreies Restaurant, Bibliotheken, Büros, Veranstaltungssäle und eine öffentliche Bäderabteilung.
Bei den Bewohnern des Quartiers war das Volkshaus v. a. wegen des Bads im UG beliebt, da zu dieser Zeit kaum eine Wohnung des Viertels mit fließend Wasser ausgestattet war. Mit dem Bau konnte das wöchentliche Bad nun in einer der 29 Badewannen oder der 20 Duschen vorgenommen werden – strikt nach Geschlechtern getrennt und zu moderaten Preisen. Mit durchschnittlich 450 Besuchern pro Tag lief der Betrieb anfänglich so gut, dass sich damit die übrigen Aktivitäten des Volkshauses quersubventionieren ließen.
Mit der Ausstattung der Wohnungen mit Nasszellen begann der Niedergang der Bäderabteilung. In den 60er Jahren betrugen die Besucherzahlen nur noch ein Drittel der Anfangszeit, sodass 1968 der Teilumbau zur finnischen Sauna erfolgte.
Mit dem 2001 vom Züricher Stadtrat bewilligten Programm zur Aufwertung Aussersihls veränderte sich die Bevölkerungsstruktur: Statt Gastarbeitern und Rotlichtmilieu zogen Studenten und junge Familien in das Viertel. 2008 wurde das Restaurant im denkmalgeschützten Volkshaus umgebaut und auch für die Bäderabteilung fand sich eine Lösung: Der Züricher Architekt Tobias Rihs, Betreiber des Seebads Enge am Zürichsee, mietete sich 2010 im UG ein und ließ es zu einem türkischen Dampfbad umbauen – einem der ersten der Stadt.
Spielerisch und erdenschwer
Den rund 3,5 Mio. CHF (ca. 2,8 Mio. Euro) teuren Umbau realisierte das Züricher Büro Felder Architektur. Es schuf die zeitgemäße Interpretation eines klassisch türkischen Dampfbads. Dieser Badetyp – als Weiterentwicklung des im Byzantinischen Reich verbreiteten griechisch-römischen Bads – ist für die Ganzkörperreinigung gedacht, bedient sich jedoch keiner Badebecken, sondern Dampfkammern und fließenden Wassers – bedingt durch den in der Region herrschenden Wassermangel.
Über die bestehende Erschließung innerhalb des Volkshauses führt der Weg in das 450 m² große Bad zur Eingangszone mit Kasse. In der angrenzenden Garderobe entledigen sich die Besucher ihrer Kleidung und wickeln sich in ein Leinentuch, das Pestemal, das nur für die eigentliche Reinigung kurz abgenommen wird. Der weiterführende Raum erschließt zwei Behandlungsräume für Beauty-Anwendungen, den Ruhebereich und den Nassbereich. In ihm empfängt die Besucher zunächst ein Trinkbrunnen, dann öffnet sich der zentrale Raum mit einem amorphen 7,5 x 3 m großen kniehohen beheizten Podest in der Mitte. Um diesen »Nabelstein« sind das Dampfbad (zur Öffnung der Poren) sowie Nischen mit Waschstellen (für Peelings) und Liegen (für Massagen) angeordnet.
Ein Spiel zwischen Intimität und Öffentlichkeit inszenieren die an Maschrabiyya (dekorative arabische Holzgitter) erinnernden Beton-Gitterwerke, die die Reinigungsnischen vom Hauptraum abschirmen. Wie Schleier aus Beton zeigen und verstecken die Elemente gleichzeitig, was sich in ihrem Schutz abspielt. Die Massivität des Materials – geschliffen wie bei Brunnen und Nabelstein oder roh wie bei den Elementen der Gitter – passt in die unterirdischen Räume, ihre Robustheit erinnert an den Massenbetrieb der ehemaligen Bäderabteilung. Gleichzeitig lässt sie eine edle Form des Alterns zu: Die Oberflächen zeigen Spuren, keine Mängel.
Die Setzung der bis zu 2,25 m langen Gitterelemente erinnert an einen Blockbau: Die wogenden Wellenberge und -täler bestehen aus 250 Einzelteilen aus über 90 verschiedenen Typen. Verbunden sind die einzelnen Schichten mit Montagekleber. Holzregale, auf denen kleine Gegenstände abgelegt werden können, sind zwischen den Betonelementen durchgeschoben und von hinten verkeilt. Für Licht im Hauptraum sorgen überraschend formschöne Leuchten aus dem Untertagebau, die einen zusammen mit Schläuchen und Hebeln von Duschen und Armaturen im Bauch eines Schiffs wähnen lassen.
Die sorgfältige Gestaltung der Installationen und Becken offenbart die Freude der Architekten am Umgang mit dem Thema Wasser: Alle Wasserleitungen sind offen verlegt, die Armaturen stammen teils aus dem Gartenbau. Mischbatterien gibt es keine, stattdessen wird die Herstellung der passenden Wassertemperatur zur manuellen Fertigkeit. Waschbecken aus Keramik bedienen den Spieltrieb: So fließt das über einen Kippstöpsel abgelassene Wasser durch ein Rohr in der beheizten Sitzbank und, statt spurlos zu verschwinden, ergießt es sich zu Füßen des Besuchers.
Eine finnische Sauna mit Tauchbecken ergänzt die Nutzungen des Nassbereichs – eine Reverenz an die Vergangenheit und ein Zugeständnis an die Rentabilität. Nach einer Pause auf dem Nabelstein wechseln die Besucher in den Ruhebereich, um den Kreislauf mittels Getränken und kleinen Mahlzeiten wieder in Schwung zu bringen. Während im Nassbereich mineralische Materialien vorherrschen, zeichnen sich Behandlungsräume und Ruhezonen durch wertige Holzeinbauten aus. Die wie Perlmutt schimmernde Sisaltapete im Bereich der Ruheliegen reflektiert das Licht; dimmbare Leseleuchten laden zum stundenlangen Verweilen ein.
Die im gesamten Bad platzierte Kunst, darunter eine Wandmalerei von Eric Schumacher und eine Plattenarbeit von Noël Fischer, sorgt dafür, dass neben dem Leib auch Auge und Geist belebt werden.
Feuchtigkeit innen und aussen
Um den neuen Grundriss unterzubringen, bedurfte es keinerlei Eingriffe am bestehenden Tragwerk. Der Einbau der Gebäudetechnik hingegen war aufwendig: Das marode Entwässerungssystem wurde ersetzt und das Hamam mit einer neuen Lüftung ausgestattet. Heizungs-, Elektro- und Sanitärinstallationen konnten dagegen an die bestehenden Leitungen des Volkshauses angedockt werden. Eine 12 cm Innendämmung aus Schaumglas verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich ins Gebäude dringt – Messungen ergaben, dass nicht etwa die Feuchtigkeit im Innern zum Problem für die bis zu 1 m dicken Mauern aus Stampfbeton werden könnte, sondern eindringendes Grundwasser. Zudem wird die Luftfeuchtigkeit von 45 % kontinuierlich überwacht, um die originale Rippendecke mit ihrer minimalen Betonüberdeckung nicht zu gefährden.
100 Jahre nach Eröffnung des Volkshauses sind auch in Zürich Aussersihl die Arbeiter den Szenegängern gewichen – statt 20 Minuten Duschen ist heute stundenlanges Schwitzen gefragt. Die Architekten reagierten mit einer Gestaltung, die zum Ort und seiner Geschichte passt und dem Bad ein unverwechselbares Gesicht gibt: Die Raumaufteilung orientiert sich an der eines traditionellen Hamams, die Materialien sind robust und in ihrer Ausführung gleichzeitig edel, die Details oft überraschend. Ob dem Hamam eine ähnliche Entwicklung bevorsteht wie der Bäderabteilung? 15 Monate nach seiner Eröffnung läuft der Betrieb gut. Und auch, wenn das Bad heute von deutlich weniger Menschen frequentiert wird als die Bäderabteilung von 1910, dürfte die Anpassung des Eintrittspreises doch für vergleichbaren Umsatz sorgen.db, Do., 2013.02.28
28. Februar 2013 Tina Cieslik