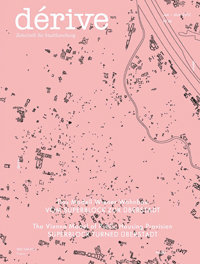Editorial
Sozialpolitik und Wohnbau sind in Österreichs Hauptstadt seit den Zeiten des Roten Wien ab den 1920er Jahren eng miteinander verknüpft. Während in vielen anderen europäischen Städten der kommunale Besitz an Wohnbauten in den letzten Jahrzehnten auf den Markt geworfen wurde, verfügt die Stadt Wien mit rund 220.000 Wohnungen nach wie vor über einen beträchtlichen Immobilienbestand und hat darüber hinaus Einfluss auf die Vergabe von Wohnungen, die von gemeinnützigen Bauträgern errichtet werden. Insgesamt kontrolliert die Stadt Wien somit direkt oder indirekt rund 50 Prozent des Wohnungsmarktes. In Berlin bedauert die SPD heute beispielsweise sehr, dass in den Jahren 2000/2001 wegen angeblichen Kapitalbedarfs viele Wohnungen aus kommunalem Besitz (sehr günstig) vom damaligen Finanzsenator Thilo Sarazzin verkauft worden sind und damit ein wichtiges sozialpolitisches Lenkungsinstrument abhanden gekommen ist.
Die erfreuliche Situation in Wien führt zwar dazu, dass die Kosten für Wohnraum im internationalen Vergleich nach wie vor relativ günstig sind, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch dieserorts problematische Entwicklungen gibt. Diese rühren unter anderem daher, dass die Stadt selbst keine Wohnungen mehr baut (der letzte Gemeindebau wurde 2004 errichtet) und die Anzahl der sehr günstigen Substandardwohnungen in der so genannten Kategorie D aufgrund reger Sanierungstätigkeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten nahezu vollständig vom Markt verschwunden sind.
Die von gemeinnützigen Bauträgern errichteten Genossenschaftswohnungen werden zu einen bestimmten Prozentsatz von der kommunalen Einrichtung »Wiener Wohnen« vergeben und sind abhängig von der Lage – was die monatlichen Kosten anbelangt – verhältnismäßig günstig. Zur Miete kommen jedoch notwendige Eigenmittel in Form von Baukostenzuschüssen, die für sozial schwache MieterInnen meist nur schwer zu finanzieren sind. Relativ günstig wohnt in Wien nach wie vor wer langfristig planen kann, auf zentrale Lage nicht allzu viel Wert legt und über einen gewissen Grad an Eigenmittel verfügt. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, kann Wohnen auch in Wien sehr teuer werden. Die Anzahl der befristeten Mietverhältnisse nimmt kontinuierlich zu und ein häufiger Wohnungswechsel ist aufgrund des auch hierzulande ansteigenden Interesses an Immobilien mit laufenden Mietsprüngen nach oben verknüpft.
Die Folgen dieser Entwicklung sind eine steigende Anzahl von Delogierungen mit derzeit rund 4.000 Fällen pro Jahr oder rund 12.000 betroffenen Personen und Protestaktionen auch in Form von Hausbesetzungen. Um die Anzahl der Delogierungen künftig wieder zu verringern, kündigte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig jüngst ein so genanntes Wohnungssicherungsgesetz an. Wie dieses Gesetz im Detail aussehen soll, ist (noch) nicht bekannt.
Es geht im Schwerpunkt dieser Ausgabe von dérive also um Wohnbau, genauer gesagt um sozialen Wohnbau in Wien. Verantwortlich dafür zeichnet ein Forschungsteam um Andreas Rumpfhuber, der für dérive zuletzt das Schwerpunktheft Arbeit Leben (dérive 34) redaktionell gestaltet hat. Entstanden sind die Ergebnisse zum Modell Wiener Wohnbau im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts SCIBE – Scarcity and Creativity in the Built Environment, das von Jeremy Till geleitet wird.
Michael Klein hat für den Schwerpunkt einen historischen Abriss über den sozialen Wohnbau in Wien erstellt. Georg Kolmayr hat sich die mediale Berichterstattung zur Wohnbaupolitik und die diesbezügliche Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wien angesehen. Andreas Rumpfhuber untersucht in seinem Beitrag »Vienna’s Housing Apparatus and Its Contemporary Challenges: Superblock turned Überstadt« das Konzept der Stadt Wien im Detail und nimmt Alternativen wie etwa Baugruppen unter die Lupe. Das Forschungsteam hat auch zahlreiche in die Materie involvierte Personen interviewt und deren Statements in einem Beitrag zusammengefasst sowie ein sehr nützliches Glossar zum Modell Wiener Wohnbau zusammengestellt. Mehr Informationen zum Schwerpunkt gibt es im einleitenden Text von Andreas Rumpfhuber zu lesen. Alle Texte des Schwerpunkts sind übrigens in englischer Sprache, einen kurzen Einblick bietet das deutschsprachige Abstract zu jedem Artikel.
Florian Huber macht sich im Magazinteil über den gegenwärtigen Stand der Gentrifizierungsdebatte Gedanken und exemplifiziert diese an einem der Wiener Paradebeispiele, dem Leopoldstädter Karmelitermarkt. Manfred Russo hat einen Nachruf auf den Stadtsoziologen Hartmut Häußermann verfasst, der nach schwerer Krankheit am 31. Oktober verstorben ist. Häußermann ist für einige Standardwerke der deutschsprachigen Stadtsoziologie verantwortlich, die er meist gemeinsam mit Walter Siebel verfasst hat. Für dérive verfasste Hartmut Häußermann bereits in Heft 17 einen Artikel über postmoderne Stadterneuerung und blieb dem Magazin seither verbunden.
Den Abschluss bildet wie immer Manfred Russos Serie zur Geschichte der Urbanität. Die New York Teile sind abgeschlossen, nun beginnt eine Folge zum Thema postmoderne Stadt. Das Kunstinsert in der Mitte des Heftes stammt diesmal von Sonia Leimer, mehr dazu von den KuratorInnen Paul Rajakovics und Barbara Holub auf Seite 37. Mir bleibt ein gutes neues Jahr zu wünschen und darüber zu informieren, dass wir mit unserem Headquarter übersiedeln und ab 2012 in der Mayergasse 5/12 in Wien Leopoldstadt residieren werden. Es gibt viel Raum und viele Ideen – mehr dazu dann im nächsten Jahr!
Christoph Laimer