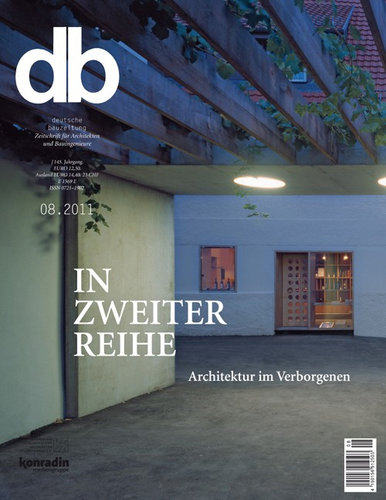Editorial
Die nachträgliche Verdichtung vorhandener Siedlungen oder die Ergänzung bestehender Gebäude zählt zu den wichtigsten Bauaufgaben demografisch stagnierender Gesellschaften. Mit vorhandenen Bauten und Flächen sensibel umzugehen und zugleich einen erkennbar zeitgenössischen architektonischen Beitrag zu leisten, ist Herausforderung und Chance zugleich, etwa bei Hofbebauungen:
Da der Hof nicht die Schauseite eines Ensembles ist, können Architekten dort trotz räumlicher Enge relativ frei von Gestaltvorgaben agieren. So überraschen die Neubauten in zweiter Reihe oft durch ihre eigenwilligen, innovativen Ansätze, die es wert sind, entdeckt und publik gemacht zu werden. In dieser Ausgabe der db daher aus dem Verborgenen geholt und der Architekturkritik gestellt: ein Ratssaal, ein Wirtschaftsgebäude, eine Reihenhaussiedlung, eine Wohnhausaufstockung, ein Weingut und eine in die Jahre gekommene Mehrzweckhalle. | Christine Fritzenwallner
Schmuckstück im Verborgenen
(SUBTITLE) Rathauserweiterung in Landsberg am Lech
Einst kaum mehr als eine unbedeutende Hinterhofseite, bietet die Rückseite des barocken Rathauses in Landsberg durch den Erweiterungsbau heute eine zweite Schaufassade. Ergebnis ist ein stimmiges Ensemble, bei dem sich selbstbewusste zeitgenössische Architektur und feinfühliges Einfügen in den Bestand an keiner Stelle widersprechen.
Mit einer reich verzierten Stuckfassade und großen Fensterformaten präsentiert sich das zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Dominikus Zimmermann erbaute Rathaus als prächtigstes Gebäude am Hauptplatz. Während die Stadtverwaltung bereits vor gut 70 Jahren in andere Gebäude ausgelagert wurde, verblieben hier einige repräsentative öffentliche Nutzungen. Im EG informiert das Fremdenverkehrsamt über Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen, in den drei OGs liegen einige prunkvoll mit dunklem Holz und Wandmalereien ausgestattete Räume: ein Trauungszimmer, der historische Sitzungssaal und der große Festsaal.
Um dieses Gebäude noch enger mit dem politisch-kulturellen Leben Landsbergs zu verknüpfen und den Standort zwischen Altstadt und Fluss zu stärken, initiierte die Stadt einen Architektenwettbewerb. Wichtiges Ziel war die Schaffung eines großen, modern ausgestatteten Sitzungssaals, zugleich sollten aber auch eklatante funktionale Mängel im Bestandsgebäude beseitigt werden – beispielsweise gab es bisher kaum Pausenflächen und Nebenräume etwa für Catering oder Garderoben; Aufzüge und öffentliche Toiletten fehlten ebenso wie eine barrierefreie Erschließung.
Ouvertüre für eine kraftvolle Architekturkomposition
Da der denkmalgeschützte Altbau keinerlei räumliches Potenzial für derlei Umstrukturierungsmaßnahmen aufwies, sah die Auslobung einen Erweiterungsbau im Innenhof vor. Die Architekten konzipierten hierfür ein dezidiert zeitgenössisches Gebäude mit großflächiger Verglasung und kupferner Streckmetallhülle, das mit dem Altbau eine bemerkenswerte formale und funktionale Einheit bildet. Vom Hauptplatz aus ist davon allerdings kaum etwas zu sehen. Den einzigen Hinweis auf das im Hof verborgene Schmuckstück liefern die neuen Glastüren und Fensterläden aus Tombak im EG, hinter denen sich links und rechts der als Hofdurchgang reaktivierten Mittelachse ein direkter Zugang zu den OGs des Altbaus bzw. das neu eingerichtete Fremdenverkehrsamt befinden. Die Anlaufstelle für Touristen bildet mit ihrem lang gestreckten Thekenmöbel und der schlichten Raumgestaltung – weiße Wand- und Deckenflächen, Boden in Weißbeton, Möblierung in dunkler Raucheiche – gleichsam die Ouvertüre für eine kraftvolle Architekturkomposition, von der die Besucher nach Passieren des Durchgangs überrascht werden. Dort erwartet sie nämlich kein düsterer Hinterhof, sondern eine sanft abfallende Passage, die sich zur rückwärtigen Salzgasse und zum Lech schrittweise aufweitet und die von dem sich dynamisch über den Weg schwingenden Neubau begleitet wird. ›
Streckmetall statt Stuck
Trotz des denkbar großen Kontrasts zur reich dekorierten Eingangsfassade und den Gewölbebögen des Durchgangs wirkt das neue Gebäude sofort vertraut und einladend. Das liegt einerseits an der bereits vom Tourismusbüro bekannten Architektur- und Materialsprache, andererseits am hohen Transparenzgrad der Fassade. Diese ist nahezu vollflächig verglast und in den OGs von einer durchgängigen Haut aus schuppenartig versetzten Streckmetall-Elementen aus Kupfer umgeben. Resultat ist eine feingliedrige Gebäudehülle, die den Baukörper durch ihren erdigen Farbton selbstverständlich in die Altstadtsilhouette integriert. Zugleich bietet die durchlässige Haut aber auch einen sehr guten Überblick über die klare Grundrissstruktur. V. a. bei eingeschalteter Innenbeleuchtung ist daher bereits lange vor Betreten des Neubaus erkennbar, dass der neue Sitzungssaal erhaben in den Innenhof auskragt, während der unmittelbar an einen Seitenflügel des alten Rathauses anschließende, konkav geschwungene Verbindungsbau neben der neuen Vertikalerschließung mit Aufzug auch die ebenerdig an den Altbau anschließenden Pausenfoyers beherbergt.
Sitzungen mit repräsentativer Würde
Mit seiner vollflächigen Verglasung und den von außen nach innen auf ganzer Länge durchlaufenden Stufen, Bodenbelägen und Deckenbekleidungen verschmelzen das neue Hauptfoyer und die Innenhofpassage zu einer optischen Einheit. Das EG wird als Ausstellungsfläche genutzt, hier befinden sich öffentliche Toiletten, Garderobe, eine Cateringküche und eine als Bar oder Ablage nutzbare Theke. In erster Linie aber dient das Foyer bei Veranstaltungen in den historischen Räumen oder im Sitzungssaal als zentraler Empfangs- und Verteilerbereich.
Über eine Treppe bzw. über den Aufzug erreichen Besucher das Pausenfoyer des 1. OG, von dem aus der Altbau wie auch der neue Sitzungssaal zugänglich sind. Dass dieser überwiegend für Stadtratsitzungen, durch einfache Demontage der festen Tischreihen aber häufig auch für andere Veranstaltungen genutzte Raum die gleiche repräsentative Würde aufweist wie der historische Sitzungssaal, hat v. a. zwei Gründe: Wesentlich ist zum einen die zurückhaltend elegante Auskleidung von Wänden, Boden und Decke mit dunkler Raucheiche, hinter der sich nicht nur einige technische Finessen befinden – vom versenkbaren Beamer über eine Verdunklungsanlage bis hin zur Live-Übertragungsmöglichkeit ins Foyer –, sondern auch eine Vollklimatisierung. Sie wird wegen der Verschattung durch ein hohes Nachbargebäude im Süden allerdings nur selten gebraucht. Für eine gewisse Noblesse sorgen zum anderen aber auch die erhöhte Lage und der Blick durch die schützende Streckmetall-Filterschicht auf die Dächer der Altstadt. Der durch Abrücken der Metallfassade entstehende Zwischenraum erzeugt dabei nicht nur eine angenehm plastische Innen- und Außenwirkung, hier verläuft auch ein Gitterroststeg, der sich zur Gebäudereinigung ebenso eignet wie als zweiter Rettungsweg – aufgrund ihrer hohen Stabilität dient die Metallfassade gleichzeitig als Absturzsicherung.
Eine heute unsichtbare, konstruktive Besonderheit bietet die weit auskragende Beton-Geschossdecke zwischen EG und Sitzungssaal. Da eine gewöhnliche Flachdecke mit der erforderlichen statischen Höhe von 50 cm wegen des hohen Eigengewichts nicht nur zu unerwünschten Durchbiegungen, sondern auch zu einer weit weniger luftigen Bauweise im EG geführt hätte, wurden in die Schalung rund 30 cm große Kunststoffkugeln integriert. Sie reduzieren das Gewicht der Decke erheblich, ohne deren Tragwirkung zu beeinträchtigen. Ebenfalls aus Gründen der Gewichtsersparnis wurde die Geschossdecke über dem Sitzungssaal als Elementdecke mit Beton-Hohldielen ausgeführt.
Respekt und Pragmatismus
Über dem Sitzungssaal liegt eine Dachterrasse, die allen Besuchern und Veranstaltungsteilnehmern des Gebäudeensembles offen steht und eine wunderbare Aussicht zum Lech und über die Altstadt eröffnet. Noch mehr Überblick bietet lediglich das oberste Geschoss des Verbindungsbaus – hier liegt auch der Hauptzugang zum bislang ganz ohne Vorraum erschlossenen Festsaal. Beim Blick nach unten auf die zahlreichen Rundwegmöglichkeiten wird klar, wie eng Alt und Neu miteinander verknüpft sind. Deutlich wird aber auch, dass die Hofseite des barocken Altbaus durch die schmale Anbindung zum Neubau hinsichtlich ihrer Wirkung und Belichtung kaum beeinträchtigt wird. Dieser Umstand steht exemplarisch für den sensiblen Umgang der Architekten mit alter und neuer Bausubstanz. Maßgeblich hierfür ist eine Mischung aus gegenseitigem Respekt und gesundem Pragmatismus, bei der sich weder das moderne Neue noch das prunkvolle Alte selbstverliebt in den Vordergrund drängt.
Von dieser Haltung ist in besonderer Weise auch das eigene Büro der Architekten im Schloss Greifenberg in der Nähe des Ammersees gekennzeichnet , wo sie drei Ebenen eines »Zehentstadels« mit minimalen Eingriffen in Arbeitsräume verwandelt haben. Mit viel Gespür für die Authentizität der Gebäudesubstanz entstand dort ein ebenso reversibler und kostengünstiger wie funktionaler und unkonventionell kreativer Umbau, der bei der Planung an der Rathauserweiterung in Landsberg sicherlich inspirierend gewirkt hat.db, Di., 2011.08.09
09. August 2011 Roland Pawlitschko
Die perfekte Nische
(SUBTITLE) Wohnhäuser in Berlin
Unweit der ehemaligen Berliner Mauer versteckt sich im Hof der Strelitzer Straße 53 etwas Beispielhaftes: ein kleiner, leicht gebogener Straßenzug, der sich aus vielen schmalen, unterschiedlich gestalteten Reihenhäusern zusammensetzt und daher äußerst lebendig wirkt. Geschützt durch die vordere Bebauung, bietet er jungen Familien Raum zum Arbeiten und Wohnen und Kindern einen nahezu intimen, ruhigen Außenbereich zum Spielen – noch, denn sobald die dahinterliegende Gedenkstätte der »Berliner Mauer« fertiggestellt ist, könnte es mit der Ruhe vorbei sein.
Fast drei Jahrzehnte lang zerschnitt die Berliner Mauer entlang der Bernauer Straße die Strelitzer Straße, die im Norden im Arbeiterbezirk Wedding beginnt und im Süden vor der St. Elisabeth-Kirche von Karl Friedrich Schinkel endet. Der Mauerfall 1989 führte auch hier zu umfangreicher Restituierung; um 2000 entwickelte ein auswärtiger Eigner bei der Teilung in Parzellen die städtebauliche Form für die außergewöhnliche Bebauung im Hof von Haus Nr. 53.
Das äußerlich unauffällige Vorderhaus ist gleichermaßen Tor und Schutz des rückwärtigen Bauensembles mit den Anschriften Bernauer Straße 5-8 d: 16 Reihenhäuser, die lange südliche Zeile drei-, die kurze nördliche viergeschossig. Die Binnensituation ist trotz des öffentlich zugänglichen Wegs abgeschieden und erinnert der großen Fensteröffnungen wegen an holländische Quartiere. Auf der Nordseite der kurzen Zeile verläuft unmittelbar vor den Hauseingängen der sogenannte Postenweg als Teil der Gedenkstätte »Berliner Mauer«, die nach einem Entwurf der Landschaftsarchitekten Sinai Faust.Schroll.Schwarz kurz vor der Fertigstellung steht.
Doch wie kommt die im Einzelnen individuelle, doch städtebaulich zu einer Einheit verschmelzende Häusergruppe an diesen Ort, der zwischen Hinterhof und vorderster Front oszilliert? Ein ökonomisches Gesetz half, nämlich das Erbbaurecht. Eingeführt 1919, soll es sozial schwächer Gestellten Grundstückserwerb ermöglichen und gleichzeitig Spekulation verhindern, denn der Erbbauberechtigte ist verpflichtet zu bauen. Das Angebot, einmalig 35 000 Euro und (198 mal) jährlich 900 Euro Zinsen pro Parzelle zu zahlen, erforderte keine Finanzierung durch Banken. So bildete sich über Kollegen-, Familien- und Kundenbeziehungen innerhalb kürzester Zeit eine Gruppe von Bauherren, die sich bis auf eine Ausnahme aus der Architektur- und Filmbranche rekrutiert. Das war 2005. Nach langwieriger Abstimmung mit Behörden, deren Monstranzen Berliner Traufhöhe und Erker heißen, waren die Häuser drei Jahre später endlich beziehbar.
Architekt Kai Hansen hat mit sechs Häusern die meisten Einheiten entworfen, drei stammen von XTH-Architekten, die übrigen sieben Häuser sind Einzelentwürfe. Ihren Zusammenhalt verdanken sie einer Gestaltungssatzung, die Höhen, Baulinien und Zulässigkeit von Vorbauten wie etwa Erker regelte. »Unser gemeinsames Anliegen war familienfreundliches Wohnen«, sagt Kai Hansen, und betont »Wir sind aber keine Baugruppe gewesen.« Nur die Errichtung des UG der südlichen Zeile wurde an einen Bauunternehmer vergeben, wie auch die privat zu erstellende Infrastruktur. Bis auf Haus Nr. 6 b, das aus kerngedämmten Betonfertigteilen konstruiert ist, sind die Häuser von Hansen verputzt – mal naturbelassen, mal durchgefärbt – und unterscheiden sich v. a. durch die Platzierung und Größe der Fenster.
Haus Nr. 6: Pure Materialien, introvertierte Räume
Hansens eigenes Haus dient, wie auch die meisten Nachbarhäuser, als Arbeits- und Wohnstätte gleichermaßen. Man betritt es von Norden über einen Steg, der einen Lichtschacht überbrückt. Auf dem schmalen Grundriss werden Funktionen wie Technikraum, Bäder, Küche und die gesamte Erschließung auf halber Breite und etwa zweidrittel Tiefe konzentriert, so dass die Aufenthaltsräume nach Süden die ganze Hausbreite einnehmen. Ein Gästeapartment im UG ist durch eine schmale Eisentreppe unabhängig zugänglich. Im EG liegt das Büro mit dem Besprechungsraum zum Garten, im 1. OG die Schlafräume und darüber der Wohn- und Essbereich. Ihm ist eine große Terrasse vorgelagert, von der aus der Dachgarten erschlossen wird.
Im Innern sind die Oberflächen überwiegend aus unbehandeltem Sichtbeton, weißem Putz, Holz und Naturstein. Im Kontrast zu der sich spröde gebenden Architektur erzeugen diese Materialien eine warme Atmosphäre, ihre Purität verleiht den Räumen trotz der großen Fensteröffnungen einen angenehm introvertierten Charakter.
Im Hinblick auf den sparsamen Umgang mit Energie wurde Hansens Haus als monolithische, hochdämmende Mauerwerkskonstruktion mit Sichtbetondecken aus Halbfertigteilen errichtet. Wie auch bei den übrigen Gebäuden (ausgenommen eines Passivhauses) kommt die für Heizung und Wasser benötigte Wärme aus dem Erdreich, mittels Wärmetauscher wird so auch im Sommer eine passive Kühlung der Innenräume ermöglicht. Ebenso wurden für alle Einheiten Zisternen vorgesehen, in denen Regenwasser gesammelt und zur Gartenbewässerung sowie als Brauchwasser genutzt wird.
Haus Nr. 5 d: Überraschend farbenfrohes Raumkontinuum
Die Lage in der Kurve hat Jens Ludloff und seine Frau Laura schon aus der Geometrie heraus zu spannungsvolleren Räumen angeregt als den unmittelbaren Nachbarn Hansen. Sie haben die Erschließung entlang einer Gebäudewand gelegt und die Funktionen auf die Nordseite konzentriert, wo das Haus am schmalsten ist. Dementsprechend ist hier die Fassade geschlossen, was durch eine homogene Bekleidung aus gebürstetem, durch den Auftrag von Eisenoxyd anthrazitfarbenen Fichtenholz unterstrichen wird, das selbst die Eingangstür überzieht. Konträr dazu ist die Südfassade des Stahlbetonskelettbaus vollständig verglast; die großzügige Öffnung setzt sich bis in den Schacht mit der Außentreppe ins Souterrain fort, wo sich das Büro befindet.
Alle Räume, auch der Wohnraum im obersten Geschoss, öffnen sich dem trapezoiden Grundstück folgend nach Süden, wodurch sie weit und großzügig wirken. Mit Lust an Inszenierung lassen die Ludloffs die Treppe vom EG bis in das 2. OG einläufig durchlaufen und überhöhen den Raum durch zwei Oberlichter aus Betonkanalringen und Farbflächen. Mit der »Treppenpromenade« als auch den Rundungen, einem freistehenden Raumkörper im EG, den eingebauten Möbeln im 2. OG sowie dem Wechsel von Sichtbeton und Holz haben sie Elemente von Le Corbusier spielerisch verarbeitet und damit den großen »Einraum« in ein überraschendes Raumkontinuum gegliedert.
Mehrwert
Die architektonische Qualität des Ensembles an der Bernauer Straße wird beim Blick von den Balkonen der Häuser von Hansen und Ludloff auf das südliche Nachbargrundstück schlagartig deutlich. Für diese konventionellen Gebäude war der Bauantrag, wie Jens Ludloff kopfschüttelnd berichtet, bereits gestellt worden, bevor der Architekt das Grundstück in Augenschein genommen hatte. Derlei Anonymität steht bei den Bauten an der Bernauer Straße die Zuneigung zum Eigenartigen gegenüber: Im Haus 7 b von Jörg Ebers etwa durchdringen Garten, Gebäude und Innenraum einander. Der raffinierte Raumplan ergibt eine sich von unten nach oben schraubende Zimmerfolge, die der Nutzung entsprechend Weite und Enge, Ausblick und Geborgenheit bietet. Oder das von seinen Nachbarn bereits vor der Fertigstellung ob seiner großen Glasflächen schon liebevoll »Aquarium« genannte Haus Nr. 8 b von XTH-Architekten.
Nischendasein auf Zeit
Bald werden Touristen allerdings die angrenzende Gedenkstätte bevölkern und die gegenwärtig überschaubare Intimität des Ensembles mit der urbanen Realität einer Großstadt konfrontieren. Die bislang locker geführte Nachbarschaft wird herausgefordert sein, die Passanten in den bescheidenden gemeinsamen Freiraum, den v. a. die Kinder bespielen, zu integrieren – oder aber die in den intimen Außenraum eindringenden Besucher in ihrer Neugierde zu stoppen.
In »Grundformen der europäischen Stadt« interpretierte der schweizerische Kunsthistoriker Joseph Gantner einst das durch Typisierung der Einzelhäuser geprägte Bath als das »natürliche Empfinden der gebildeten Schicht für Einfachheit«. So lässt sich auch der Typ Stadthaus in dem Ensemble an der Bernauer Straße, anders als die gestalterisch wirren Townhouses auf dem Friedrichswerder, dank pragmatischer und unpathetischer Konzepte neu deuten.
Angesichts steigender Grundstückspreise und mangelnder Bereitschaft zur Erbpacht bleibt die Form des eigenen Hauses ein singulärer Baustein im städtischen Leben, von dem man freilich wünscht, dass er auch in den Geschosswohnungsbau übersetzt wird. In der einst hinten versteckten Nische ist etwas Vorbildliches entstanden, das nach vorne gerückt werden sollte.db, Di., 2011.08.09
09. August 2011 Michael Kasiske
Skulptural im Wirtschaftshof
(SUBTITLE) Wirtschaftsgebäude in Eibenstock
Der Erweiterungsbau für den Forstbezirk Eibenstock geht in Form und Materialität in Distanz zum Bestand, nimmt aber in seiner formalen Zurückhaltung und Bezugnahme zur regionalen Bauweise zugleich einen Dialog mit dem historischen Frontgebäude auf. Und er erinnert an die Natur: Denn trotz kristalliner, skulptural anmutender Formgebung entsprechen Baukörpereinschnitte und Inneres dem Bild eines glattgesägten Holzes, das außen von einer groben Rinde umgeben ist.
Beim Durchfahren des rund 8 000 Einwohner zählenden, sächsischen Eibenstock passiert man bemerkenswert städtische Bauten: Dem ansehnlichen Postamt folgen die neoromanische Hallenkirche und das Jugendstil-Rathaus. In diesen spiegelt sich der im 19. Jahrhundert durch eine außergewöhnliche Stickereiproduktion erreichte Wohlstand wider, der dem kleinen Ort im Westerzgebirge eine anspruchsvolle Architektur sicherte. Heute ist Eibenstock als Ferienregion bekannt und lebt von seiner Landschaft um den Auersberg mit einem Wander- und Wintersportangebot im Naturpark Erzgebirge. Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat entsprechende Bedeutung, was auch im Gebäude der Königlich Sächsischen Oberforstmeisterei von 1860 deutlich wird, das sich in die Reihe markanter Bauten entlang der Hauptstraße einfügt. Der einfache, mit feinen Sandsteinornamenten ausgestattete Bau dient der Verwaltung des 13 Reviere umfassenden Forstbezirks Eibenstock. Vor einigen Jahren wurde er saniert und sein DG für zusätzliche Büroräume ausgebaut. 2007 zeichnete sich die Notwendigkeit einer weiteren Modernisierung ab: Anstelle eines dahinter befindlichen, baufälligen Forstarbeiter-Wohn- und Lagergebäudes sowie einer rückwärtigen Garagenzeile sollte ein zentrales Wirtschaftsgebäude mit Garagen, Lagerräumen und Kühlzelle für erlegtes Wild entstehen. Unabhängig von seiner Lage im Hof und seiner Funktion als Zweckgebäude sollte es den historischen Bestandsbau angemessen ergänzen.
Die jungen Unaufgeregten
Während eines Auswahlverfahrens für die Fahrzeughalle der Zwickauer Hochschule wurde eine Projektleiterin des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) auf die jungen Architekten Silvia Schellenberg und Sebastian Thaut aufmerksam. Beide sind in der Region aufgewachsen und führen seit 2005 unter dem Namen »atelier st« in Leipzig ein Büro. Für das kleine Realisierungsprojekt (814 000 Euro Baukosten) erteilte ihnen das SIB einen Direktauftrag. Schellenberg und Thaut nutzten die Chance und entwickelten nicht nur einen funktionalen Zweckbau in pflegeleicht-dauerhaftem Material, sondern konzipierten aus Aufgabe und Ort eine ausdrucksstarke Ergänzung für die Oberforstmeisterei. Die Kubatur entstand in mehreren Modellstudien, die Freude an der Raumbildung im Kontext des Bestands sowie an der Gestaltung einer skulpturalen Form zeigen. Dabei kam die klimabedingte Vorgabe zu einer geneigten Dachform der Entwurfsintension – inspiriert vom Bild eines auf dem Waldboden liegenden, unregelmäßigen Rindenstücks – entgegen.
Da das Raumprogramm und die innere Organisation der einzelnen Bereiche weitgehend geschlossene Fassaden erfordert, wird der polygonale Baukörper von einer kontinuierlichen Holzschindelhülle umschlossen, die lediglich zwei plastische Einschnitte erhielt. Im Bereich der Garagenzufahrt für die Waldfahrzeuge sowie der Zugänge zu den Lagerräumen und der Wildkühlzelle ist das Volumen eingeschnitten, bewahrt jedoch über weit auskragende Vordächer seine Gesamtform. Früh am Morgen zu Schichtbeginn und nachmittags bei Schichtende verändert sich das Wirtschaftsgebäude, indem die Tore und Türen sich geschäftig öffnen, ansonsten ruht der Bau im Hof.
Den Forstarbeitern bietet die ruppige Schindelstruktur weniger haptische »Holzerfahrung« als einen expressiv-rauen Ausdruck, der ihrer Arbeit im Wald adäquat ist und zugleich eine traditionelle Bauweise des Erzgebirges wiederbelebt. Die Architekten beschäftigten sich mit historischen Schindelkonstruktionen, um aus einer originären Bauweise des Erzgebirges eine neue baukulturelle Identität abzuleiten. Orientierung boten neben einzelnen örtlichen Kirchen und Museen bezeichnenderweise Bauten in der Schweiz, in Vorarlberg sowie Zeichnungen in historischen Lehrbüchern. Die changierende Holzschindelbekleidung wandelt ihren Farbton seit der ersten Bewitterung, indem aus dem Rotbraun des unbehandelten Rot-Zedernholzes sukzessive ein helles Silbergrau wird. Diese Modifikation des Holztons wird den ursprünglichen Kontrast zwischen der hölzernen Außenhülle und den mit silberfarbenen Aluminiumpaneelen bekleideten Einschnitten etwas neutralisieren, so dass das Gebäude im Alterungsprozess eine stärkere farbliche Einheit entwickeln wird.
Der partielle Einsatz von Aluminiumverbundpaneelen erscheint als zeitgenössischer Verweis des Gebäudes. Der Materialwechsel sollte durch äußerste Präzision und Glätte der Metallfassaden akzentuiert werden, daher waren die Garagentore als flächenbündige Falttore geplant. Aus Kostengründen wurde an dieser Stelle leider das minimalistische Konzept verlassen, stattdessen kamen leicht versetzte Schiebetore zum Einsatz. Das exakte Fugenraster und die Integration der Lichttechnik zeigen den hohen Detaillierungsgrad für diesen kleinen Bau. Die Übergänge von Holzhülle zu Aluminiumpaneelen konnten aufgrund der geringen klimatischen Raumanforderungen mit offenen Fugen gelöst werden. Gern hätten die Architekten auch die Traufe in traditioneller Form als Holzrinne mit offenem Auslauf ausgeführt, doch mussten sie den technischen Standards des Bauherrn folgen und eine Blechkastenrinne mit innenliegendem Fallrohr vorsehen, was angesichts der homogenen Schindelhülle befremdlich erscheint. Die Bauleitung übernahmen die Architekten selbst, denn angesichts der scheinbar einfachen Struktur war die exakte Detailausführung besonders wichtig.
Im Innern setzen sich die glatten Oberflächen fort, hier bilden industriell hergestellte Grobspanplatten den Kontrast zu den äußeren handgespaltenen Schindeln. Hinter den OSB-Platten befindet sich die Holzständerkonstruktion des Hallenbaus. Lediglich dessen weit auskragendes Garagendach ist mit Stahlfachwerkträgern ausgeführt, um eine schlankere Konstruktion zu erreichen.
Tradition aus der Ferne
Die Entwurfsintension ist aber auch von der Wiederbelebung regionaler Bau-weisen bestimmt. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die Architekten sich an einen Schindelproduzenten in Oberbayern wenden mussten und der Dachdecker aus dem Nachbarort zur Schulung ins oberbayrische Hammerau fuhr, um sich die handwerkliche Technik wieder anzueignen. Auch das Schindelholz stammt nicht aus der Region, da der heimischen Fichte aufgrund der veränderten Umweltbedingungen nur noch eine Haltbarkeit von etwa 20 Jahren zugesprochen wird, während das in Oberbayern vertriebene Rot-Zedernholz aus Kanada eine bis zu fünfmal längere Lebensdauer haben kann und ihm vergleichbare Qualitäten einer harter Bedachung bescheinigt werden. Die Weiterführung erzgebirgischen Bauens impliziert somit globale Vernetzungen.
Anspruch aus der zweiten Reihe
Das Wirtschaftsgebäude steht als Solitär im Zentrum des Hofs und dehnt sich deutlich über die Baufluchten seines Vorgängerbaus hinaus, so dass es hinter dem Forstamtsgebäude herausschaut und zur Straße selbstbewusst Präsenz zeigt. Der Umgang mit diesem historischen Bestandsbau war in den vergangenen Jahrzehnten von Pragmatismus gekennzeichnet: Beim Eingriff in die ursprünglich klaren Proportionen entstand anstelle von fünf Giebelgauben eine durchgehende Schleppgaube, deren neue Fenster mit aufgemalten Rahmen Sandsteingewände imitieren. Nicht nur in diesem Kontext erscheint es konsequent, quasi aus der zweiten Reihe einen neuen Anspruch an die regionale Baukultur zu formulieren. Der Neubau setzt sich von dem hellverputzten Bestand und den anderen Bauten im Ort ab, der nach drei Stadtbränden Mitte des 19. Jahrhunderts steinern aufgebaut wurde. Mit dem Holzschindelkörper wird aber nicht nur der Verweis auf die Nutzung durch das Forstamt gegeben; gleichermaßen stellt der Bau eine eigenständige und zeitgemäße Erweiterung des Begriffs »Erzgebirgische Holzkunst« dar, der gemeinhin auf die Holzspielwaren der Weihnachtsmärkte reduziert wird.db, Di., 2011.08.09
09. August 2011 Annette Menting