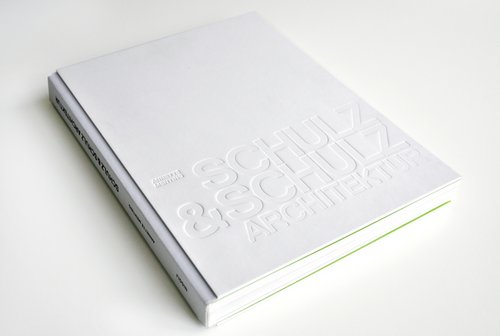Ein Künstler aus Korea erreicht nach einigen Zwischenstationen Amerika, eine kanadische Architektin orientiert sich von Deutschland nach Korea: East goes West — West goes East. In Suwon-Seoul kreuzen sich ihre Wege. Hier realisiert Marina Stankovic ein Museum für den Medienkünstler Nam June Paik.
Ein Künstler aus Korea erreicht nach einigen Zwischenstationen Amerika, eine kanadische Architektin orientiert sich von Deutschland nach Korea: East goes West — West goes East. In Suwon-Seoul kreuzen sich ihre Wege. Hier realisiert Marina Stankovic ein Museum für den Medienkünstler Nam June Paik.
Gegenläufige Bewegungen führen die beiden Nomaden im Herkunftsland Nam June Paiks zusammen. Zu Beginn des Koreakriegs war Paik zunächst nach Japan geflohen, in den sechziger Jahren war er Mitglied der Fluxus-Bewegung in Deutschland und in den Siebzigern wurde er amerikanischer Staatsbürger. Vor einigen Jahren erwarb die koreanische Gyeonggi Cultural Foundation eine beachtliche Anzahl seiner Arbeiten mit dem Ziel, ein NJP Museum zu errichten. Wenige Monate vor der Grundsteinlegung für den Neubau in Suwon stirbt Paik jedoch in Miami.
Auch die Wege von Marina Stankovic weisen nomadische Tendenzen auf. Bereits in ihrer Biografie sind die Grenzen der Länder relativiert: 1960 in Belgrad geboren, in Mailand aufgewachsen, Studium in Toronto und die Mitarbeit im Tessiner Büro bis sie Mitte der achtziger Jahre ein eigenes Büro in Berlin aufbaut. Hier entstehen mehrere Bauten, teilweise in Kooperationen wie beim Umbau des Preußischen Landtags zum Abgeordnetenhaus, bei dem sie mit den Architekten Jan und Rolf Rave und Walter Krüger zusammenarbeitet. Die früh praktizierte Teamfähigkeit und offene Arbeitsweise werden sich als eine wichtige Voraussetzung für den Weg nach Korea, China und Taiwan erweisen.
Begegnungen mit Asien
Die erste unmittelbare Asien-Begegnung findet 2003 beim Wettbewerb für den Fortune Plaza in Chongqing, einem neuen Zentrum in Westchina, statt. Marina Stankovic führt ein kleines Architekturbüro, ähnlich ist die Situation bei befreundeten Berliner Kollegen. Ihr gemeinsames Interesse besteht an der Teilnahme an Wettbewerben im asiatischen Raum – so wie es einige deutsche Großbüros bereits erfolgreich leisten. Auf Initiative von Gerald Blomeyer schließen sich mehrere Berliner Architekten und das chinesische Partnerbüro Conceptext aus Beijing zusammen: Eicke Becker, Bernd Faskel, Zamp Kelp, Gernot und Johanne Nalbach, Rolf Rave und Marina Stankovic firmieren als AXIS-Group beim Wettbewerb und gewinnen den ersten Preis. Damit hatten sie einen »world leader«, das Architekturunternehmen Hellmuth, Obata Kassabaum (HOK), mit rund 1800 Mitarbeitern, abgehängt. Die Hoffnungen der AXIS-Group sind zunächst groß: Ein ganzes Quartier in einer wachsenden Metropole zu errichten – fast unvorstellbar! Doch wird das erste staunende »Unglaublich« in den folgenden zähen Verhandlungen mit dem Bauherrn zur Tatsache. Es wird deutlich, dass die chinesischen Produktionsprozesse von Architektur und Städtebau mit den Vorstellungen der AXIS-Group divergieren, wobei der Anspruch an einen gewissen Ausführungsstandard von Bauherrnseite nicht mitgetragen wird. Bei den Gesprächen mit den chinesischen Partnern wird deutlich, dass es unerlässlich ist, »between-the-lines« zu lesen. Die Verhandlungen werden eingestellt. Wichtig bleibt jedoch die Erfahrung, sich als Team auf dem
internationalen Wettbewerbsmarkt neben den Giganten durchsetzen zu können.
Das Thema »Bigness«, wie Koolhaas es als Phänomen angesichts der asiatischen Wirtschaftspotenziale und des demografischen Wachstums beschreibt, fasziniert Marina Stankovic. Anders als in Europa scheinen hier zukunftsorientierte Konzepte in einer neuen Architektursprache möglich. So folgen in den nächsten Jahren weitere Wettbewerbsbeiträge für Kultureinrichtungen in Korea für das Seoul Center of Performing Arts, das Asian Cultural Center in Gwangju, das Prehistroy Museum in Jeongok und in Taiwan für das National Performing Arts Center in Kaohsiung sowie für das Eternal Golden. Stankovic besucht diese Orte und entdeckt dabei Land und Kulturen mit ihren Widersprüchlichkeiten von Tradition und Innovation.
Nam June Paik Museum
Einige Monate nach dem AXIS-Erfolg in Chongqing kommt das Angebot der Berliner Architektin Kirsten Schemel zu einer Projektpartnerschaft. Unter dem Titel »Matrix für Paik« hatte sie den internationalen Wettbewerb für das Nam June Paik Museum gewonnen (db 01/04). Im Vergleich zum Chongqing-Projekt handelt es sich nicht um ein Bigness-Thema, sondern um einen signifikanten Museumssolitär in einer Parklandschaft. Die Gyeonggi Cultural Foundation hatte die Absicht, den prämierten Entwurf zu realisieren, doch die Verhandlungen erweisen sich zunächst als äußerst zäh, da unterschiedliche Erwartungshaltungen und Geschäftskulturen aufeinandertreffen. Um die diffizile Auslandsarbeit zu bewältigen, gründen die Architektinnen die »KSMS Schemel Stankovic Ges. von Architekten mbH Berlin«. Mit dieser Neuerung entwickelt sich beiderseits eine offenere Gesprächsführung, und es gelingt, einen Vertrag für das »predesign bis design development« (LPh 1 bis 4/5) abzuschließen. Nun beginnt eine intensive Arbeitsphase mit mehreren Arbeitsaufenthalten in Korea. Zu den aufwendigen Bauherrenbesprechungen reist Marina Stankovic nach Seoul, da ihre Partnerin aus persönlichen Gründen verhindert ist. Hier wird, mit einem speziell einberufenen NJP Museum Building Committee sowie mit dem Kurator John Hanhardt vom NJP Studio aus New York, die weitere Planung erörtert. Zur Realisierung des Projektes sind erhebliche Änderungen des Wettbewerbsentwurfs erforderlich, so dass Stankovic in dieser Arbeitsphase sukzessive einen zweiten Entwurf verfasst. Dabei muss der Baukörper aus Kostengründen auf die Hälfte reduziert werden. Die geplante Matrix-Fassade stößt auf Kritik bei den Kuratoren, da sie als eine zu direkte Interpretation der Medienkunst verstanden wird. So entsteht eine Screen-Fassade, die das Monitorbild mittels mehrerer Glasschichten mit unterschiedlichen Reflexionsgraden und Drucktechniken sowie einer textilen Schicht materialisiert. Um eine Verbindlichkeit für die architektonische Qualität jenseits der Barrieren von Sprache und Kultur zu erreichen, erstellt Stankovic zahlreiche Erläuterungsskizzen, Zeichnungen und Modelle. Materialtafeln für die Fassade werden in Deutschland angefertigt und nach Suwon geschickt, wo sie als Originalvorlage für die koreanischen Firmen dienen. Ende 2005 ist die erste Planungsphase abgeschlossen, jetzt übernehmen die Kontaktarchitekten Chang-Jo die weitere Werkplanung vor Ort. Ihr koreanisches Pendant Hyun B. Kim hatte Marina Stankovic bereits im Vorfeld kennen und schätzen gelernt, da er sich als unersetzlicher Vermittler erweist in Sachen Kultur, Bauvorschriften und technische Durchführbarkeit. »Langnasen brauchen einen Partner vor Ort«, sagt Stankovic selbstironisch lachend.
Im Mai 2006 findet die »Breaking ground ceremony« statt mit zahlreichen Gästen aus Politik und Kulturleben bis hin zu Paiks Frau, der Videokünstlerin Shigeko Kubota. Diese Zeremoniebe hat eine sondere Bedeutung, denn sie wird als ein Verletzen des Bodens verstanden. Um die hierbei entstehenden negativen Energien nicht auf einen Einzelnen zu übertragen, wird die Verantwortung auf viele verteilt: So stehen das Committee, die Politiker und nicht zuletzt die Architekten nebeneinander und betätigen gemeinsam einen Knopf, der die ersten Bodenarbeiten auslöst – der Bau hat damit begonnen. Im Frühjahr 2008 soll das Museum fertig gestellt sein. Das Entdecken der asiatischen Lebens- und Arbeitsweise wird für Marina Stankovic weitergehen, demnächst mit der Gründung einer Dependance in Shanghai.
db, Mo., 2007.04.02
verknüpfte Zeitschriftendb 2007|04 Architekten im Ausland
![]()