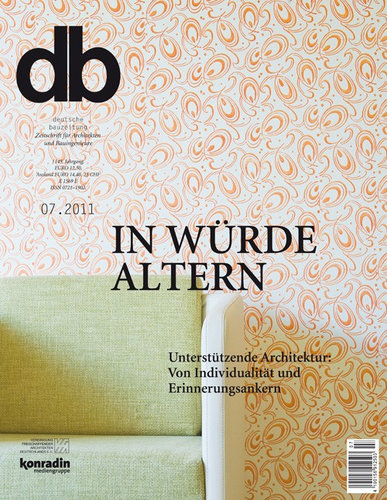Editorial
Was wird, wenn wir uns in fortgeschrittenem Alter nicht mehr selbstständig versorgen können? Wie wollen wir dann leben und wann sollten wir die Entscheidung darüber treffen? Die Beschäftigung mit dem Thema Planen und Bauen für ältere Menschen ist gleichzeitig auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft, mit dem eigenen Älterwerden. Für diese Ausgabe der db haben wir nach Projekten Ausschau gehalten, die nicht nur den hohen funktionalen Ansprüchen dieser Bauaufgabe genügen, sondern auch einfühlsam und respektvoll gestaltet sind und daher einen adäquaten Rahmen bieten, um auch mit Unterstützung in Würde leben zu können. Dass dies leider noch nicht die Regel ist und an welchen Stellen Nachbesserungsbedarf besteht, darauf weist der ergänzende Beitrag der auf das Wohnen im Alter spezialisierten Architektin und Wissenschaftlerin Sibylle Heeg unmissverständlich hin. | Ulrike Kunkel
Heim als Heimat
(SUBTITLE) Seniorenwohn- und Pflegeheim in Schaffhausen (CH)
Seit Jahren wächst die Zahl älterer Menschen, die in einem Wohn- oder Pflegeheim leben. Das Künzle- Heim ist ein gutes Beispiel für eine gleichermaßen hochwertige wie funktionale Architektur, die einen angemessenen und unterstützenden baulichen Rahmen für den Lebensabend schafft.
»Einen alten Baum verpflanzt man nicht «, lautet ein altes Sprichwort. Doch die Gesellschafts- und Sozialstruktur der mitteleuropäischen Konsumgesellschaften sieht anders aus. Immer mehr alte Menschen verbringen ihren letzten Lebensabschnitt nicht mehr in ihrer vertrauten Umgebung. Stattdessen gilt es für sie, die Tür der eigenen Wohnung, in der sie oft Jahrzehnte gelebt, geliebt und gelitten haben, ein allerletztes Mal hinter sich zu schließen, um in einem Wohn- oder Pflegeheim noch einmal neu anzufangen. Etliche Dinge und noch mehr Erinnerungen bleiben dann zurück. Auf einmal befindet man sich außerhalb des bekannten sozialen Umfelds, kommt in eine größere Gemeinschaft fremder, gleichaltriger Menschen, an einem neuen Ort, der Heim heißt und der erst zu einer Heimat werden will. Wie gut dieser tiefgreifende Einschnitt bewältigt wird, hängt auch von der Qualität dieser neuen Umgebung ab. Das Künzle-Heim am Rand des schweizerischen Schaffhausen schafft durch seine Architektur einen qualitätvollen architektonischen Rahmen, in dem es leichter fällt, heimisch zu werden.
Eingebettet in einen schönen alten Baumbestand, fügt sich das Gebäude in malerischer Hanglage auf Z-förmigem Grundriss in die Schaffhausener Vorstadtatmosphäre ein. Durch die Wahl der Gebäudeform ist es den Zürcher Architekten Roland Frei und Lisa Ehrensperger gelungen, den großvolumigen Baukörper mit seinen 57 Wohneinheiten weniger massiv wirken zu lassen und einen behutsamen Übergang zur kleinteiligen Bebauung der Umgebung zu gestalten. Darüber hinaus entstehen durch die Form des Gebäudes geschützte Außenräume, für das Entree ebenso wie für den sichtgeschützten Demenz-Garten auf der Rückseite.
Seinen Namen verdankt das Seniorenheim der »Künzle Stiftung«. Bereits in den 50er Jahren vom Schaffhausener Pfarrer Richard Künzle gegründet, verfolgt sie das Ziel der Vorsorge für das Alter. Heute befindet sich das Heim in gemeinsamer Trägerschaft der Stiftung (Land und Immobilie) und der Stadt Schaffhausen (Betriebsführung). Der im Herbst 2010 eröffnete Neubau ersetzt ein nicht mehr angemessen ausgestattetes Gebäude der 70er Jahre. Von ihm blieben lediglich die beiden UGs erhalten, die über einem Bahntunnel im Hang stehen. Durch seine Hanglage ist der Baukörper straßenseitig fünfgeschossig, im rückwärtigen Bereich teilweise nur zweigeschossig.
Frei und Ehrensperger haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach mit der Bauaufgabe Wohnen im Alter befasst. »Es geht uns dabei um gute Gastgeberschaft«, bringt Roland Frei seine Entwurfshaltung auf den Punkt. Doch wie kann eine Atmosphäre entstehen, in der sich alte Menschen wohlfühlen und die dennoch die notwendigen funktionalen und hygienischen Anforderungen für den Pflegefall erfüllt? Schon bei der Fassade des Künzle-Heims fällt die Qualität der Gestaltung auf. So wird das wie schwebend wirkende gläserne Sockelgeschoss durch eine schlanke Geschossplatte aus Beton geschützt, die wie ein Vordach auskragt. Die Fassade der vier OGs mit ihren Holzständern wird durch eine Lattenkonstruktion aus heimischem Lärchenholz abgeschlossen, die einen schützenden Eisenglimmeranstrich erhalten hat. Die überlappend montierte Lattenkonstruktion belebt die äußerste Fassadenschicht durch ein zartes Relief. So entsteht ein behutsamer Gegenpol zur horizontalen Grundstruktur des Hauses mit seinen auskragenden Geschossbändern. In die gut gedämmte Fassade, die den Schweizer Minergie-Standard erfüllt, sind die großen, quadratischen Laibungen der Fensternischen tief eingeschnitten. Mit ihnen wird eine Zwischenzone definiert, die die Qualität des Übergangs zwischen Natur und Architektur besonders betont, welcher in den Bauten von Frei & Ehrensperger eine hervorgehobene Rolle spielt.
Gehobene Wertigkeit
»Wie ein Baumhaus«, so Roland Frei, fügt sich das Künzle-Heim in den dichten Baumbestand seiner Umgebung ein. Auch im Innern des Gebäudes ist dieser »Baumhauseffekt« erfahrbar. Die mächtigen Glasflächen bieten den Bewohnern ungehinderte Ausblicke in das umgebende Grün – und damit auch räumliche Orientierungspunkte. Zudem sorgen sie dafür, dass die ohne Handläufe gestalteten Flure sehr viel Tageslicht erhalten, ganz als würde es sich um innenliegende Laubengänge handeln. Ergänzt wird diese naturnahe Gestaltung durch die Terrassen, die den Geschossen zugeordnet sind, sowie durch die Materialität, auf die Frei & Ehrensperger besonderen Wert gelegt haben. Das wird gleich in der großzügigen Lobby deutlich. Sie erinnert mit dem mit Ulmenholz verkleideten Empfang, der Bar, dem Restaurant, den Sitzecken und dem Kamin an die Ausstattung eines gehobenen Hotels – und straft übliche Vorstellungen eines Seniorenwohnheims Lügen. Das rund 16 Mio. Euro teure Haus dient zudem als »Quartierdienstleistungszentrum«, von dem aus Pflegedienstleistungen für die Umgebung angeboten werden. Neben einem Fitnessraum, in dem nicht nur für die Bewohner des Heims Kurse im Seniorenturnen angeboten werden, und einem Friseur, verfügt der Bau auch über einen Andachtsraum. Es ist eine schlichte Kapelle, die durch ein Oberlicht vor der Rückwand ihre stimmungsvolle Belichtung erfährt. Doch auch die notwendigen Pflegeeinrichtungen sind vorhanden, zu denen u. a. spezielle Bäder für Pflegbedürftige gehören. Die Gesamtwirkung des Gebäudes ist jedoch keineswegs die eines Heims oder Spitals, sondern eines hochwertig ausgestatteten Boardinghauses. Während der Fußboden in den öffentlichen Bereichen aus grau-braunem Muschelkalk besteht, liegt in den 57 Wohnungen Parkett. Die Wände zu den Wohnungen sind ebenfalls mit Ulmenholz verkleidet, dazu fügen sich die tragenden Betonfertigteile der Nasszellen, die zu den Fluren hin durch die Sandstrahlbehandlung eine raue, haptische Oberfläche besitzen. In jenen Bereichen des Künzle-Heims, wo durch die Hanglage keine Ausblicke in die Landschaft möglich sind, wird diese Rolle durch die Fotografien von Guido Baselgia wahrgenommen. Die fenstergroßen Leuchtvitrinen zeigen schwarz-weiße Luftbilder, die als Berglandschaft ebenso wahrnehmbar sind wie als abstrakte Strukturen.
Gebaute Willkommensgesten
Die Eingangszonen zu den 57 Wohnungen sind durch nischenartige Rücksprünge, eine im Boden eingelassene Fußmatte sowie durch ein Oberlicht gekennzeichnet. So entsteht das Gefühl, dass man vom Flur aus nicht einfach nur ein Zimmer betritt, sondern wirklich über einen kleinen Vorraum in seine eigene Wohnung gelangt. Die farbliche Kennzeichnung der Flure ist dabei äußerst zurückhaltend. Sie beschränkt sich auf die Zimmernummern in den Eingangsnischen, die auf die Wand aufgesetzt und damit ggf. bei eingeschränkter Sehfähigkeit ertastbar sind.
Die Normzimmer im Künzle-Heim messen 26 m² zuzüglich der Badzelle (4 m²) und dem Balkon (3 m²) und sind ohne Kochnische ausgeführt. Die Verpflegung erfolgt über das Restaurant. Zudem gibt es sieben Eckzimmer, die jeweils über mehr Fläche verfügen (34 bzw. 36 m²) samt Kochnische. Durch die Ausführung der Trennwände in Leichtbauweise ist es ohne Schwierigkeiten möglich, etwa für Ehepaare, mehrere Zimmer zu einer Wohneinheit zusammenzufassen, was auch bereits genutzt wird. Alle Wohnungen und Bäder sind behindertengerecht erschlossen. Das besondere an den Wohnungen ist – einmal mehr – der intensive Bezug zur Natur. Die in den Baukörper eingezogenen Balkone sind zu drei Seiten hin verglast, um lange natürliches Licht in die Wohnungen zu lassen. Zudem werden die Räume dadurch optisch aufgeweitet. Ein auberginefarbener Sonnenschutz sowie Vorhänge ermöglichen es demgegenüber die gewünschte Privatheit zu erzeugen. Bis auf einen Einbauschrank im Eingangsbereich obliegt die Möblierung den Bewohnern. Die Kosten betragen zwischen 90 und 110 Euro pro Zimmer und Tag, zuzüglich der Kosten für die Pflegleistungen. Getragen werden sie privat bzw. durch Versicherungsleistungen.
Ergänzt wird das Raumprogramm durch Aufenthalts- und Gemeinschaftsräume. Zum derzeit voll belegten Seniorenheim gehört auch eine abgeschlossene Demenz-Abteilung im ersten OG mit 15 Zimmern, die entsprechend den übrigen Zimmern gestaltet sind, und ein ebenfalls geschützter Demenz-Garten. Mit seinem geschwungenen Pflanzbeet samt Cortenstahlbrüstung und Handlauf bietet er die Möglichkeit eines Rundlaufs bei besonderem Bewegungsdrang der Bewohner.
Gemeinschaftliche Wohnkonzepte
In den Bau des Künzle-Heims eingeflossen sind die Erfahrungen, die Frei & Ehrensperger beim Haus Rabenfluh (2006/08) in Neuhausen am Rheinfall gesammelt haben eingeflossen. Bei diesem in Sichtbeton ausgeführten Altersheim findet sich eine verwandte Z-förmige Grundrissgestaltung sowie eine ähnliche Grunddisposition der Zimmer. Die Fenster- und Balkonflächen, die zu einer ausgedehnten natürlichen Belichtung der Wohnungen beitragen, sind im Haus Rabenfluh mit seinen 50 Zimmern jedoch nicht auf die Baumlandschaft der Umgebung ausgerichtet, sondern auf den Rhein, der talwärts vor dem Haus vorbeifließt. Ausgeprägter ist das Orientierungssystem im Rabenfluh: Die auf beruhigenden Grün- und Gelbtönen basierenden Glastrennwände und Tapeten hat Annelies Štrba entworfen. Zwar ist angesichts des geringeren Gesamtbudgets (12,6 Mio. Euro) die Ausstattung weniger hochwertig. Das Konzept der durch Fenster gefassten Ausblicke in die Landschaft als Erinnerungsanker für die Bewohner wurde aber auch dort umgesetzt.
Ein weiteres Projekt der Planer, das jüngst eröffnete Seniorenwohnen in Bonaduz (Graubünden) wirkt wie eine Steigerung dieses engen Landschaftsbezugs. Die Wohnungen mit Küchennische aus Lärche fügen sich zu einer gebauten Skulptur mit unterschiedlichen Fensterformaten zusammen, die wie Gemälde jeweils den Ausblick in die Berglandschaft einfassen. Mit ihrer anspruchsvollen Architektur schaffen Frei & Ehrensperger auch dort den Rahmen für jene behagliche Gastgeberschaft, mit der für die Bewohner aus einem Heim eine neue Heimat wird.db, Mo., 2011.07.04
04. Juli 2011 Jürgen Tietz
Menschen im Hotel
(SUBTITLE) Seniorenwohnstift Augustinum in Stuttgart-Killesberg
Auf dem Killesberg entstand auf einem Teilstück des ehemaligen Messegeländes in topografisch exponierter Lage und unmittelbarer Nachbarschaft zur Weißenhofsiedlung das zweite Augustinum in Stuttgart. Trotz der erheblichen Baumasse fügt sich das Seniorenwohnstift der gehobenen Art städtebaulich und architektonisch gut in die Umgebung ein.
Der Gedanke an eine Seniorenwohnanlage oder gar ein Pflegeheim kommt bei diesem Ensemble aus vier »Doppeltürmen« nun wirklich nicht auf. An eine ganz »normale« Wohnsiedlung denkt man und wundert sich beim Näherkommen allenfalls, dass die Gebäude über einen gläsernen Sockelbereich miteinander verbunden sind. Beim Eintreten in die großzügig gestaltete Lobby mit Rezeption, Loungebereich und Bar glaubt man dann doch, sich geirrt zu haben: keine Wohnhäuser, sondern ein gediegen luxuriöses Hotel. Beide Assoziationen sind durchaus gewünscht; in den Häusern des Augustinums sollen sich die Bewohner sicher, aber dennoch frei, gut versorgt und betreut, aber nicht eingeengt und bevormundet fühlen. Eben eher wie in einer komfortaben Wohnan- lage mit Hotel-Service, nur, dass das Personal auf die speziellen Bedüfnisse älterer und alter Menschen eingestellt ist. Wesentlicher Bestandteil des Augustinum-Konzepts – und für viele bei der Entscheidung, in ein Haus dieses Trägers zu ziehen, durchaus ausschlaggebend – ist aber v. a. die garantierte vollumfängliche Pflege in der eigenen Wohnung.
Das Seniorenwohnstift auf dem Killesberg ist das jüngste der mittlerweile 22 Augustinum-Häuser, die über ganz Deutschland verteilt sind und von denen das erste 1962 eröffnet wurde. Das große Bauvolumen, das 290 Appartements sowie verschiedene Gemeinschaftsbereiche und -einrichtungen umfasst, verteilt sich geschickt auf acht Baukörper und einen verbindenden Sockelbereich, der sich wiederum in zwei Ebenen gliedert. Die obere (Erdgeschossebene) umfasst zusammenhängend im Wesentlichen Foyer, Veranstaltungssaal, Restaurant, Küche, Läden, Bankfiliale, Bibliothek, Musikzimmer und Kapelle. Die untere Ebene beinhaltet Schwimmbad, Wellness, Fitness, Pflege und Arztzimmer. Diese klare Nutzungsgliederung sowie Außenbezüge nach Norden und Süden erleichtern die Orientierung innerhalb der ausgedehnten Anlage. Beide Ebenen sind außerdem direkt anzufahren, so dass optimale Betriebsabläufe gewährleistet sind.
Die acht Baukörper haben für sich genommen eine relativ kleine Grundfläche von 23 x 23 m, auf der jeweils nur sechs Wohnungen zwischen 50 und 80 m² untergebracht sind. Diese kleinen Einheiten vermitteln ein Gefühl von Individualität und Privatheit. In einigen der oberen Stockwerke befinden sich wenige Appartements mit über 100 m². Bis auf die kleinsten Wohnungen werden alle von zwei Seiten belichtet, ausschließliche Nord-Ausrichtungen gibt es keine; alle Appartements haben eine geschützte Loggia sowie großzügige Fensterflächen und sind mit Parkett, Küchenzeile, Bad und teilweise zusätzlichem Gäste-WC komfortabel und barrierefrei ausgestattet.
Immer zwei dieser »Wohnkuben« sind leicht versetzt zueinander über ein verglastes Treppenhaus zusammengekoppelt. Die entstehenden »Doppeltürme« sind in ihrer Höhe gestaffelt: von acht Geschossen zur verkehrsreichen Stresemannstraße im Westen bis hin zu sechs Geschossen zur im Osten angrenzenden Weißenhofsiedlung. Die Bebauung folgt damit dem Gelände, das ein Höhengefälle von ca. 10 m aufweist.
Differenziertes Volumen- und Fassadenkonzept
Die durchgrünte, offene Bauweise lässt immer wieder Blicke auf den alten Baumbestand des im Norden angrenzenden Höhenparks Killesberg bzw. auf die Nachbarhäuser zu. Doch nicht nur die städtebauliche Anordnung, sondern auch das differenzierte Fassadenkonzept löst das große Bauvolumen gekonnt auf und ermöglicht einen maßstäblichen Übergang zur benachbarten, z.T. kleinteiligen Wohnbebauung. Die eigentlich schlichten, hellgrauen Putzfassaden (WDVS) erhalten ihre besondere Gliederung und Rhythmisierung durch die nicht übereinander, sondern versetzt zueinander angeordneten Loggien und begleitenden Fensterflächen. Ein weiteres gestaltendes Element – das bei den Bewohnern allerdings auf leichte Irritation stößt – sind die zwar zu öffnenden, aber ansonsten nicht durchsichtigen, sondern weißen Fensterflügel. Zusammen mit den weißen Rahmen und den weiß ausgestrichenen Loggien unterstützen sie die plastische Qualität der Fassade. Noch stärker wäre die Wirkung allerdings, wenn die Fassaden in dunklem Grau und die Loggien, Brüstungsabdeckungen und weißen Fensterelemente in Marmor ausgeführt worden wären – eine Idee, die Wulf und Partner im Wettbewerb noch verfolgten. Es hätte vielleicht nicht unbedingt Marmor sein müssen, aber die Verwendung hochwertigerer Materialien hätte der Nahwirkung gut getan und wäre dem Projekt durchaus angemessen gewesen.
Urbaner Vorplatz — unbelebt
Der Haupteingang zur Seniorenwohnanlage liegt zentral an der verkehrsberuhigten Oskar-Schlemmer-Straße und ist über einen gepflasterten, städtisch anmutenden Vorplatz zu erreichen, der gleichzeitig als Begegnungsort für die Bewohner untereinander, aber auch mit der Öffentlichkeit dient. Eineinhalb Jahre nachdem die ersten Bewohner eingezogen sind, ist es hier, wie auch in den Begegnungsbereichen im Gebäude allerdings noch sehr ruhig; das Wohnstift ist bisher nicht annähernd voll belegt. Durch die Eingangshalle gelangt man in einen der mit Rasenflächen, Staudenbeeten und niedrigen Hecken angelegten Höfe. Über die versetzten Heckenstrukturen erfolgt eine unauffällige Abstufung der öffentlichen und halböffentlichen Bereiche. Das Grundstück ist nicht eingezäunt, sondern wird von Gabionen bzw. bräunlich-rot eingefärbten Betonmauern lediglich locker eingefasst.
Trotz großzügigem Vorplatz ist der Eingang an sich relativ unauffällig; bei einem ersten Besuch hat man jedenfalls ein wenig Mühe, ihn zu finden. Einen markanten Akzent sollte hier eigentlich der Veranstaltungssaal setzen, der von den Architekten als »Schatzkästchen« geplant war und vom Totalübernehmer (letztlich an Wulf und Partner vorbei) leider auf den Charme einer Technikzentrale heruntergespart wurde. Doppelt unverständlich, schließlich ist das zum großen Teil öffentliche Kunst- und Kulturprogramm auch ein wichtiger Bestandteil des Augustinum-Konzepts.
Ein weiterer Wermutstropfen ist das bläuliche, verspiegelte Sonnenschutzglas, mit dem sowohl die gesamte Sockelzone als auch die Verbindungstürme verglast sind. Die Architekten hatten hier eigentlich ein klareres Glas mit Sonnenschutzeigenschaften vorgesehen, doch auch dies wurde aus Kostengründen eingespart. So wirken die Gebäude merkwürdig unnahbar, was sich auch auf die Aufenthaltsqualität der umgebenden Freiflächen negativ auswirkt.
Dennoch ist auf dem Killesberg ein wohnlicher und sehr angenehmer Ort entstanden, der für seine Bewohner ein neues Zuhause geworden ist, wie die Stiftsleiterin Petra Hellenthal bestätigt. Ein Zuhause, das man sich allerdings leisten können muss: Bei Wohndarlehen zwischen 20 000 und 40 000 Euro und monatlichen Pensionspreisen von 2 550 bis 3 600 Euro – je nach Größe des Appartements (vollumfängliche Pflege noch nicht eingeschlossen), wendet sich der Träger an eine ausgesuchte, zahlungskräftige Klientel.db, Mo., 2011.07.04
04. Juli 2011 Ulrike Kunkel
Pflege mit Aussicht
(SUBTITLE) Pflegeheim in Lana/Völlan, Südtirol (I)
Stille Gemütlichkeit und extrovertierte Transparenz sind hier keine Gegensätze, sondern Ausdruck einer bemerkenswerten Normalität, die auch die z. T. über hundert Jahre alten Bewohner sehr schätzen. Sicher, die herrliche Bergluft und die liebevollen Ordensschwestern tragen ihren Teil bei, einen ganz wesentlichen Beitrag leistet aber auch die sensibel ins soziale Umfeld eingepasste Architektur.
In Serpentinen windet sich die Straße von der quirligen Ortschaft Lana gut 500 Höhenmeter hinauf in den rund 1 000 Einwohner zählenden Teilort Völlan und hinein in eine zurückgezogene Welt mit Wäldern, Wein- und Obstanbaugebieten und einem fantastischen Blick über das Etschtal. In dieser Abgeschiedenheit gründete der Deutsche Orden 1852 ein Hospiz, das zuletzt als Altenheim mit rund 40 Bewohnern genutzt wurde, sich aber aufgrund überalterter Baustrukturen kaum mehr für das von den Ordensschwestern propagierte »ganzheitliche Pflegekonzept« eignete. Also initiierten sie einen Planungswettbewerb zur Modernisierung des Gebäudebestands und Realisierung eines ergänzenden Neubaus. Ziel der Planungen war ein dezidiert modernes Haus mit großzügigen Räumen und wohnlichem Ambiente, das sowohl den Vorstellungen von einer menschenwürdigen Pflege als auch den umfassenden »Baurichtlinien für Alten- und Pflegeheime des Landes Südtirol« genügen sollte. Vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Wohnplätzen und im Sinne eines wirtschaftlichen Betriebs sollte das Haus insgesamt 75 größtenteils schwer pflegebedürftige Bewohner aus Lana, Meran und Umgebung aufnehmen.
Selbstbewusstes Miteinander
Das neue Pflegeheim St. Josef des Südtiroler Architekten Arnold Gapp liegt exponiert auf einem Bergrücken unweit von Dorfkirche und Dorfmitte. Zur Talseite erscheint es als 85 m lange Großform mit drei Ober- und zwei Untergeschossen sowie einer relativ einheitlichen Fassadengestaltung. Damit zeigt es zwar jene selbstbewusste städtebauliche Präsenz, die angesichts des auch hier immer wichtigeren Themas »Wohnen im Alter« durchaus erwünscht war. Für Völlaner Verhältnisse unmaßstäblich ist es aber nur deshalb nicht, weil es aufgrund seiner Hanglage von kaum einem Standort aus in vollständiger Länge zu sehen ist. Im Gegensatz hierzu präsentiert sich das Gebäudeensemble aus Altbau, Neubau und nördlich angegliederter Hauskapelle von der Eingangsseite als überraschend plastisch und feingliedrig. Hier gruppieren sich der frei stehende, behutsam sanierte Alt- und der zweiflügelige Neubau um einen zur Dorfmitte offenen Innenhof, wobei die Abwechslung zwischen verputzten bzw. großflächig verglasten Holzfassaden für ein selbstverständliches Miteinander der Baukörper sorgt.
Mehr als Transparenz
Die Idee des gemeinschaftlichen Miteinanders spiegelt auch die transparente Eingangsfassade wider. Einerseits ist sie architektonischer Ausdruck der Erneuerung und wirkt mit herausfordernder Offenheit dem landläufigen Bild der ins Heim abgeschobenen Alten entgegen, andererseits gewährt sie vielfältige Einblicke auf die wichtigsten, quasi öffentlichen Hausbereiche – Küche, Mehrzwecksaal und Verwaltung im EG sowie Gemeinschaftsbereiche in den OGs. Dieser Überblick ist von besonderer Bedeutung, weil er den Bewohnern die Möglichkeit bietet, sich trotz Mobilitätseinschränkungen als Teil der Aktivitäten ihrer Lebensumwelt zu betrachten.
Der überschaubare Eingangsbereich ohne offene Theken (der verglaste Empfang ist gleichzeitig Teil der Verwaltung) und ohne aufdringliche Infotafeln oder Aushänge wirkt wie das großzügige Foyer eines Wohnhauses. Und tatsächlich bietet das Hauskonzept in den beiden OGs keine klassischen »Stationen«, sondern jeweils einen Pflegewohnbereich mit 28 Bewohnern. Dieser Bereich besteht neben den für solche Einrichtungen üblichen Nebenräumen überwiegend aus Einzelzimmern, die sich entlang der beiden Gebäudeflügel entweder zum Dorf oder zum Tal hin orientieren – vier Zimmer liegen jeweils im Altbau und sind über einen Glassteg mit dem Neubau verknüpft. ›
Bewohner statt Insassen
Für eine wohnliche Atmosphäre in den Fluren wie auch in den Zimmern sorgen Parkettfußböden in Kirsche, Wandverkleidungen in Lärche, gekalkte Wände, aber auch Holzfenster, über deren Brüstungen die Bewohner auch vom Bett aus noch gut ins Freie sehen können. Trotz vorgeschriebener technischer Anschlüsse für Sauerstoff- und Absauganlagen oder Notrufsysteme herrscht in den Zimmern keine Krankenhausatmosphäre – gäbe es nicht die Pflegebetten, könnten die Räume ebensogut Hotelzimmer sein. Bündig gesetzte Holzoberflächen, ein großes Oberlicht zum Bad sowie gestalterisch angenehm redu- zierte Möblierungen, Einbauleuchten und sogar Steckdosen bestimmen das Bild. Die konsequente Barrierefreiheit drängt sich weder hier noch in den Bädern oder anderswo im Haus auf. Um beispielsweise den Aufzug (der zugleich Rettungsaufzug ist) jederzeit ohne sichtbare Raumabschlüsse zugänglich zu halten, setzte der Architekt ein hinter der Wandverkleidung verstecktes Brandschutztor ein. Heimleiter Sepp Haller beschreibt dies als »Normalitätsprinzip«: Natürlich müssen die Oberflächen hygienischen und anderen Standards genügen. Doch warum sollten die Räume deshalb durch den Einsatz vertrauter Materialien nicht trotzdem »normal« aussehen und mit persönlichen Gegenständen ausgestattet werden dürfen? In ihren Zimmern machen die Bewohner von dieser Möglichkeit bislang nur zaghaft Gebrauch, weshalb diese letztlich dann doch eher unpersönlich wirken.
Sehen und gesehen werden
Anders als die Privaträume fungieren die Gemeinschaftsbereiche an der Eingangsfassade als offene Kommunikationsflächen, die durch ein vielfältiges räumliches und organisatorisches Angebot (essen, spielen, musizieren, malen, basteln) eine hohe Erlebnisdichte bieten – und damit der Vereinsamung als einem der größten Probleme in Pflegeheimen entgegenwirken. Wie in einem Hotel gibt es in jedem Geschoss unterschiedlich große, mehr oder weniger »öffentliche« Zonen. Für kleinere Runden eignen sich die in einer seitlichen Aufweitung untergebrachte »Stube«, ein weiterer Aufenthaltsraum im Altbau, aber auch die große Loggia, die gleichzeitig Rettungsbalkon für die Feuerwehr ist.
Das vielleicht wichtigste Stück Normalität und vertrautes Gesellschaftsleben ermöglicht den überwiegend katholischen Menschen die zweigeschossige, von den Fluren des 1. und 2. OG barrierefrei zugängliche Hauskapelle. Konzipiert als eigenständiger Baukörper, der sich von den Pflegewohnbereichen und von außen durch grob strukturierte Putzoberflächen abhebt, gibt sich das Innere der Kapelle – ganz im Gegensatz zu den sonst vorherrschenden warmen Holzfarbtönen und transparenten Glasflächen – angenehm kühl und hermetisch. Durch einheitlich sandfarbene Oberflächen, roh verputzte Wände, Natursteinboden und eine indirekte Lichtführung, v. a. aber durch die abstrakte Ausstattung des Meraner Künstlers Manfred Alois Mayr entstand ein Innenraum von bemerkenswert kraftvoller Klarheit und Spiritualität. ›
Sterben – selbstverständlicher Teil des Lebens
Ergänzt wird dieser Sakralraum durch eine seitliche »Totenkapelle«, die das Sterben als selbstverständlichen Teil des Lebens vor Augen führt. Mit ihrer archaischen Schmucklosigkeit, einem großen hochliegenden Fenster und gleichmäßigem Nordlicht korrespondiert sie wunderbar mit der Hauskapelle und schafft die Möglichkeit, verstorbene Bewohner würdevoll aufzubahren und in aller Ruhe und Ungestörtheit zu verabschieden. Aus diesem Grund ist die Totenkapelle nicht nur von innen, sondern (wegen des ansteigenden Geländes) auch von außen ebenerdig zugänglich – gänzlich unabhängig von den in der Kapelle stattfindenden Rosenkranzgebeten und Gottesdiensten.
Unter der Kapelle, im EG der nördlichen Gebäudeflügel befindet sich ein dritter Pflegewohnbereich für 18 Demenzkranke. Dieser entspricht grundsätzlich den Pflegewohnbereichen der OGs, ist jedoch wesentlich kompakter und introvertierter angelegt, um den Menschen mit massiven Orientierungs- und Gedächtnisproblemen die Orientierung zu erleichtern und störende Außen- reize zu minimieren.
Der große Aufenthaltsbereich am nördlichen Gebäudeende verfügt neben einem Koch- und Essbereich mit Küchenzeile auch über eine Original-Bauernstube aus dem 19. Jahrhundert, die durch typische Gerüche, Oberflächen und Materialien angenehme Erinnerungen bereiten soll. Ob dies tatsächlich funktioniert, können selbst die Schwestern nicht mit Sicherheit sagen. Allerdings haben sie festgestellt, und dies gilt für alle Heimbewohner, dass die während der Bauphase in ein anderes Pflegeheim ausquartierten Bewohner seit dem Rückzug ins neue Pflegeheim St. Josef deutlich weniger typische Winterkrankheiten aufwiesen als bisher – obwohl sie wegen des erneuten Umzugs, noch dazu in der kalten Jahreszeit, eigentlich mit einem Anstieg gerechnet hatten. Sie führen diesen Effekt nicht zuletzt auf die hohe Behaglichkeit und Offenheit des Hauses, aber auch auf die durch die Glasfassaden wesentlich erhöhte Sonnenein- strahlung zurück.
Die durchschnittlich 90 Jahre alten Bewohner lassen im Gespräch keinen Zweifel daran, dass sie sich hier rundum wohlfühlen. Und stets ist dabei auch ein bisschen Stolz auf das neue Gebäude hoch über dem Etschtal herauszuhören, in dem sie mit den Ordensschwestern wie in einer großen Familie wohnen.db, Mo., 2011.07.04
04. Juli 2011 Roland Pawlitschko