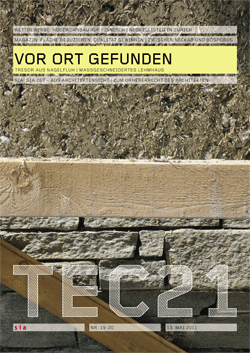Editorial
In dieser Ausgabe fokussiert TEC21 auf zwei Projekte – einen öffentlichen Bau und ein Privathaus –, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Material und den vor Ort vorhandenen Ressourcen auseinandersetzen. Dabei handelt es sich nicht um Pilotprojekte, nicht um exemplarische Beispiele, sondern es werden zwei Herangehensweisen an eine Architektur gezeigt, die sich durch eine zunehmende Sehnsucht nach loka-ler und regionaler Verwurzelung auszeichnen.
Der Neubau der Raiffeisenbank in Küssnacht am Rigi besticht durch eine ungewöhnlich saubere Konstruktion. Die wenigen eingesetzten Materialien – visuell am dominantesten sind der Beton mit Gesteinskörnung aus dem Kanton Schwyz und das Nussbaumholz aus dem Luzerner Napfgebiet – sind so verarbeitet, dass ihre sinnlichen Qualitäten optimal zur Geltung kommen. Die Architekten konzentrierten sich mit Sorgfalt und Hingabe auf die Ausgestaltung der konstruktiven Details, die dem -Gebäude erst den Gesamteindruck verleihen. Nicht zu unterschätzen ist der identitätsstiftende Wert der Oberflächen: Das Wissen um deren Herkunft erzeugt Vertrautheit; der Verweis auf deren «einheimischen» Ursprung schafft für die Kundschaft der Bank – vielleicht – besonderes Vertrauen («Tresor aus Nagelfluh»).
Das zweite vorgestellte Gebäude ist ein Privathaus in Deitingen SO. Bauherr Ueli Flury befasst sich seit langem mit naturnahem Gartenbau. Die dort angewendeten Prinzipien der Nutzung von lokal vorhandenen Ressourcen und geschlossenen Kreisläufen wollte er auch beim Bau seines Hauses anwenden. Der Wunsch, ein autarkes Gebäude mit minimaler grauer Energie zu errichten, entstand aber auch aus dem Anspruch, die Verantwortung für den eigenen ökologischen Fussabdruck zu übernehmen. Mit Ausdauer ging er daran, die Umsetzbarkeit dieser Ideen auszuloten. Dabei zeigten sich auch die Grenzen des Vorhabens: Autarkie ist für ein Einzelhaus, noch dazu innerhalb eines Ortes, oft nur mit grossem Aufwand zu realisieren, was wiederum den Anteil grauer Energie in die Höhe schnellen lässt. Trotz den Kompromissen, die man eingehen musste, und obwohl eine nüchterne Abwägung möglicherweise gegen einige Massnahmen sprechen würde,[1] ist das Haus Flury ein bemerkenswertes Beispiel für verantwortungsvolles Bauen, das mit den vor Ort vorhandenen Materialien zudem -architektonisch ansprechend umgesetzt wurde («Massgeschneidertes Lehmhaus»).
Claudia Carle, Tina Cieslik, Clementine van Rooden
Anmerkung
[1] Bei der Realisierung eines autarken Einfamilienhauses in Flerden kam die HTW Chur 2007 zum Schluss, dass eine autarke Strom- und Wasserver-sorgung sowie Abwasserentsorgung in erschlossenem Gebiet weder ökologisch noch ökonomisch begründbar ist.
www.fh-htwchur.ch/de/ibar/projekte/architektur/autarkes-wohnen/
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Holzwohnbau auf Finnisch | Negrellisteg in Zürich
16 PERSÖNLICH
Jennifer Dreyer: «Netzsicht verändert den Blickwinkel»
18 MAGAZIN
Fläche reduzieren, Qualität gewinnen | Bücher | Zwischen Neckar und Bosporus | Wechsel an der Spitze von TRACÉS
28 TRESOR AUS NAGELFLUH
Tina Cieslik, Clementine van Rooden Der Neubau der Raiffeisenbank in Küssnacht am Rigi zeichnet sich auf konstruktiver und ästhetischer Ebene durch eine ungewöhnliche Präzision aus. Die Fassadenelemente aus Beton, der die Nagelfluh nachahmt, verweist auf den Standort am Fusse der Rigi.
33 MASSGESCHNEIDERTES LEHMHAUS
Claudia Carle, Tina Cieslik Ein Einfamilienhaus in Deitingen dient als Experimentierfeld: Abwasserentsorgung und Energieerzeugung funkti-onieren autark, die Mehrheit der Baumaterialien stammt aus dem nahen Umkreis.
41 SIA
SIA 269 – aus Architektensicht | Zum Urheberrecht des Architekten | Weiterbildung und Studienreise
47 PRODUKTE
61 IMPRESSUM
62 VERANSTALTUNGEN
Tresor aus Nagelfluh
2007 gewannen die Luzerner Architekten Lütolf und Scheuner den Wettbewerb für den Neubau der Raiffeisenbank in Küssnacht am Rigi. Ihr Entwurf «Nagelfluh» überzeugte städtebaulich, mit guter Raumorganisation und einem lokalpatriotischen Kniff: Der Projektname weist auf das vorherrschende Gestein der benachbarten Rigi hin und stellt so den Bezug zum Standort her. Die in der Materialisierung der Nagelfluh nachempfundenen, vorfabrizierten Fassadenschwerter sind scharfkantig, glatt – fast geschmeidig – und beeindruckend präzise ausgeführt.
Die Raiffeisenbank ist die drittgrösste Bank der Schweiz. Zur Firmenphilosophie gehören neben der genossenschaftlichen Struktur insbesondere die Kundennähe und die lokale Verankerung, die auch durch die Pflege der Baukultur verwirklicht wird (vgl. Dossier Raiffeisenbank, Beilage zu TEC21 47/2006). 2006 fusionierten die Raiffeisenbanken am Rigi und Arth-Goldau zur Raiffeisenbank am Rigi mit Hauptsitz in Küssnacht. Um dem zusätzlichen Raumbedarf gerecht zu werden, lobte das Unternehmen im Frühling 2007 einen Studienauftrag mit Präqualifikation unter zehn eingeladenen Architekturbüros aus, den die Luzerner Architekten Lütolf und Scheuner für sich entschieden. Ihr Entwurf überzeugte mit der präzisen Reaktion auf die städtebauliche Ausgangslage und mit der intelligenten Umsetzung des Raumprogramms. Ausschlaggebend war aber der örtliche Bezug: Das Motiv für die Materialisierung der Fassade lieferte die Nagelfluh – ein junges Konglomerat aus Sedimentgestein mit gerundeten, farblich unterschiedlichen Gesteinskomponenten, das für die benachbarte Rigi typisch ist (Abb. 12).
Transparent und sicher
Das Grundstück, auf dem die im August 2010 eröffnete Filiale steht, liegt an der Bahnhofstrasse im Zentrum von Küssnacht (Abb. 1). Die Nutzung des Quartiers ist durchmischt, auch für den Neubau war ein Wohnflächenanteil von einem Viertel der Gesamtfläche vorgeschrieben. Die umgebende Bebauung stammt aus den 1960er- bis 1980er-Jahren und zeichnet sich durch eine gewisse Beliebigkeit sowie eine Vielfalt an Formen und Farben aus. Mit seiner nahezu quadratischen Form und der zurückhaltenden Materialisierung bildet der viergeschossige Neubau einen Ruhepol im heterogenen Stadtbild.
Leicht von der Strasse zurückversetzt, befindet sich das Gebäude in einer Linie mit den benachbarten Bauten, die Südwestfassade reagiert mit einer Schräge auf die leichte Krümmung im Strassenverlauf. Eine gedeckte Vorzone führt in den Eingangsbereich im Erdgeschoss. Aufgestellte Kunststeinschwerter mit rechteckigem Querschnitt hüllen das Gebäude bis zum Dach ein. Von der Seite betrachtet, erscheinen sie als Fläche und thematisieren damit ein Kernthema einer Bank: Das Spannungsfeld zwischen Öffnen und Schliessen, zwischen Transparenz und Sicherheit. Unterschiede im Rhythmus der Schwerter betonen die einzelnen Geschosse und die verschiedenen Nutzungen: An der Südwestfassade stehen die Schwerter im Erdgeschoss, wo die Kunden die Bank betreten, im Abstand von 2.54 m; sonst variiert ihr Achsabstand zwischen 0.64 m und 1.27 m (Abb. 1).
Gemeinsame Erschliessung, getrennte Funktionen
Auf das Entrée der Bank mit Bancomat folgt die grosse Kundenhalle. An der Nordostseite des Baus sind Einzelbüros, Besprechungs- und Nebenräume angeordnet, in den beiden Obergeschossen gibt es weitere Büros und ein grosses Besprechungszimmer. Die Erschliessung der Räumlichkeiten erfolgt vom Untergeschoss bis zum 2. Obergeschoss über eine einläufige Treppe. Ein zweigeschossiger Einschnitt in der Nordwestfassade – er gliedert den Kubus zusätzlich (Abb. 1, Abb.13) – bildet einen geschützten Aussenraum für die Mitarbeitenden der Bank. Um diesen Aussenraum herum sind im Dachgeschoss die Räume der Wohnung angeordnet, mit den Zimmern an der Nordostseite des Baus und einem grossen Wohnraum gegen Süden. Die 3.5-Zimmer-Wohnung wird über den gemeinsam mit der Bank genutzten Lift und über ein unauffällig an der Nordostseite des Baus platziertes Treppenhaus erschlossen. Ein an der südöstlichen Ecke des Kubus eingebetteter Patio erweitert den Innenraum – selbst die Vorhangschienen sind in diesen Bereich weitergezogen – um ein Viertel der Wohnfläche. Zwischen den beiden funktionalen Einheiten Bank und Wohnung gibt es keinen Sichtkontakt.
Sorgfältig verhüllt
Die Innenräume der Bank zeichnen sich durch eine Eleganz aus, die wesentlich vom sorgfältigen Einsatz der Materialien erzeugt wird. Die Wände sind komplett mit Nussbaumfurnier belegt, Türen und Einbauschränke verschwinden in der zusammenhängenden Holzoberfläche (Abb.15). Der über 100-jährige Baum, der das Furnier lieferte, stammte aus dem luzernischen Napfgebiet und musste wegen eines Sturms gefällt werden, das Holz wurde versteigert. Das aus dem Stamm produzierte Furnier reichte für eine Fläche von mehr als 1000 m², das überschüssige Material wurde für allfällige Reparaturen und Renovationen eingelagert. Der geschliffene Terrazzoboden enthält den gleichen Schwyzer Kies wie die Fassadenelemente.
Dadurch scheint der optische Übergang von Fassade zu Fussboden, von innen nach aussen, nahtlos (Abb. 11). Aus der Farbpalette der Gesteinskörnung im Terrazzo stammen auch die farblichen Akzente der ansonsten schwarzen Möbel: Die Lederober flächen der Servicemöbel im Erdgeschoss sind ochsenblutrot, die Verdunkelungsvorhänge im Sitzungszimmer dunkelgrün gehalten. Der Hintergrund ist mit weissen Vorhängen vor den Glasfassaden und ebenso gestrichenen Decken schlicht gestaltet, gebäudetechnische Elemente sollten möglichst reduziert oder ganz eliminiert werden. Neben den obligatorischen Rauchmeldern finden sich an den Decken daher lediglich die Beleuchtungskörper, die die Architekten speziell für diesen Bau entwickelt haben. Sie gewährleisten eine ausreichende Beleuchtung, ohne zu blenden, – hinter den minim abgehängten Sichtblenden befinden sich zudem die Zugänge für Zu- und Abluft.
Auch die gesamte tragende Konstruktion des Gebäudes in Massivbauweise ist unsichtbar: Die schlaff armierten Betonwände, die Flachdecken und innen liegenden, schlanken Stahlstützen an den Deckenrändern sind eingekleidet und in das architektonische Raster eingegliedert. Die Stahlstützen beispielsweise – gedrungene, mit einem Brandschutzanstrich versehene Vollstahlprofile – sind in Aluminiumbleche eingefasst. Ob ein solches Aluminiumblech hohl ist oder ein tragendes Element beinhaltet, ist nur noch auf Plänen zu erkennen (Abb. 11). Das Verkleiden des Tragwerks mag verwundern, ästhetisch macht es durchaus Sinn: Die regelmässig angeordneten, identischen «Stützen», die wiederum die Abmessungen und den Rhythmus der äusseren Fassadenschwerter übernehmen, schaffen eine visuelle Ruhe im Inneren.
Präzis und scharfkantig
Den gleichen Ansatz verfolgt die Fassade. Hier schaffen einheitlich dimensionierte und materialisierte Elemente ein ausgewogenes Bild. Der Kräftefluss lässt sich in der Anordnung der Schwerter vermeintlich ablesen, tatsächlich tragen die Fassadenschwerter aber nur ausnahmsweise, wie teilweise im Erdgeschoss. Auch diese bautechnisch verschiedenen Elemente behandelten die Planenden nicht unterschiedlich: Die Nagelfluh ist Vorbild für die Materialisierung der Schwerter aus vorfabriziertem Beton – ob sie tragen oder nicht. Die Fassadenelemente, die einen Querschnitt von 35 × 16 cm und eine maximale Länge von 7.20 m aufweisen, bestehen aus hochfestem Stahlbeton. Dieser wird mit einem gebrauchsfertig vorgemischten Bindemittel auf Portlandzementbasis[1] und mit einer Gesteinskörnung von 0–16 mm hergestellt. Durch Zusätze von Fliessmittel, Entlüfter und Schwindreduktionsmittel werden die Verarbeitungseigenschaften optimiert und ein dichtes Betongefüge erzielt.
Der Wasser/Bindemittel-Wert liegt dabei unter 0.2. Durch die hohe Frühfestigkeit des Betons – der Beton für Küssnacht erreichte am 7. Tag eine Druckfestigkeit von 71.44 N/mm2 – konnten die Elemente bereits nach nur sechs Stunden ausgeschalt und nur einen Tag nach dem Betonieren betonwerksteinmässig bearbeitet werden; eine Zwischenlagerung der Ele- mente entfiel. Wegen seiner geringen Porosität konnten die gegossenen und mit vorfabrizierten Körben schlaff armierten Elemente ohne vorheriges Schlämmen direkt geschliffen werden.
Die Vorfabrikanten schliffen und polierten die Elementoberfläche mit einer eigens für dieses Projekt entwickelten Maschine mit fahrbarem Schleifkopf. Aus architektonischer Sicht war es dabei wichtig, dass die vielfarbigen Rundkiese des 16er-Korns aus der Innerschweiz nicht nur angeschliffen wurden, sondern dass diese auch in genügend grosser Form in Erscheinung traten – wie es bei Nagelfluh der Fall ist. Indem die Vorfabrikanten die Schalung für die Elemente auf jeder Seite etwa 3 bis 4 mm grösser erstellten als das definitive Sollmass und das Übermass anschliessend abschliffen, konnten sie diesen ästhetischen Anspruch erfüllen. Das problematische und bei diesem Beton ausgeprägtere Schwindmass konnte so ebenfalls aufgefangen werden. Entsprechend präzise mussten jedoch die Einlagen in die Schalung versetzt werden.
Der Self Compacting Concrete (SCC) ermöglichte in diesem Fall eine effiziente Vorfabrikation, wodurch sich sein Einsatz rechtfertigte beziehungsweise die Vorfabrikation erst rentabel wurde. Ausserdem lassen sich mit diesem Beton respektive mit seinen Materialeigenschaften unter anderem die scharfen Kanten und die glatte Oberfläche der Schwerter erklären – die Präzision und die Geschmeidigkeit beeindrucken auch aus der Nähe.
Angemessen selbstbewusst
Mit dem Neubau erhält die Raiffeisenbank einen repräsentativen Firmensitz, der sich baulich im heterogenen Umfeld behauptet, ohne den Strassenzug zu dominieren. Die aussergewöhnliche Präzision in Projektierung, Planung und Ausführung – vor allem in der Verwendung des Materials durch die verschiedenen Massstäbe hindurch – sorgt für die starke Präsenz, die der Bau an seinem Standort am Fuss der Rigi entwickelt.
Anmerkung:
[01] Flowstone der Firma Dyckerhoff. Dieses Produkt ist, neben Portlandzementklinker und Sulfatträgern (wie Gips), aus Hüttensand und Quarzmehl zusammengesetztTEC21, Fr., 2011.05.13
13. Mai 2011 Tina Cieslik, Clementine Hegner-van Rooden
Massgeschneidertes Lehmhaus
Von 2007 bis 2009 realisierten die Bieler spaceshop Architekten im solothurnischen Deitingen ein besonderes Einfamilienhaus. Der Bau dient als Experimentierfeld: Abwasserentsorgung und Energieerzeugung funktionieren nahezu autark, die Mehrheit der Baumaterialien – Lehm, Stroh, Bruchsteine und Holz – stammt aus einem Umkreis von maximal 10 km und wurde unveredelt weiterverwendet.
Die Anfänge des Projektes reichen bis ins Jahr 2004 zurück. Damals, nach dem Auszug seiner Kinder, konkretisierte Bauherr Ueli Flury seinen Wunsch nach weniger Wohnfläche. Als Baugrund bot sich der Garten seines damaligen Wohnhauses an, eines ehemaligen Bauernhauses mit angebauter Gärtnerei in der Dorfkernzone. Die Ausnützungsziffer des Grundstücks war noch nicht erreicht. Wichtiger als das eigentliche Gebäude war dem Bauherrn aber zunächst das bauökologische Konzept. Als Gärtner daran gewöhnt, mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten und in möglichst geschlossenen Kreisläufen zu denken, wollte er diese Philosophie in den Bau einfliessen lassen. Gemeinsam mit dem befreundeten Landschaftsarchitekten Hans Klötzli und dem Bauökologen Ryszard Gorajek vom Berner Atelier für Architektur und Bauökologie AAB entwickelte er daher Lösungen für ein autark funktionierendes Gebäude mit einem möglichst geringen Aufwand an grauer Energie.
Neben den Baumaterialien umfasste der Ansatz auch Energieerzeugung und Abwasserentsorgung. Rasch wurde klar, dass der Aufwand relativ hoch ist und für einen Einpersonenhaushalt wenig Sinn ergibt. Man entschied sich daher, den Neubau in Bezug auf Fläche und Kapazität der technischen Infrastruktur für vier Personen zu konzipieren. Um die sorgfältige bauökologische Planung durch eine angemessene architektonische Qualität zu ergänzen, lud Bauherr Flury im Jahr 2006 vier Büros zu einem Studienauftrag ein, den die Bieler spaceshop Architekten für sich entschieden.
Bewegung durch Aussen- und Innenraum
Das Siegerprojekt beruht auf der Idee einer «promenade architecturale», auf der man sich zunächst von der Strasse aus entlang einer bestehenden Palisade in den hinteren Bereich des Gartens und ins Haus und anschliessend durch die seitlich gestaffelten Räume wieder in den Garten bewegt. Dieser Ablauf inszeniert unterschiedliche Ein- und Ausblicke in bzw. auf Haus und Grundstück und überspielt auch die geringe Grundfläche des pavillonartigen Baus, der nur drei Räume umfasst. Die beiden L-förmigen Lehmwände, die nahtlos vom Innen- in den Aussenraum übergehen, verweben die beiden Sphären nicht nur räumlich, sondern auch konstruktiv (Abb. 6). Wegen des hohen Grundwasserspiegels steht das Haus auf einem Sockel, was die Idee der «promenade» aufgrund der unterschiedlichen Bodenniveaus verstärkt. Betreten wird das Gebäude im zentralen Wohn-/Essbereich, der auch die Küche beherbergt und im Osten vom privaten Schlaf-/Badbereich sowie im Westen von einem Gartenzimmer flankiert wird. Das wesentliche Element der Küche ist der Stückholzherd, der sowohl zum Kochen als auch zum Heizen und zur Warmwassererzeugung dient. Er erwärmt das Wasser in einem Boiler und einem Wasserspeicher im Keller, von wo es an die Heizkörper in den Räumen abgegeben wird. Die dafür pro Jahr erforderlichen rund 10 Ster Holz stammen aus dem dorfeigenen Wald und werden vom Hausherrn zugeschnitten. Der relativ hohe Verbrauch ergibt sich aus dem Bedarf für die Warmwassererzeugung sowie aus den aufgrund des geringen Strohanteils eher mässigen Dämmwerten der Lehmwände.
Das Material gibt den Takt an
Nachdem das Raumprogramm und dessen konstruktive Umsetzung im Sommer 2007 feststanden, wurden zunächst die Strohballen für die Dämmung von Dach und Boden erworben: Die Landwirte verwenden unterschiedliche Maschinen für die Strohballenproduktion, dementsprechend unterscheiden sich deren Masse. Die Grösse der Strohballen bildete so das Ausgangsmodul für die gesamte Konstruktion. Auch das Fichtenholz aus dem Deitinger Burgerwald brauchte seine Zeit: Dem Mondkalender entsprechend wurde es Ende Oktober 2007 geschlagen. Um den Holzabfall so gering wie möglich zu halten, beschränkte man sich zudem auf die Normmasse für Holzbalken.
Der Bauherr wünschte sich bereits zu Beginn ein Lehmhaus. Neben der hohen Wärmespeicherfähigkeit des Materials sprach auch das angenehme Raumklima in Lehmhäusern mit einer relativ hohen, konstanten Luftfeuchtigkeit für diese Wahl. Lehm absorbiert zudem Gerüche – was sich bei der Nutzung der Wohnküche ohne Dunstabzug bereits als grosser Vorteil erwiesen hat. Die monolithischen Lehmwände sind auch visuell das dominierende Material des Baus. Sie sind in Lehmwellerbau-Technik errichtet, einer Massivlehmkonstruktion, die bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem in Ostdeutschland bei landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden zum Einsatz kam.[1] Dafür werden Stroh und Lehm in einem Mischungsverhältnis von ca. 25 kg Stroh auf 1 m³ Lehm gemischt, ohne Schalung mit einer Mistgabel zu einer Wand von bis zu 80 cm Höhe aufgeschichtet und anschliessend mit einem scharfen Spaten abgestochen (Abb. 3). Die Dicke der Wände von 80 cm ergab sich aus dem zu erreichenden Dämmwert – im Gegensatz zum zunächst favorisierten Stampflehm konnten mit dieser Technik die kantonalen Richtwerte eingehalten werden (s. Kasten S. 33). Das Stroh bietet zudem einen Witterungsschutz: Durch das Abstechen des Lehms sind die Halme von oben nach unten gerichtet, sodass Niederschläge ablaufen können und der dahinter liegende Lehm geschützt ist. Das Haus in Deitingen besteht aus vier horizontalen Schichten, die um das ganze Gebäude laufen. Konstruktiv geschützt werden die Lehmwände zudem durch bis zu 1.50 m grosse Dachüberstände. Das Dach und der Boden bestehen aus einer aufgedoppelten Balkenlage, in deren Zwischenräume die Strohballen als Dämmung gepresst wurden (Abb. 7). Die Dachhaut aus synthetischem Kautschuk ist mit einem Ziegelschrotsubstrat bedeckt und begrünt. Abgetragen werden die Dachlasten über in die Lehmwand eingelassene Holzstützen. Dieses Tragwerk ermöglichte zum einen den Bau eines Daches zum Schutz der Lehmwände während der Herstellung (Abb. 2). Zum anderen konnte so auf das Schwinden des Lehms reagiert werden: Während Fenster und Türen fest in die Holzkonstruktion montiert waren, konnten sich die Wände während des Trocknens innerhalb der Konstruktion bewegen, das Schwindmass betrug dabei etwa 10 cm. Ein weiteres lokales Baumaterial findet sich im Keller: Über Jahre vom Bauherrn gesammelte ehemalige Grab- und Brückensteine bilden die Kellermauern und den Sockel des Hauses. Um die graue Energie minimal zu halten, sind sie unbearbeitet mit Lagerfugen aus Trasskalkmörtel vermauert – ein reines Trockenmauerwerk im Keller akzeptierte der Tragwerksplaner nicht. Der Kellerboden besteht aus verdichtetem Mergel. Neben seiner Funktion als Lagerraum für Wein, Obst und Gemüse dient der Keller auch als Standort der Gebäudetechnik (Kompost-WC, Warmwasserboiler).
Graue Energie
Die Mehrheit der Baumaterialien stammt aus einem Umkreis von maximal 10 km und wurde roh belassen, um den energetischen Aufwand für Herstellung und Transport möglichst tief zu halten. Ausnahmen bilden die Flachdachabdichtung aus synthetischem Kautschuk, das Dachrandblech aus verzinntem Kupfer und die Doppelisolierverglasung. Auf Klebstoffe, Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen wurde zugunsten eines gesunden Innenraumklimas verzichtet.
Die Bilanz der grauen Energie des Gebäudes, in die auch Lastwagentransporte und Maschineneinsätze eingerechnet wurden, ergibt mit 17.4 kWh/m2a einen Wert, der deutlich unter dem Zielwert des SIA-Effizienzpfades von 30 kWh/m2a liegt – dies trotz Eingeschossigkeit und relativ hohem Kelleranteil. Nicht eingerechnet ist in diesen Wert allerdings der Energieaufwand für die Trocknung der massiven Lehmwände mit Ölheizungen. Dieser war fast fünf Mal so hoch wie die graue Energie der Wände selbst (ohne Holzständer gerechnet), hätte aber mit einer besseren Zeitplanung vermieden werden können. Durch wetterbedingte Verzögerungen beim Bau der Lehmwände blieb vor dem gewünschten Bezugstermin nicht mehr genug Zeit für eine natürliche Austrocknung des Lehms.
Geschlossene, lokale Kreisläufe
Neben der Minimierung der grauen Energie lag den Planern vor allem der Gedanke der Autarkie des Gebäudes am Herzen. Die Umsetzung einer autarken Energieversorgung stellte sich in der Praxis jedoch als schwierig heraus. Da sich das Haus in einem Grundwasserschutzgebiet befindet, schied die Nutzung von Grundwasserwärme von vornherein aus. Geringes Windaufkommen und eine relativ hohe Bebauungsdichte sprachen gegen die Nutzung von Windenergie. In Erwägung gezogen wurde hingegen eine Biogasanlage, in der man die beim WC anfallenden Fäkalien sowie Feststoffe aus der Kläranlage hätte vergären und daraus Energie erzeugen können. Kleine, für einen Einzelhaushalt geeignete Biogasanlagen gibt es allerdings nur in Einzelanfertigung. Sie sind zudem unterhaltsintensiv. Daher verwarf das Planungsteam diese Option. Als weitere Variante für die Energieversorgung prüfte man die Nutzung von Wasserkraft. Der an der Grundstücksgrenze verlaufende Bach hat zwar ein geringes Gefälle, aber einen relativ hohen konstanten Abfluss, mit dem man ein Wasserrad hätte antreiben können. Diese Idee scheiterte jedoch an Bedenken des Fischereiverbandes.
Deshalb entschied man sich schliesslich für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des benachbarten Bauernhauses. Für eine autarke Energieversorgung hätte es eine Batterie gebraucht, die aber teuer und energieintensiv in der Herstellung ist. Der produzierte Strom wird daher komplett ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Dafür bezieht der Bauherr wiederum Ökostrom aus dem Netz, dank energieeffizienten Geräten und einem Leben ohne Fernseher und PC aber nur ein Viertel der von der Fotovoltaikanlage produzierten Menge. Der überschüssige Strom kompensiert rechnerisch mit der Zeit die im Gebäude steckende graue Energie (siehe Kasten S. 33).
Autark ist das Gebäude hingegen beim Wasserkreislauf. Das Grundstück verfügt über eine eigene Quelle, die den Bauherrn mit Wasser in Trinkwasserqualität versorgt. Das Grauwasser, also das Abwasser aus Küche, Waschbecken und Badewanne, wird in einer Pflanzenkläranlage neben dem Gebäude gereinigt und dann als Giesswasser in der benachbarten Gärtnerei verwendet (Abb. 9). Da die 2 m lange und 8 m breite, mit Schilf bewachsene Kläranlage nicht wie sonst üblich im Boden versenkt werden konnte, um ein genügend grosses Gefälle zur Gärtnerei hin zu erhalten, trennt sie den Eingangsbereich nun optisch vom Garten. Das gereinigte Wasser erreicht gemäss Messung des Kantons Trinkwasserqualität. Trotzdem hätte man es wegen der Ausweisung des Grundstückes als Grundwasserschutzgebiet nicht im Garten versickern lassen dürfen. Nur die Synergie mit der Gärtnerei ermöglichte also den autarken Wasserkreislauf.
Das WC funktioniert ebenfalls ohne Anschluss an die öffentliche Kanalisation. Die Fäkalien werden in einem Kompostbehälter im Keller gesammelt. Die Zugabe von Holzschnitzeln verbessert das Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältnis des Komposts. Das anfallende Abwasser verdunstet grösstenteils, der Rest muss alle zwei bis drei Wochen abgelassen werden und wird vom Bauherrn zur Düngung des Gartens verwendet. Der Kompostbehälter muss nur rund zweimal pro Jahr geleert werden. Das vorkompostierte Material wird in einem Silo weiterkompostiert und kann schliesslich als Gartenerde verwendet werden.
Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus übernehmen
Da dort, wo ein Kanalisationsnetz besteht, der Anschluss von Gebäuden an dieses Netz Pflicht ist, waren der autarke Abwasser- und WC-Kreislauf nur dank einer Ausnahmebewilligung der Behörden möglich. Wäre der Anschluss an die Kanalisation nicht die einfachere und möglicherweise auch aus Sicht der grauen Energie günstigere Lösung gewesen? Einen genauen Vergleich der grauen Energie habe man nicht gemacht, erklärt Gorajek. «Vielleicht ist es mitten im Ort schon weniger sinnvoll, autark zu agieren, als beispielsweise auf einer Alp. Es ging uns bei diesem Projekt aber vor allem um die Eigenverantwortung für das gesamte Haus und alles, was dadurch an Abfällen entsteht.» Statt das Abwasser in der Kanalisation zu entsorgen und Reinigung und Bau der entsprechenden Infrastruktur anderen zu überlassen, übernehme man das selbst. «Und am Ende seiner Lebensdauer kann man das Haus mit gutem Gewissen verlassen und weiss, dass es dem Erdboden gleich wird, wenn es zusammenbricht.»
Literatur:
[01] Christoph Ziegert: Lehmwellerbau. Konstruktion, Schäden und Sanierung. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2003TEC21, Fr., 2011.05.13
13. Mai 2011 Claudia Carle, Tina Cieslik