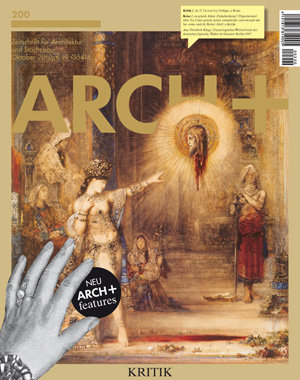Editorial
„Kritik der unreinen Vernunft“
Architekturkritik als soziale Praxis
SZ: Sie analysieren die Unterhaltungskunst und betreiben sie zugleich. Ist zu viel Theorie für einen Künstler nicht die Pest?
Chilly Gonzales: Hm, das ist das Halt-die-Klappe-und-spiel-Klavier-Argument.
Das Argument, das der in den 90er Jahren im Underground-Berlin bekannt gewordene Musiker und kritischer Geist der elektronischen Indiepop-Szene Chilly Gonzales hier in unnachahmlicher Weise aufspießt, entspricht einer weit verbreiteten Haltung. Es erinnert an Rudolf Schwarz’ berühmtes Diktum „Bilde Künstler, rede nicht“, mit dem dieser Goethe zitierend eine wichtige Debatte der deutschen Nachkriegsarchitektur bestimmte und das sich als äußerst langlebig erwies. Ist diese unintellektuelle Haltung der Grund dafür, dass mit Ausnahme von zwei, drei architekturbezogenen Schriften von Martin Heidegger, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas deutsche Beiträge zur Architekturtheorie weltweit nicht wahrgenommen wurden? Teilt in diesem Sinne die deutsche Architekturtheorie das Schicksal der deutschen Architektur nach 1945, die – mit Ausnahme von Egon Eiermann, Oswald Mathias Ungers und Frei Otto – trotz höchster technischer Performanz kaum internationale Bedeutung hat?
Woher der Hang zur Unintellektualität stammt, haben wir im Gespräch mit dem Architekturhistoriker Thilo Hilpert nachzuvollziehen versucht (s. S. 74ff.). Er sieht ihn nicht zuletzt als Ergebnis des Sonderwegs der deutschen Architekturzeitschriften nach 1945. Obwohl es bescheidene Ansätze zur Eröffnung eines kritischen Diskurses gab, dominierte ein Verzicht auf konzeptuelles Denken alle wichtigen Zeitschriften, seien es Baukunst und Werkform, Bauwelt, Baumeister oder Bauen und Wohnen. Während in England, Frankreich und Italien schon in den 1950er Jahren die Aufarbeitung der Moderne und eine kritische Auseinandersetzung mit ihr begannen, wurden in der Bundesrepublik in Abwehr der vorangegangenen nationalsozialistischen Exesse die produktiven Kräfte fast ausschließlich durch die Rekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft gebunden. Gefangen in diesem Prozess konnte man deshalb auf die wiedererwachende europäische Architekturdiskussion nicht anders als mit Aversion reagieren: Man lief Sturm gegen alles vermeintlich Avantgardistische. Nur im Sinne eines psychischen Wiederholungszwangs lässt sich deshalb nachvollziehen, dass man sich die Zukunft der Stadt und Gesellschaft nur in den Konturen der politisch-kulturellen Kämpfe der 1920er vorstellen konnte. Erstickt wurden dadurch alle weiterführenden, die Industriegesellschaft auch in der Bundesrepublik transzendierenden Fragen, mit der Folge einer Theorievergessenheit und Konzeptionslosigkeit der tragenden Architekturzeitschriften, deren Auswirkungen bis in die Gegenwart zu spüren sind.
Erst mit der Interbau Berlin 1957 öffneten sich die deutschen Architekturzeitschriften zaghaft für die post-heroische Phase der Moderne nach 1945, erst mit der IBA 1984 für den postmodernen Diskurs. Schließlich ist erst Anfang der 1980er Jahre mit Daidalos eine eigenständige Zeitschrift zur Architekturtheorie entstanden. Die einsetzende Internationalisierung der Publizistik blieb aber im wesentlichen eine nachholende Bewegung gegenüber den architektonischen und architekturtheoretischen Fortschritten andernorts. Sie diente mehr dem Nachholbedarf nach innen als dass sie selbst Tendenzen setzen konnte. Es fehlte ihr, aufgrund der nach 1945 getroffenen Richtungsentscheidungen durch die bundesdeutsche Gründergeneration mit Alfons Leitl, Rudolf Schwarz und Otto Bartning, schlicht an inhaltlicher Substanz (vgl. Thilo Hilpert im Gespräch).
Intellektualität befördert zwar eine kritische Praxis, sie ist aber keine hinreichende Bedingung für Kritik. Nach Michel Foucault sollte man Kritik auch nicht mit Theorie oder Wissen verwechseln: „Die kritische Ontologie unserer selbst darf beileibe nicht als eine Theorie, eine Doktrin betrachtet werden, auch nicht als ein ständiger, akkumulierender Korpus von Wissen; sie muss als eine Haltung vorgestellt werden.“ Wenn aber Kritik nicht mit Theorie und Wissen gleichzusetzen ist, welche Rolle spielt dann Architekturtheorie für die Architekturkritik? Diese Frage betrifft den Kern des Selbstverständnisses von ARCH als theoretisch und konzeptionell ausgerichteter Zeitschrift. Heißt das, dass Theorie gänzlich verzichtbar ist und das „Halt-die-Klappe-und-spiel-Klavier-Argument“ letztendlich zutrifft? Dass dies mitnichten der Fall ist, beschreibt Thomas Lemke in seiner Darstellung des Kritik-Begriffs von Foucault: „Die Feststellung, dass es keine notwendige Verbindung zwischen Wissen und Kritik gibt, bedeutet […] nicht, dass der Theoriebildung keine kritische Rolle zukommen kann. Im Gegenteil spielt die Theorie eine wichtige Aufgabe in einem Unternehmen der Problematisierung, weil sie die Ansprüche auf Universalität überprüft, um die Elemente von Willkürlichkeit und Kontingenz in ihnen aufzuzeigen. Damit kann Theorie, wenn sie ihre eigenen historischen Bedingungen reflektiert, die Rolle einer „Gegenwissenschaft“ spielen, die […] den Weg für eine Veränderung sozialer Praktiken bereitet.“ (Siehe S. 110)
Theorie ist in diesem Sinne kein Mittel zur Rationalisierung, sondern zur Reflexion von Handlungen, wodurch sie zu einem Instrument des Widerspruchs mutiert. Nach Thomas Lemke „verschiebt sich der Ansatzpunkt der Kritik, die ihre Grundlage nicht mehr in der „richtigen Theorie“ hat, sondern sich in einer reflektierten Entscheidung oder „Option“ manifestiert. Hatte Kant eine „Kritik der reinen Vernunft“ unternommen, um ihr Vermögen und ihre universellen Grenzen aufzuzeigen, so praktiziert Foucault eine „Kritik der unreinen Vernunft“, die die Grenzen der Erkenntnis als historische Grenzen unseres geschichtlichen Seins begreift.“ (Siehe S. 109)
In diesem Sinne ist die in dieser Ausgabe schlaglichtartig dargestellte Geschichte der Kritik kein Versuch einer allgemeingültigen Klärung dessen, worum es sich dabei handelt, sondern vielmehr eine offene Auswahl an historischen Optionen kritischer Standpunkte. Oder, um es erneut mit Lemke zu sagen: „Wenn sich Kritik nicht mehr durch den Anspruch auf Universalität und „Letztbegründung“ ausweisen kann, wenn sie niemals den Zustand einer „Sättigung“ erreicht, sondern eine Praktik ist, deren Aufgabe niemals beendet ist, dann kann diese historische Kritik nur eine „experimentelle“ sein.“ (Siehe S. 110)
Kritik erschöpft sich demnach nicht in einer negativen, sich auf eine universale Rationalität berufende „Aufklärung“ von etwas, seien es Illusionen oder Irrtümer. Vielmehr ist sie eine „positive“ Praxis, die (Handlungs-)Optionen eröffnet. Als Praxis muss sie immer wieder eingeübt, als Experiment immer wieder gewagt werden. Wenn in diesem Heft die Kritiker der architektonischen Moderne bewusst überrepräsentiert sind, dann möchten wir den offenen Charakter des Projekts Moderne unterstreichen.
Woran lässt sich Kritik dennoch festmachen? Oder, mit Foucault gefragt, „Was ist Kritik?“ Und schließlich, in unserem Fall, „Was heißt Kritik für Architekturzeitschriften?“ Mit der Auswahl der Kritiker und Projekte in der vorliegenden Ausgabe zeigen wir unterschiedliche Ausprägungen und Möglichkeiten der Kritik und folgen dabei Foucaults Definition, wonach „Kritik weniger ein neutral-theoretisches Wissen (repräsentiert) als dass sie eine ethisch-politische Haltung verkörpert“.
Demnach müssen wir die wohlfeile Klage über das Fehlen von Theorie und Wissen relativieren, wenn wir dem heutigen Mangel an Kritik auf den Grund gehen wollen. Die Kritik wird sogar gänzlich verschwinden, wenn es nicht gelingt, die „Haltung der Kritik“ (Foucault) mit den neuen Formen von Diskurs und Öffentlichkeit in Einklang zu bringen. Aus der Perspektive des Zeitschriftenmachens verschränkt sich die problematische Aussicht der Kritik seit der Zeitenwende von 2000 mit der Krise des Mediums Zeitschrift selbst. Seit etwa dieser Zeit befinden sich die Auflagenzahlen der Architekturzeitschriften im stetigen Sinkflug. Sinkende Abozahlen und zurückgehende Einnahmen gehören seitdem zum Alltagsgeschäft.
An die Stelle der Zeitschrift tritt das Netz. Es löst die Zeitschrift als Informationsquelle ab. Sie tritt in den Hintergrund, wird im besten Sinne zum Zweitmedium nach dem Netz. Sie verliert dadurch ihre ursprüngliche Funktion als aktuelles Informationsmedium und kann, wenn überhaupt, nur noch als Kommunikationsmedium überleben. Dazu bedarf es neuer Formen inhaltlich-medialer Vermittlung. Denn das Netz liefert die Information in Echtzeit ins Haus. Wie dagegen die Zeitschrift als ein über ihre kommunikative Funktion hinaus wirkendes Medium der Kritik auszugestalten sei, sucht ARCH in der Praxis zu erproben: durch eine neuartige Verschränkung von Zeitschrift, Webauftritt und öffentlicher Performanz. So haben wir in jüngster Zeit zur Ausgabe „Post-Oil-City“ eine Ausstellung kuratiert. Mit dieser Ausgabe initiieren wir zudem die Veranstaltungsreihe ARCH features als Plattform für junge Architekten und Kritiker. Dies wird durch Newsletter, Präsenz in sozialen Netzwerken und einen Relaunch der Homepage begleitet. Die Zeitschrift wird dadurch zu einem multi-medialen Projekt. Wie in diesen Medien Kritik als Haltung in transformierter Form weiterlebt und dadurch eine neue Öffentlichkeit für die Architekturkritik geschaffen werden kann, wird über den Erfolg oder Misserfolg von ARCH , ARCH features und archplus.net entscheiden (Vgl. Relaunch von archplus.net, S. 205; ARCH features BARarchitekten).
Ausgespart wurde bis hierhin die inhaltliche Ausformung der Kritik. Stattdessen haben wir uns auf die Richtungsentscheidungen im Nachkriegsdeutschland konzentriert, um zu zeigen, wie sich der deutsche Sonderweg entwickeln konnte. Während die europäischen Nachbarstaaten begannen, am Vorabend der sich in den 1960er Jahren abzeichnenden nach-industriellen Gesellschaft, die Architekturkritik für Fragen der Stadt, Geschichte und Gesellschaft zu öffnen, um sie an die sich verändernden Produktionsbedingungen von Architektur anzupassen, erschöpfte man sich hierzulande in der durch die Kriegszerstörungen erzwungenen nachholenden Wiederherstellung der Industriegesellschaft. Deren Anforderungen regierten den Wiederaufbau der Städte, der zwar dem technischen State of the art entsprach, aber kaum einen Gedanken an die mit den 1960er Jahren manifest werdenden Anforderungen der post-fordistischen Gesellschaft verlor. Dabei kamen hier andere Formen von Produktion und Mobilität, ja von Leben ins Spiel, die nicht mehr nach dem Prinzip von Leistung und Entlohnung funktionieren. Eine neue Lebensweise stand auf der Agenda, die sich zuerst in der Rock- und Popkultur andeutete und von dort in benachbarte Felder auswirkte.
Demgegenüber legte die architektonische Kultur hierzulande immer wieder noch einmal die alte Platte der Industriegesellschaft auf und spielte das bekannte Lied: konservativ gegen modern, rechts gegen links. Der kalte Krieg nach innen. Und so musste man auch die Kritik der ’68er missverstehen und in ihnen nicht die Vorboten post-materieller Lebensweisen erkennen, sondern den Angriff auf die bürgerliche Gesellschaft überhaupt. Und mit entsprechender Verve wurden sie dann auch bekämpft. Wobei eingeräumt werden muss, dass sich die ’68er-Bewegung politisch im gleichen Sinne missverstanden. Ihre Wirksamkeit betraf vielmehr den kulturellen Bereich, indem sie post-materielle Lebensformen provozierten, die sich heute durchgesetzt haben.
Sprechen wir von den Perspektiven der Kritik heute und von der Architekturkritik im Besonderen, dann müssen wir den Blick weiten und sowohl nach außen als auch nach innen richten. Nach innen, um die Kritik an den Fragen der post-fordistischen Gesellschaft auszurichten, in der Stadt und Architektur, Geschichte und Gesellschaft eine neue Bedeutung gewinnen bzw. schon gewonnen haben. Dieser neue Blick auf die Stadt führt in der Regel dazu, dass der Moderne Versagen vorgeworfen wird. In der Tradition einer konservativ gefärbten Kritik an der Moderne, die geschickt die bürgerlichen Ängste vor Revolten mit dem Anspruch der Moderne nach gesellschaftlicher Veränderung vermischt, wird die Moderne pauschal für die Fehlentwicklungen der Industriegesellschaft haftbar gemacht. Stattdessen sollte man in der Moderne das unvollendete Projekt dieser Gesellschaft sehen: die uneingelösten Versprechen nach Freiheit, Selbstbestimmung und Entfaltung des Individuums. Daraus resultiert die Verkennung des Überschusses, der in den Konzepten und Projekten der Moderne angelegt ist, so schlecht sie im Einzelnen auch verwirklicht sein mögen. In diesem Sinne ist die Moderne das Beispiel par excellence für eine projektive Praxis. Und Architektur ist per se projektiv. Nach außen müssen wir den Blick hingegen wenden, um die Theoriedefizite der Nachkriegszeit zu kompensieren. Dadurch soll eine selbstreflexive Kritik ermöglicht werden. Vor diesem doppelten Hintergrund lässt sich die Architekturkritik als eine theoretisch fundierte, selbstreflexive und projektive Praxis verstehen.
Diese Kritik muss theoretisch fundiert sein, weil sie es mit einem Phänomen zu tun hat, das, in den Worten von Ole W. Fischer, „sozial konditioniert ist und als solches wiederum die Gesellschaft formt; diese Kritik ist selbstreflexiv, weil sie ihren eigenen (historischen) Standpunkt, ihre Methoden und ihre gesellschaftliche Rolle (als Produzent von Texten und Bewertungen) mitdenkt; und diese Kritik ist projektiv, weil sie Aktivitäten anregt, Alternativen vorschlägt und Handeln vorausbestimmt. Dieser Wunsch nach Veränderung, dieser Zug zur Praxis macht aus ihr eine produktive Kritik.“ (Siehe S. 123)
Für Zeitschriften bedeutet dieses Verständnis von Kritik als theoretisch fundierte, selbstreflexive und projektive Praxis, dass sie sich einem neuen Praxiszusammenhang stellen müssen, in dem Stadt und Architektur, Kritik und Multi-Medialität, Politik und Öffentlichkeit jeweils Glieder einer Kette von „Übersetzungen“ (Bruno Latour) sind. Und für ARCH bedeutet das, dass sie ein Glied in dieser Kette ist, inhaltlich, medial und praktisch-politisch.
von Nikolaus Kuhnert, Anh- Linh Ngo
Team: Cornelia Escher, Nicole Opel sowie Steve Danesch, Susanne Jany und Marco Rüdel