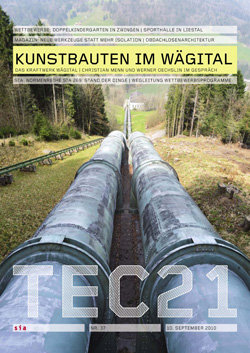Editorial
Der Bezirksrat March im Kanton Schwyz wartet zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser TEC21-Ausgabe auf ein Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege. Es soll eine Empfehlung für oder gegen den Abbruch der Schrähbachbrücke am Wägitaler See liefern. Die historische Brücke wurde vom Berner Bauingenieur Robert Maillart (1872 – 1940) im Jahre 1924 erbaut, als das Wägital nach dem Bau des Staudamms Schräh geflutet wurde und neue Erschliessungswege nötig waren. Bald nach der Fertigstellung erlitt sie Frostschäden. Um die versteifte Stabbogenbrücke besser vor Wasserzutritt zu schützen, mauerte man die Öffnungen zwischen Bogen und Versteifungsträger zu. Das Erscheinungsbild der Brücke wurde dadurch grundlegend verändert, schrieb Jürg Conzett im jahr 2009.[Jürg Conzett: «Valtschielbrücke bei Donat». 1. Oktober 2009] Inzwischen äussert der Ingenieur, der den Schweizer Pavillon an der Biennale in Venedig mit dem Thema «Landschaft und Kunstbauten» bespielt, in einem Gespräch mit TEC21 (erscheint in einer späteren TEC21-Ausgabe) noch eine andere Erklärung für den Eingriff. Zugetragen wurde sie ihm von Eugen Brühwiler, Professor an der EPFL. Danach waren die Zumauerungen ein Zugeständnis an die Ästhetik... Die Schrähbachbrücke ist nicht die einzige Maillart-Brücke im Wägital, ein halbes Dutzend weitere stehen an den Ufern des Speichersees. Unterhalb des Staudamms findet man zudem weitere Ingenieurkunstbauten als Zeugen der Wägitaler Technikgeschichte, alle erstellt für das Kraftwerk und verwachsen mit der Umgebung. Jedes Einzelstück des Ensembles präsentiert sich, als stünde es in einem Freilichtmuseum (vgl. S.22ff.). Das Gesamtbild, das sich aus Umgebung, Einzelelementen, Ensemble und Geschichte ergibt, ist denn auch Thema in «Gleichgewicht ist einer der schönsten Begriffe». Christian Menn und Werner Oechslin diskutieren über den Erhalt der Schrähbachbrücke, wobei dieses Frühwerk von Maillart exemplarisch für viele historische Bauten steht. Über den Entscheid der Eidgenössischen Denkmalpflege wird wohl wie im Vorfeld weiterhin kontrovers diskutiert werden, denn die Wertschätzung einer historischen Baute ist letztlich auch subjektiv geprägt. Man sollte aber eines nicht vergessen: Historische Bauten sind wie Jahrringe eines Baumes, sie geben Auskunft über die Vergangenheit, ermöglichen erst die Definition der Gegenwart und geben einer Umgebung ihre Identität. Dieses Erbgut der Gesellschaft lässt sich als Inspirationsquelle für weitere Entwicklungen betrachten, denn jede Beurteilung, auch unsere heutige, geschieht aufgrund der Einsicht in einem bestimmten Moment unserer Geschichte – und ist so verstanden willkürlich. Deshalb sollten denkmalpflegerische Entscheide uneigennützig getroffen werden.
Clementine van Rooden
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Doppelkindergarten in Zwingen BL | Sporthalle in Liestal BL
10 PERSÖNLICH
Marc Wijnhoff: «Es war ein strategischer Entscheid»
12 MAGAZIN
Leserbrief | Bücher | Neue Werkzeuge statt mehr Isolation | Fernwärmenetze dank Bundesgeld | Nachhaltig mobil mit Holz und -Mist | Replik oder Kopie? | Obdachlosenarchitektur
22 DAS KRAFTWERK WÄGITAL
Aldo Rota Vor mehr als 85 Jahren wurde das Wägital im Kanton Schwyz geflutet. Zahlreiche Ingenieurkunstbauten mussten errichtet werden. Die meisten von ihnen sind heute noch weitgehend im Originalzustand erhalten.
29 «GLEICHGEWICHT IST EINER DER SCHÖNSTEN BEGRIFFE»
Judit Solt und Clementine van Rooden Christian Menn und Werner Oechslin im Gespräch über Ingenieurkunstbauten, deren Erhalt oder Abriss – und ob die Wägitaler Schrähbachbrücke von Robert Maillart erhalten bleiben soll oder nicht.
37 SIA
SIA 269: Stand der Dinge | 100 Jahre Sitterviadukt | Wegleitung Wettbewerbsprogramme | «15n» 2011 und neue SIA-
Angebote | Aktuelle Kurse SIA-Form | Mit «Spacespot» in die Schule
44 FIRMEN
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Das Kraftwerk Wägital
Im August vor 86 Jahren war die Gewichtsstaumauer in der Felsenge der Schräh gebaut, und das Wägital in der südöstlichen Ecke des Kantons Schwyz wurde geflutet. Ein neues Landschaftsbild entstand. Deshalb wurden rund um den Speichersee und im vorderen Wägital für das zweistufige Kraftwerk Wägital zahlreiche Ingenieurkunstbauten erstellt. Es lohnt sich, deren Geschichte aufzurollen und sie, als weitgehend im Originalzustand in Betrieb stehende Zeugen der Technikgeschichte, näher zu betrachten.
Vor einem Menschenalter, am 9. August 1924, wurde die 1502 geweihte Kirche von Innerthal, zuhinterst im Schwyzer Wägital, gesprengt. Zuvor waren bereits das Pfarrhaus, das Schulhaus, die Sägerei und gegen 100 weitere Gebäude der abgelegenen Gemeinde dem Erdboden gleichgemacht worden. Die für die damalige Zeit in der friedlichen Schweiz ungewöhnliche Zerstörung eines ganzen Dorfs, die für die Anlage des Stausees Innerthal (heute als Wägitaler See bekannt) erforderlich war, erregte einiges Aufsehen, zumal für rund 80 Einwohnerinnen und Einwohner keine Ersatzbauten erstellt werden konnten und diese deshalb gezwungen waren, aus Innerthal abzuwandern. Immerhin wurden Kirche, Pfarrhaus, Schulhaus, Gasthaus, Sägerei und zahlreiche Wohn- und Landwirtschaftsbauten oberhalb des Seespiegels neu erstellt, sodass Innerthal heute eine intakte Gemeinde ist, deren Wirtschaft entscheidend vom Tourismus und vom Landschaftsidyll um den Stausee geprägt ist. Seither sind noch einige Ortschaften in vergleichbarer Weise durch Stauseen überflutet und an anderen Standorten neu erstellt worden, darunter als bekanntes Beispiel 1954 Marmorera am Julierpass in Graubünden, dessen Schicksal in einem Schweizer Film («Marmorera» von Markus Fischer, 2007) aufgegriffen wurde. Grosse, ganze Talschaften betreffende Überflutungs- und Umsiedlungsprojekte wie etwa im Urserental oder im Rheinwald (GR) sind in der Schweiz jedoch stets durch Volksentscheide verhindert worden. Der Bau von Wasserkraftwerken hat sich seither immer mehr von den Voralpen in die Alpentäler verlagert, und die grössten seit den 1950er-Jahren erstellten und laufend ausgebauten Werksgruppen wie etwa Cleuson-Dixence oder KWO (Kraftwerke Oberhasli) lassen das Kraftwerk Wägital um eine Grössenordnung hinter sich (vgl. Kasten S. 26). Umso mehr ist es an dieser Stelle angebracht, sich die damaligen Verhältnisse vor Augen zu führen, um die Bedeutung der technischen Pionierleistungen im Wägital rückblickend zu würdigen.
Vor der Flutung
Ende des 19. Jahrhunderts, als in einer ersten Prospektionswelle landesweit geeignete Standorte für Wasserkraftwerke gesucht wurden, stellte man bereits fest, dass sich der langgezogene, flach geneigte Talboden von Innerthal am Ende des bis anhin unbekannten Wägitals für die Anlage eines Stausees eignet. Auf etwa 7 km Horizontaldistanz zur Talebene der March bei Siebnen, die rund 50 m über der Höhe des Zürichseespiegels liegt, steht ein Gefälle von rund 400 m zur Verfügung. Die Felsenge des Schräh am Ausgang dieses Talbodens war für die Erstellung einer Talsperre prädestiniert. Weitere günstige Umstände sind auch die relative Nähe zu grossen Energieverbrauchszentren, insbesondere der Stadt Zürich sowie der hoch industrialisierten Gebiete östlich und nordöstlich des Zürichsees, und nicht zuletzt die Tatsache, dass die Schwyzer Voralpen eines der niederschlagsreichsten Gebiete der Schweiz sind. Die Wasserkraft des Wägitals tatsächlich zu nutzen war aber aus geologischer Sicht schwierig, und es bedurfte mehrerer Anläufe, bis der Staudamm und die zusätzlich erforderlichen Kraftwerk-Bauwerke realisiert werden konnten (vgl. Kasten).
Nachdem bereits 1918/19 erste Sondierungen im Bereich der Staumauer Schräh erfolgten, konnte das definitive Bauprojekt im Januar 1921 aufgelegt und bewilligt werden. Als erste Arbeiten des Kraftwerkbaus begannen die Aushub- und Betonierarbeiten an der Staumauer Schräh im Januar 1922. Vier Jahre später, Anfang Januar 1926, konnte mit der Inbetriebnahme der Maschinengruppe 4 in der Zentrale Rempen der Betrieb aufgenommen werden.
Disposition der Anlage
Das Kraftwerk Wägital ist als zweistufiges Speicherkraftwerk mit Jahresspeicher ausgelegt (Abb. 2). Es nutzt die Wasserkraft der Wägitaler Aa zwischen dem Wägitaler See am südlichen Talende und Siebnen am nördlichen Talausgang zur Ebene der March. Die Trennung zwischen den zwei Stufen liegt ungefähr in der Mitte der genutzten Flussstrecke beim Ausgleichbecken Rempen, wo der einzige bedeutende Zufluss der Wägitaler Aa – der Trepsenbach – auf der rechten Talseite einmündet. Durch die Position dieses Zuflusses ergibt sich eine annähernd symmetrische Anordnung der zwei Stufen, die ungefähr dasselbe Gefälle aufweisen. Da beide Stufen auch dieselbe Triebwassermenge verarbeiten, konnten sie mit identischen Maschinengruppen ausgerüstet werden.
Der Wägitaler See bzw. Stausee Innerthal wird hauptsächlich aus seinem natürlichen, 42.7 km2 messenden Einzugsgebiet gespeist. Dazu kommt das Einzugsgebiet von 40 km2 des Ausgleichsbeckens Rempen der unteren Stufe, dessen gepumptes Wasser ebenfalls zur Füllung des Stausees beiträgt. Neben diesen natürlichen Einzugsgebieten wird kein Wasser aus anderen Gebieten zugeführt.
Staumauer und See
Das auffallendste und auch teuerste Bauwerk des Kraftwerks Wägital ist die Staumauer Schräh in der gleichnamigen Felsenge am Ausgang des Talbodens von Innerthal (Abb. 5 und 8). Die in Beton im damals neuartigen Giessverfahren erstellte Gewichtsstaumauer ist im Grundriss gerade angelegt und weist einen dreieckigen Querschnitt auf. Wasserseitig beträgt der Anzug 30:1, womit die Mauer beinahe senkrecht ist. Luftseitig beträgt der Anzug 1:0.783, was ihr eine imposante Erscheinung verleiht. Die Mauer ist vom Fundament bis zur Krone maximal 110.5 m hoch, wovon im Endzustand maximal 66 m über dem früheren Talboden sichtbar sind. Der grosse eingegrabene Anteil der maximalen Mauerhöhe ist einerseits auf die über 20 m starke Schuttüberdeckung des Felsbodens und anderseits auf eine ca. 20 m tiefe, schmale Erosionsrinne im Felsboden zurückzuführen, die bergmännisch ausgeräumt und betoniert werden musste.
Durch diese Staumauer, die für fünf Jahre die grösste Betonstaumauer der Welt war, wird ein 5 km langer und maximal etwa 1.20 km breiter See mit einer Oberfläche von 4.25 km2 aufgestaut. Da der Stolleneinlass für das Triebwasser höher liegt als der Talgrund auf Kote 834, liegt der tiefste mögliche Betriebswasserspiegel auf Kote 850. Bei der normalen Staukote 900 beträgt der nutzbare Stauinhalt 147.4 Mio. m3, was einer theoretischen akkumulierten Energie von 122.4 Mio. kWh entspricht. Im heutigen Betrieb wird nur der Bereich zwischen den Koten 880 und 900 bewirtschaftet, was einem Nutzinhalt von 76 Mio. m3 entspricht. In der Staumauer Schräh sind rund 236 600 m³ Beton verbaut worden. Sie wird von sieben über die gesamte Höhe verteilten horizontalen Kontrollgängen und drei vertikalen Kontrollschächten aus überwacht. Die Mauerkrone – die Kronenlänge beträgt etwa 156 m – wird durch Betongewölbe von 3 m Lichtweite und 1 m breite Pfeiler gebildet, die eine 4 m breite Verbindungsstrasse tragen. Am linken Ende ist der Hochwasserüberlauf mit Schwellenkote 897.63 m angeordnet. Durch seine drei 3.5 m weiten, durch Schützen abgeschlossenen Öffnungen können maximal 85 m³/s über eine Felswand ins alte Flussbett abgeführt werden (Abb. 9). Neben dem Mauerfundament war zudem noch der Grundablass in einem separaten Stollen angeordnet. Von 1982 bis 1984 wurde die Hochwasserentlastung saniert und ein neuer, auf Höhe des Talbodens durch die Mauer führender Grundablass erstellt.
Die obere Stufe Innerthal–Rempen
Auf der rechten Seeseite, etwa 800 m von der Staumauer entfernt, ist auf Kote 844 das Einlaufbauwerk für den Druckstollen der oberen Stufe angeordnet. Diese mit einem Rechen versehene Öffnung kann für Arbeiten im Stollen mit einer Flachschütze verschlossen werden, die auf einer Schrägseilbahn vor den Stolleneinlauf gefahren werden kann (Abb. 1). Im Normalbetrieb dient eine in einem Vertikalschacht weiter hinten im Druckstollen angeordnete Drosselklappe als Abschlussorgan. Hier beginnt der leicht geneigte, 3.67 km lange Druckstollen mit kreisförmigem Querschnitt und 3.6 m Innendurchmesser. Auch dieses «unsichtbare » Bauwerk ist eine Pionierleistung, denn für seine druckwasserdichte Auskleidung wurden in grossem Umfang Spritzbeton – damals als Gunit bezeichnet – und elektrisch geschweisste Ringbewehrungen eingebaut. Der Druckstollen endet im Wasserschloss Rempen mit einer unteren, als Stollen ausgebildeten Kammer und einer oberen, als frei stehender Betonzylinder konzipierten Kammer (Abb. 10). In der anschliessenden, frei stehenden Apparatekammer teilt sich der Druckstollen in zwei mit Drosselklappen abschliessbare Stränge. Von hier wird das Betriebswasser in einer offen auf Betonfundamenten verlegten, zweisträngigen Druckleitung mit vier Fixpunkten zur Zentrale Rempen geführt. Die Rohrdurchmesser dieser Druckleitung nehmen von oben nach unten von 2.4 m auf 2.05 m ab.
Die untere Stufe Rempen–Siebnen
Im Ausgleichsbecken Rempen mit der Staukote 642, unmittelbar unter der Zentrale Rempen, beginnt die untere Stufe des Kraftwerks Wägital. Das etwa 500 m lange und maximal rund 130 m breite Becken mit einem Nutzinhalt von rund 360 000 m³ wird durch die gleichnamige Staumauer im Flussbett der Wägitaler Aa aufgestaut. Diese inklusive Fundamente maximal 31.5 m hohe – 25 m davon entfallen auf die maximale Wassertiefe –, im Grundriss gerade Beton-Schwergewichtsmauer ist analog der Staumauer Schräh mit dreieckigem Querschnitt und auf Gewölben abgestützter Krone mit einer Kronenlänge von 128.4 m konzipiert. Zwei horizontale Kontrollgänge dienen der Überwachung der Mauer mit einer Betonkubatur von rund 21 500 m³. Der Wasserspiegel des Ausgleichsbeckens wird durch eine regelbare Überlaufklappe und vier automatisch ansprechende Saugüberfälle in der Mauerkrone reguliert. Diese Entlastungsorgane können gesamthaft 66 m³/s Wasser über die Mauerkrone abführen. Zwei im Mauerfuss eingelassene, quadratische, mit Gleitschützen verschliessbare Grundablässe sind insbesondere für das Ausspülen der Geschiebe- und Schlammablagerungen aus dem Ausgleichsbecken wichtig und vermögen eine Wassermenge von je 90 m³/s auszuleiten. Im Ausgleichsbecken Rempen wird neben dem Triebwasser der Zentrale Rempen der Abfluss des Zwischeneinzugsbiets mit einer Fläche von 40 km2 gesammelt. Dazu gehört auch der benachbarte Trepsenbach, der durch eine Wasserfassung mit Überfallwehr, Grundablass und Entsander gefasst und mit maximal 5 m³/s durch einen 268 m langen Freispiegelstollen ins Ausgleichsbecken Rempen übergeleitet wird. Wie für die Wägitaler Aa wird auch für den Trepsenbach von der 1962 erneuerten Konzession kein Restwasser vorgeschrieben. Am rechten Ende der Staumauer Rempen wird das Triebwasser der unteren Stufe durch ein Einlaufbauwerk gefasst und, analog zur oberen Stufe, nach Durchlaufen einer in einem Schieberhaus untergebrachten Drosselklappe in den leicht geneigten, 2.54 km langen Druckstollen mit kreisförmigem Querschnitt von 3.6 m Durchmesser eingeleitet. Er ist analog der oberen Stufe druckwasserdicht ausgekleidet. Unterhalb der Staumauer Rempen überquert der Druckstollen das Trepsental in 7 m Höhe auf einem 50.65 m langen, von Robert Maillart (1872 – 1940) entworfenen Aquädukt in Form einer auf zwei Pfeilern aufgelagerten Rohrbrücke aus Stahlbeton mit geschweisster Ringbewehrung (Abb. 4 und 6).
Am Ende des Druckstollens ist bei der Isenburg im Hang oberhalb Siebnen ein Zweikammer- Wasserschloss in analoger Bauweise wie in Rempen, aber mit einer wesentlich kleineren oberen Kammer angeordnet. Wie in Rempen teilt sich der Druckstollen in der anschliessenden, frei stehenden Apparatekammer in zwei Stränge, die mit Drosselklappen geschlos sen werden können. Von hier wird das Betriebswasser in einer zweisträngigen Druckleitung, die bei dieser Stufe in eine Betonummantelung eingegossen und im Boden verlegt und von aussen praktisch unsichtbar ist, zur Zentrale Siebnen geführt. Die Rohrdurchmesser dieser Druckleitung nehmen von oben nach unten von 2.5 m auf 2.2 m ab. Das Betriebswasser wird unterhalb der Zentrale Siebnen auf Kote 443.05 in das durch Dämme begradigte Gerinne der Wägitaler Aa zurückgegeben, die bei Lachen in den Obersee (Zürichsee) mündet.
Bau- und Energiekosten
Das Aktienkapital für den Bau und den Betrieb des Werks betrug 1921, anlässlich der Gründung der AG Kraftwerk Wägital (AKW), 40 Mio. Fr., die je zur Hälfte von der Stadt Zürich und den NOK eingebracht wurden. Gemäss der Abrechnung der Bauleitung per regulären Betriebsbeginn am 1. Oktober 1926 beliefen sich die totalen Baukosten auf rund 80 Mio. Fr.1 Grösster Einzelposten mit rund 16 Mio. Fr. war die Staumauer Schräh. Nach der Erneuerung der Konzession durch den Bezirk March im Mai 1962 wurden umfangreiche Umbauten und Sanierungsarbeiten ausgeführt, durch die sich der Anlagewert auf 140 Mio. Fr. erhöhte. Aus der Abrechnung und den Betriebskosten wurden 1930 für die verfügbaren 110 Mio. kWh Winterenergie Energiegestehungskosten von 6.82 Rp./kWh abgeleitet.[1] Heute rechnen die Betreiber in einem Jahr mit durchschnittlichen Niederschlägen für die auf Abruf zur Verfügung stehende, besonders wertvolle elektrische Energie – die Maschinengruppen können innerhalb etwa einer Minute vom Stillstand auf volle Leistung hochgefahren werden – mit Gestehungskosten von rund 12 Rp./kWh.
Die Kraftwerkbauten im Wägital sind eindrückliche Beispiele für den Pioniergeist und die Leistungsfähigkeit des Schweizer Ingenieurwesens in den 1920er-Jahren. Mit der Verwendung der Baustoffe Beton und Stahlbeton für Bauwerke dieser Grösse bzw. unter der Beanspruchung durch Druckwasser wurde damals teilweise Neuland betreten, was nur mithilfe neuartiger Konstruktions-, Berechnungs- und Baumethoden möglich war. Umso bemerkenswerter ist, dass ein Grossteil der Bauwerke und Einrichtungen heute weitgehend im Originalzustand weitergenutzt wird. Auch die hydraulische und elektromechanische Ausrüstung (Turbinen, Pumpen, Abschlussorgane, Generatoren und Pumpenmotoren) ist grösstenteils unverändert weiterhin in Betrieb. Ein Besuch im Wägital lohnt sich, denn das Kraftwerk Wägital ist zweifellos eines der konsistentesten und besterhaltenen Kraftwerkensembles aus der Zwischenkriegszeit. Auch heute beeindruckt die wuchtige Präsenz der Staumauer Schräh, die archaische Wirkung des Trepsenbach-Aquädukts oder die tempelartige Anlage des Wasserschlosses Rempen, die im Lauf der Jahre praktisch in die umgebende Voralpenlandschaft eingewachsen sind.
Aldo Rota, Prof. Dr. sc. techn., dipl. Werkstoffing. ETH/SIATEC21, Fr., 2010.09.10
Anmerkung
[1] «Das Kraftwerk Wägital», Bericht der Bauleitung, Verlag A.-G. Kraftwerk Wägital, Siebnen, 1930 (vergriffen)
10. September 2010 Aldo Rota
«Gleichgewicht ist einer der schönsten Begriffe»
Der geplante Abbruch der von Robert Maillart entworfenen Schrähbachbrücke im Wägital war der Anstoss für das Gespräch zwischen dem Ingenieur Christian Menn und dem Kunsthistoriker Werner Oechslin. Sie haben sich für TEC21 zusammengesetzt und über die Tagesaktualität hinaus die Frage des Erhalts historischer Brücken diskutiert. Was bedeutet es, sie zu schützen? Wo liegen Verantwortungen, Kosten und Gewinn? Der hilflose Umgang mit Kunstwerken des Ingenieurbaus entlarvt das Selbstverständnis einer Gesellschaft, die technische und kulturelle Aspekte zu trennen versucht.
Christian Menn: Ein Eingriff in ein Bauwerk wird dann notwendig, wenn die Funktionalität nicht mehr gewährleistet ist – sei es aufgrund der Geometrie, der ungenügenden Tragsicherheit oder von Mängeln mit Schadenfolgen. Kritisch ist die Beurteilung, wenn die Erhaltungskosten deutlich höher sind als die eines Abbruchs mit Neubau, wenn mit der Erhaltung eine beschränkte Funktionalität in Kauf genommen werden muss oder wenn die Mehrkosten einer Erneuerung unter Beibehaltung der Authentizität zu gross werden – grösser, als wenn man das Bauwerk normal erhalten könnte. Die Alternative zur Erhaltung eines Bauwerks ist der Abbruch. Prioritäten sollten bezüglich Konzeption, Konstruktion, Erscheinungsbild und Erbauer gesetzt werden.
Werner Oechslin: Die Kosten und die Funktionalität sind die Hauptargumente gegen die Erhaltung. Doch was sind diese Kosten? Wir müssen vorerst bestimmen, von welcher Kostenwahrheit wir sprechen. Lediglich die Kosten des Eingriffs zu berücksichtigen ist nicht ausreichend. Die Schrähbachbrücke im Wägital ist Teil eines kulturellen Ensembles, das man touristisch vermarkten könnte (Abb. 1). Das ist ein Plus, das sich als Gewinn niederschlagen würde, leider aber schwierig zu berechnen ist. Kostenwahrheit ist nicht auf die unmittelbar mit dem Projekt allein verknüpften Aufwendungen zu begrenzen, volkswirtschaftliches Denken ist erforderlich. Das gleiche gilt bei der Funktionalität: Es wird festgelegt, welche Funktionalität erbracht werden muss, doch wer überprüft die Zahlen? Wer hinterfragt die Annahmen, die ja letztlich auf Hypothesen basieren? Wie kommt man dazu, die Funktionalität so stark verändern beziehungsweise erhöhen zu wollen? Wenn wir erhaltenswerte Bauwerke nicht zu Kulissen verkommen lassen wollen, müssen wir die geplante Nutzung hinterfragen. Es hat keinen Sinn, Werke museal zu erhalten, die dann einfach in der Landschaft herumstehen. Man muss ihnen die gleiche, eine leicht veränderte, eine stark veränderte oder eine andersartige Nutzung zuweisen können. Bei Brücken ist die Hauptnutzung so evident, dass sie auf jeden Fall funktionsfähig bleiben müssen. Die Frage ist also, ob ihr Erhalt eine Anpassung an eine leicht verbesserte oder an eine leicht erweiterte Nutzung ermöglichen soll – und ob man diese im Rahmen des Bestehenden vernünftigerweise garantieren kann.
Christian Menn: Verbesserungen oder Verschönerungen im Erscheinungsbild eines schützenswerten Bauwerks sind nur beschränkt möglich. Konsequenterweise müsste man eine neue Brücke in einem ähnlichen Stil bauen. Die Erhaltung, wie wir sie heute verstehen, hat bei wertvollen Bauwerken jedoch absolute Priorität. Ihr Ziel ist eine möglichst grosse Authentizität. Das Projekt, das das Berner Nachfolgebüro von Maillart – Diggelmann Partner AG – für die Schrähbachbrücke gemacht hat, ist ein gutes Beispiel dafür (vgl. TEC21 11/2010, ‹Einsprache für die Schrächbachbrücke›). Der Wert eines Bauwerks misst sich dabei an zwei Kriterien: Entweder das Bauwerk selbst ist kulturhistorisch bedeutend, oder der Projektverfasser war eine Art Kultfigur. Hat das Bauwerk aus kulturhistorischen Gründen Priorität, muss es so erhalten bleiben, wie es konzipiert und gebaut wurde; konstruktive Änderungen können allerdings ohne weiteres vorgenommen werden, sofern man sie nicht sieht. Wenn der Projektverfasser prioritär ist, muss das Erscheinungsbild auf jeden Fall erhalten bleiben; das Konstruktive sollte dabei auch auf jeden Fall sichtbar bleiben, denn man möchte ja wissen, wie sich der Ingenieur entwickelt hat. Wenn Maillart die Schrähbachbrücke nicht befriedigt hat, soll das nicht kaschiert werden. Die Widerlager der Schrähbachbrücke zum Beispiel sind zumindest fragwürdig. Seine späteren Kunstbauten haben keine solchen massiven Klötze – bei der Überführung bei Arth hat er auf jeden Fall darauf verzichtet. An der Schrähbachbrücke aber hat er sie gebaut, aus welchen Gründen auch immer. Werner Oechslin: Selbst Maillart war in den kulturellen Kontext seiner Zeit eingebunden. Selbst er konnte sich der damaligen Vorstellung, wie eine Brücke auszusehen habe, nicht entziehen; er musste nicht nur stabile Konstruktionen entwerfen, sondern die Leute auch visuell abholen, damit sie das Werk begreifen und akzeptieren konnten. Menschen haben Angst, eine Brücke zu betreten, wenn sie nicht visuell nachvollziehen können, dass sie hält. Die massiven Widerlager können damals solche visuellen Stützen gewesen sein.
Christian Menn: Ingenieurkunst besteht auch darin, etwas so zu konstruieren, dass es den Laien durch Eleganz und Leichtigkeit verblüfft.
Werner Oechslin: Der Laie ist aber nur anfangs verblüfft, danach tritt Gewöhnung ein. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass wir über sehr filigrane oder äusserst hohe und vielleicht auch schwingungsanfällige Brücken gehen können – wir befürchten nicht mehr jedes Mal, dass sie einstürzen. Das ist gut so: Wenn wir uns nicht an neue Dinge gewöhnen könnten, würden wir uns auch nicht mehr verändern. Man muss sich von eingebrannten Bildvorstellungen lösen, um sich weiterzuentwickeln. Der Mensch kann sich auf seinen Sehsinn verlassen, doch muss er dem Auge auch die Möglichkeit geben, sich anzupassen und zu verbessern. Die Widerlager der Schrähbachbrücke sind ein typischer Fall dieser fortschreitenden Adaption. Es hat Zeiten gegeben, da konnte man sich nicht vorstellen, dass sich Kräfte schräg verlagern, alles musste horizontal geschichtet werden. Die Geschichte des Bogens hat die Welt jahrhundertelang durcheinander gebracht! In spätgotischen Gewölbebauten hat man sogar Gewichte an den Schlussstein gehängt – um die Stabilität zu beweisen, aber auch als Provokation.
Christian Menn: Ebenso wichtig wie der kulturelle Kontext sind auch das topografische und das gewachsene Umfeld. Am Anfang eines Entwurfs denke ich nicht an das Tragsystem der Brücke, sondern an die Umgebung, in die sie sich einfügen soll. Kürzlich wurde eine meiner Fussgängerbrücken fertig (Abb. 3). Sie steht in Princeton in einem waldigen Umfeld, und das Konzept ist meines Erachtens gelungen. Berufskollegen hätten mit ihren Überlegungen vermutlich direkt bei der Brücke angesetzt und eine Konstruktion mit Seil da und Seil dort konstruiert – etwas Spektakuläres eben. Diese Brücke ist nicht spektakulär: Stützen aus Cortenstahl verzweigen sich und halten eine Betonplatte. Das gesamte Erscheinungsbild fügt sich so in den Wald ein, dass man die Stützen kaum mehr von den Baumstämmen im Wald unterscheiden kann. Leider lernt man diesbezüglich kaum etwas während der Ausbildung: Brücken werden als rein technische Konstrukte vermittelt, ohne jegliche kulturellen oder topografischen Bezüge – das ist unbefriedigend.
Werner Oechslin: Heute herrscht eine technisch-wirtschafliche Denkweise vor, in der die Effizienz alles und der Rest nichts ist. Planung und Projektierung sind selten von geschichtlichem Denken begleitet. Doch Planung wäre umfassend zu verstehen, die Einbettung des Werks in seinen kulturellen, ökonomischen, topografischen Kontext sollte selbstverständlich sein. Leider hat sich der Ensemble-Begriff nicht einmal in der Denkmalpflege richtig durchgesetzt: Angeblich ist er nicht praktikabel. Wir sind offenbar unfähig geworden, etwas im städtebaulichen Ensemble zu denken respektive durchzusetzen. Schon bei einem einfachen Fall wie diesem Maillart-Brücklein sind wir mit der schier unlösbaren Frage konfrontiert, wer überhaupt etwas dazu sagen darf. Die Meinungen driften auseinander, weil nur eine Minderheit sich bewusst ist, dass man die Dinge umfassend sehen muss. Ich kenne die Brücke in Princeton nicht, doch wenn du aus Cortenstahl etwas machst, worüber du selber sagst, dass es wie ein Baumstamm aussieht, dann denkst du über das rein Technische hinaus und benutzt Symbole und Bilder, um das Umfeld erfahrbar zu machen. Genau an diesem Punkt könnte eine Begegnung von Ingenieur und Architekt stattfinden. Dass der Ingenieur nur rechnen und der Architekt der kreative Kopf sein soll, ist doch absurd! Man müsste alles unternehmen, um die angebliche totale Andersartigkeit von Ingenieur und Architekt zu hinterfragen. Es gibt zwar spezifische Befähigungen, Kompetenzen und Begabungen, aber eben auch Überlappungen.
Christian Menn: Gerade wenn das Umfeld Teil des Ganzen ist, können Ingenieure bei ihren Konstruktionen – vor allem bei Brücken – das Räumliche ausnützen. Wenn eine Brücke auf so feinen Stützen steht wie die Sunnibergbrücke, ist das nur möglich, weil das Fahrbahndeck mit beiden Endwiderlagern fest verbunden ist (Abb. 4).
Werner Oechslin: In der Architektur entspricht das der Forderung nach Angemessenheit. Wenn eine dünne Stütze das Geforderte leisten kann, mache sie nicht künstlich dicker. Die Sparsamkeit ist eine alte Tugend, die nicht nur der Ingenieur kennt, sondern die unzähligen Massnahmen der Gesellschaft inhärent ist. Eine räumlich definierte Bibliothek beispielsweise ist eine Sparsamkeitsübung im Vergleich zur Utopie, man könne täglich Millionen von zusätzlichen Informationen auftürmen, mit denen wir in Tat und Wahrheit nichts mehr anfangen können. Wir Menschen sind ökonomische Gebilde. Unser Raum und unsere Zeit sind endlich.
Christian Menn: Du brauchst das Wort Angemessenheit. Ich brauche im Brückenbau ein ganz anderes Wort, nämlich Gleichgewicht – physikalisches Gleichgewicht und metaphysisches Gleichgewicht. Gleichgewicht ist einer der schönsten Begriffe, die es gibt.
Werner Oechslin: Es ist klar, dass sich die beiden Bereiche stark voneinander entfernt haben. Die kulturrelevante Reihenfolge ist: notwendig – nützlich – schön. Notwendig ist selbstverständlich die Statik; Schönheit leistet man sich, wenn man zu viel Geld hat. Hier orte ich eine Krise unserer Gesellschaft. Früher waren die drei Bereiche viel enger miteinander verbunden. Giedion schreibt in ‹Bauen in Frankreich› 1928 zur Abbildung von Gropius’ Dessauer Bauhaus: ‹Erst nach einem halben Jahrhundert ist man imstande, die Spannungen, die in den Materialien sind, wirklich auszunützen und den dekorativen Schleim zu überwinden›, und präzisiert in einer Fussnote: ‹Spannung im ästhetischen Sinn›. Da ist doch der Wurm drin. Spannungen – ein Begriff, den wir ingenieurspezifisch verstehen – löst er aus dem Ingenieurbereich heraus und ordnet ihn eindeutig dem ästhetischen zu. In der Ideologie der Moderne müssten diese beiden Bereiche eigentlich zusammenkommen. In diesem Punkt ist die Spaltung geschehen. Wir müssen korrigieren. Synthesen sind möglich; es stimmt nicht, dass wir auf der einen Seite präzise Zahlen und auf der anderen schwammige Beschreibungen haben. Tatsache ist, dass alles ein Ganzes bildet.
Christian Menn: Das wiederum wirft die Frage der Mitsprache bei der Erneuerung oder Erhaltung eines Kunstbauwerks auf. Sollen Nichtbrückenbauer in der Diskussion um den Erhalt von Ingenieurkunstbauwerken mitreden und mitbestimmen dürfen? Wenn es um die Erhaltung geht, auf jeden Fall, weil sie dem Gespräch ein Gegengewicht zum ingenieurspezifischen und auf das Technische fokussierten Denken geben können.
Werner Oechslin: Wir haben heute zwei Kompetenzen – Architektur und Ingenieurwissenschaft. Der Gegenstand aber ist immer der gleiche, und die Einheit des Gegenstandes verkörpert beide Elemente. Es ist falsch, wenn man die Ingenieure nur ingenieurspezifisch beurteilen und den Kulturhistoriker nur kulturhistorisch argumentieren lässt. Die Argumente müssen sich begegnen, denn sie sind miteinander verkettet. Wir können sie nicht auseinanderdividieren und das Ingenieurspezifische, das Ästhetische und das Kulturgeschichtliche voneinander trennen. Im Gegenteil, wesentlich ist der Zusammenhang aller einzelnen Elemente; erst dieser bildet den Wert des Kunstbauwerks. Das Bauwerk ist vermutlich weniger bedeutend, wenn es einfach zerlegt werden kann, weil die verschiedenen Aspekte additiv zueinandergefügt wurden. Die guten Werke leben davon, dass alles untrennbar zusammenfindet. In der Diskussion um das Bauwerk müssen darum zwingend alle Tatsachen aller Beteiligten respektiert werden. Jeder begegnet einmal der Situation, in der mangelnde Kenntnisse ein Risiko werden, das zu einem Fehlurteil führen kann. Darum braucht es verschiedene Fachspezialisten, die mitdenken, die Tatsachen aufdecken. Auf diese Weise gibt es Berührungen mit anderen Sachverständigen, es gibt Berührungen mit andern Menschen und mit anderen Kompetenzen. Erst dann erfüllt sich, was in der Gesellschaft wirklich passiert. Heute achtet man ja vor allem darauf, dass in der Zusammenarbeit keine Widersprüche entstehen. Hier haben wir riesige Mängel und Tabus, die wir nicht ausdiskutieren.
Christian Menn: Auch der Projektverfasser sollte mit einbezogen werden – und das betrifft in gewissen Fällen auch mich. Falls der Projektverfasser noch lebt, sollte man ihn bei einer Anpassung beiziehen und seine Erfahrungen nutzen. Aber auch wenn er tot ist, sollte ihn jemand gleichsam vertreten. Bei der Eisenbahnbrücke der Rhätischen Bahn in Klosters, die ebenfalls von Maillart stammt, war dies nicht der Fall. Niemand hat gegen die bedenkliche Veränderung des Brückenbildes im gesamten Umfeld Einsprache erhoben. Die ursprüngliche Brückenkonstruktion war schön entwickelt und lag elegant in der Kurve (Abb. 5). Ein Neubau (Abb. 6) wäre nicht notwendig gewesen, denn das andere Gleis hätte auf die bestehende Konstruktion aufgebaut werden können. Der Beschluss ging durch alle Instanzen, die RhB, die Gemeinde, den Denkmalschutz, den Heimatschutz – an mich haben sich die Verantwortlichen nicht gewandt.
Werner Oechslin: Auch ich gehöre zu denjenigen, die ihr Leben lang nicht gefragt wurden. Warum? Weil die Verantwortlichen Angst haben, dass ihre ‹Gradlinigkeit› durch eine andere, unberechenbare Meinung gestört würde. Als Intellektuelle pflegen wir die radikal offene Situation. Wir schalten kein Argument a priori aus, wir bedenken alles. Du hast eine vorbildliche Toleranz gegenüber Personen, die etwas zu einer Brücke sagen, obwohl sie vom Konstruktiven nichts verstehen. Diese radikal offene Situation finden wir in der Gesellschaft jedoch selten, sie wird von den Verursachern der Handlungen häufig gemieden. Wir haben in der Schweiz insofern absolut unkoordinierte Zuständigkeiten, und das entspricht jener radikal offenen Situation in keiner Weise. Im Fall der Schrähbachbrücke war es so, dass der ganze Prozess für den Abbruch ‹abgekoppelt von der Öffentlichkeit› eingeleitet wurde. Erst in letzter Minute habe ich zufälligerweise in der Zeitung davon erfahren und mit ein paar Kollegen darüber gesprochen. Ist es möglich, dass eine Maillart-Brücke tatsächlich an der öffentlichen Diskussion vorbei ‹weggeschoben› wird? Das richtige Vorgehen hätte sein müssen, dass sich die zuständige Behörde mit Aufsichtspflicht an kompetente Personen gewendet, die Problematik geschildert und mit ihnen diskutiert hätte. Doch wir haben hier eine Gemeinde, einen Kanton und eine komplexe Situation, in der die Kompetenzen nicht freigelegt sind.
Christian Menn: Das ist eine fragwürdige Entwicklung. Aber ich bin einverstanden, Maillart war ein aussergewöhnlicher Mensch... Soll man denn nun die Schrähbachbrücke erhalten? Und soll man die Widerlager zeigen oder nicht? Nun, es geht um Maillart und nicht prioritär um das Bauwerk. In diesem Fall sage ich: Ja, die Brücke müsste man in ihrem Erscheinungsbild und mit ihren konstruktiven Elementen erhalten.
Werner Oechslin: Selbstverständlich. Wir Schweizer haben nicht viele so grosse Figuren. Maillart spielte nicht nur in der Schweiz, sondern international eine bedeutende Rolle, was die Entwicklung des Brückenbaus betrifft. Kommt hinzu, dass er kulturgeschichtlich etwas zustandegebracht hat, womit sich die Schweiz rühmen kann: eine grosse Schweizer Tradition, die zum Kernbereich unserer kulturellen Leistung gehört. Man kann nicht sagen, es habe genügend Maillart-Brücken! Genauso wenig sagen wir, es gebe genügend Gemälde von Hodler, weniger würden auch reichen. Robert Maillart ist von solcher Bedeutung, dass es auf jede einzelne Brücke ankommt. Mir gefällt übrigens, dass du als Ingenieur sagst: Maillart ist nicht ein Mensch ohne Fehler. Ich habe früh von Architekten – allerdings nicht in der Schweiz – gelernt, dass man ein berühmtes Bauwerk nicht nur anschauen, sondern auch kritisieren kann. Man darf auch von einem Borromini sagen, dass er Fehler gemacht hat. Wohin führt es, wenn wir nur mit Autoritätsbeweisen durch die Geschichte gehen? Maillart hat ausprobiert, Erfahrungen umgesetzt und seine eigenen Ansichten verbessert. Gerade darum ist die Schrähbachbrücke als Objekt wichtig, weil sie uns nicht nur über Maillart mehr Erkenntnisse ermöglicht, sonder auch darüber informiert, wie sich die relativ junge Technologie entwickelt hat. Nun muss man Lösungen suchen, den Sachverstand haben und Fachleute beiziehen. Man muss die bestehende Situation nicht als gottgegeben annehmen, sondern sie zur Disposition stellen. Dann sieht man plötzlich, dass Vieles machbar ist. Das ist unsere Überzeugung.
Christian Menn: Ich habe den Eindruck, dass man manchmal über das Ziel hinausschiesst. Man sollte das Gleichgewicht halten. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass man die Brücke in Klosters kaputt gemacht hat. Das gleiche soll nun nicht auch bei der Schrähbachbrücke geschehen. Sie sollte authentisch erhalten werden. Baut man eine neue Brücke, vielleicht sogar im gleichen Stil, so geht viel Kulturgeschichtliches verloren. Denn dann ist es keine Maillart-Brücke mehr – es ist nicht mehr der Robert Maillart zu dieser Zeit, in der er war und die Brücke gebaut hat.
Moderation: Judit Solt und Clementine van RoodenTEC21, Fr., 2010.09.10
10. September 2010 Judit Solt, Clementine Hegner-van Rooden