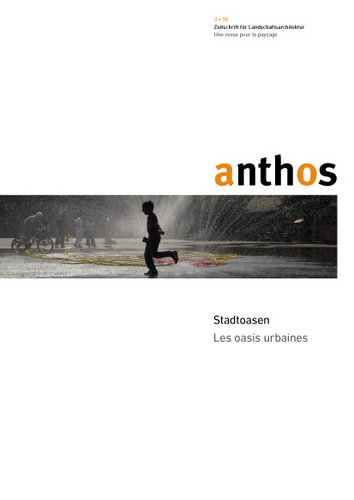Editorial
Was eine Oase ist, steht in jedem Lexikon. Der Duden definiert sie in seiner 6., überarbeiteten Auflage 2007 als vom spätlateinischen «oasis» und dem griechischen «óasis» abstammend, wörtlich übersetzt als «bewohnter Ort» und «fruchtbarer Ort» mit der heutigen Lesart als «Stelle mit einer Quelle, mit Wasser und üppiger Vegetation inmitten einer Wüste».
Was aber ist eine Stadtoase? Für wen soll sie Oase sein und was sind ihre Qualitäten? Braucht eine Stadtoase Wasser? Lassen sich Stadtoasen entwerfen oder zeichnen sie sich gerade dadurch aus, dass wir sie entdecken müssen? Geht es um Aneignung und den besonderen Ort, der auch nur für den Einzelnen eine Oase sein kann? Ist es die Bank auf dem Weg zum Arbeitsplatz, an der wir schon unzählige Male gestresst vorbeigeradelt sind und deren Qualität man erst erkennt, wenn man wegen eines platten Fahrradreifens gezwungen wird, eine kurze Pause einzulegen? Ist es das «Unkraut», das es geschafft hat, die Asphaltdecke aufzubrechen und einen sterilen Ort lebendig werden lässt? Oder brauchen wir Gestaltungsvorlagen zum Entwurf der richtigen Stadtoase? Und wo liegen die Hürden?
Für Martin Kessel braucht der Mensch einen Schuss Wüste – um des Glücks der Oase willen. Für die Stadtoase heisst dies, dass das Zusammenspiel von Grün und Beton, von Offenheit und Geschlossenheit essenziell für ihre Phänomenologie ist. Es gibt ein Innen und ein Aussen, die sich voneinander unterscheiden. Es geht um Gegensätze und Anziehungspunkte, den Ort und seine Atmosphäre. Die Stadtoase erfüllt stets das, woran es gerade mangelt – sie ist Ort der Kontemplation und der Besinnung im turbulenten Drumherum, sie ist Treffpunkt und Ort der Geselligkeit im ruhigen Nichts. Und immer ist sie: das Besondere. Für den Einzelnen oder für die Masse.
anthos 3/2010 nähert sich dem Thema mit einem Fächer an Möglichkeiten: gebauten Projekten und Projektentwürfen, Gestaltungs- und Entwurfsgrundsätzen, Oasen für Flora und Fauna, improvisierten Oasen und kleinen Interventionen in die Alltagswelt, die einen Ort verwandeln und zu etwas Anderem – einer Stadtoase? – werden lassen. Sabine Wolf
Inhalt
Thilo Folkerts
- Kleine Fluchten
Philippe Cabane
- Swim City – eine Freiraumidee für Wasserflächen
Marko Höhn
- Oasenstadt – Stadtoase
Ulrike Böhm
- Metamorphose einer Oase
Christine Kerlen, Jacqueline Parish
- Neue Stadträume für Zürich
Stefan Rotzler, Simon Schweizer
- Jonglieren mit Zielkonflikten
Bernd Schubert, Sabine Wolf
- Blumengraffiti
Paolo Bürgi
- Piazza Castello
Susanne Prehl
- Skulptural lebendig – Ein «Garten» für den Domplatz
Bryum
- Petrus
Moritz von der Lippe, Leonie Fischer
- Rückzug in die Stadtlandschaft – urbane Wiesen zwischen Nutzung und Naturschutz
Max Ruckstuhl
- Stadtfauna – 600 Tierarten in der Stadt Zürich
Stéphanie Perrochet
- Wasserteppich
Caroline Zollinger
- Raum mit Aussicht
Monika Schenk
- Ein Schlosspark für die Harburg
- Wettbewerbe und Preise
- International Federation of Landscape Architects
- Schlaglichter
- Zum Gedenken an Kurt Salathé
- Agenda
- Literatur
- Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Markt
- Die Autoren
- Impressum und Vorschau
Blumengraffiti
(SUBTITLE) Bernd Schubert und Sabine Wolf
Maurice Maggi ist «Guerilla Gardener», der seine Arbeiten selbst Blumengraffiti nennt. Ausgebildet ist er als Landschaftsgärtner, später auch als Koch; zurzeit kocht er für Karl’s kühne Gassenschau in Saint-Triphon. Bernd Schubert und Sabine Wolf unterhielten sich mit ihm über seine Aktionen in Zürich und anderen Städten und über deren Hintergründe.
Maurice, Du bist mittlerweile ein berühmter Guerilla-Gärtner – wenn auch seit einiger Zeit geoutet. Was waren Deine Motive, als Du 1984 begannst, in Zürich aktiv zu werden?
Das damalige Gartenbauamt war sehr besorgt darum, die Alleebäume unkrautfrei zu halten. Und als Gärtner, der ich damals noch war, reizte es mich, meine Berufskollegen herauszufordern: Was würden sie machen, wenn sie vor meterhohen Malven stehen und sie vernichten sollen? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Fachmann, als versehentlich eine Kulturpflanze auszujäten. Darum haben sie diese, vielleicht auch aus Freude an den Blumen, stehenlassen. Und so brach ich eigentlich das Pflegekonzept der Stadt Zürich auf. Als jemand, der in der 68er-Bewegung aufgewachsen ist, reizte mich die Provokation.
Du hast ein «Malvenkataster» angelegt, das zeigt, wo Du Malven in Zürich gesät hast. Hattest Du von Anfang ein Konzept?
Meine Idee war zuerst einfach, nämlich meine Bewegungsräume zu zeichnen. Später war es eine Art Vision. Ich dachte mir, wenn ein Fremder in die Stadt fährt, wäre es schön, wenn er in den Aussenquartieren zuerst einzelne Malven antrifft. Und je weiter er ins Zentrum kommt, desto mehr verdichtet sich das. Ein Traum war, dass sich die Malven in der Innenstadt so verdichten, dass sie unübersehbar werden. Dass man in einem Malvennetz verfangen wird.
Waren es nur Malven?
Ja, am Anfang.
Hattest Du Vorbilder? Guerilla Gardening gibt es als Begriff ja seit den 70er Jahren.
Er wurde 1973 in New York durch die Künstler- und Aktivistengruppe um die Künstlerin Liz Christy geprägt. Christy war Teil einer Gruppe, die sich Green Guerilla nannte. Ich kannte sie damals aber noch nicht. Guerilla Gardening kam aus den USA erst in den 1980ern nach Europa. Wenn ich so zurückdenke, glaube ich eher, dass es eine Zeiterscheinung war. Auch «Asterix in der Trabantenstadt», das 1971 herauskam, könnte mich beeinflusst haben: Die Römer holzten den Galliern die Eichenwälder ab, aber die hatten eine Wundereichel, die haushohe Eichen in Sekunden nachwachsen liess. Und Flowerpower war ja auch schon ein Ausdruck der Hippiebewegung.
Anfang der 1980er gab es in Zürich Jugendunruhen, die Opernhauskrawalle, die Schliessung des Autonomen Jugendzentrums AJZ, eine Auflehnung gegen die Stadt. War es da nur logisch, dass Du in Zürich tätig wurdest?
Ja, ich war in den 80er Jahren sehr aktiv in dieser Szene. Sie hat mich gefärbt. Es war für mich auch eine Befreiung von der Kopflastigkeit der 68er Jahre. Als Gärtner empfand ich Blumen als gutes Medium des Protestes, weil sie ja etwas Liebliches sind, und die meisten Menschen Blumen als etwas Schönes empfinden. Schon bevor ich mit den Malven begann, haben wir – noch in der Lehre – oft Rasensamen in unsere Pflasterungen gemischt, einfach so. Um zu schauen, was passiert.
Du bist nun schon ein viertel Jahrhundert aktiv. Was waren – zurückblickend – Deine grössten Erfolge, Deine bittersten Niederlagen?
Es gibt ein Beispiel, das beides verknüpft. Den Oberen Letten. Nach der Stilllegung der Bahnlinie bestand noch die Gefahr, dass das Areal überbaut wird. Da habe ich mir eine Samenmischung für die Schotterpiste zusammengestellt, mit zum Teil raren und schützenswerten Pflanzen, und sie – natürlich im Verborgenen – eingesät. Mein Gedanke war, bei einem Baubegehren den offiziellen Naturschutz zum Widerstand zu animieren. Es kam zunächst anders. Nach der Schliessung des Platzspitzes entstand hier die offene Drogenszene. Nachdem diese auch wieder aufgelöst wurde, blühte das nun mit einem Stacheldrahtzaun umgebene Areal richtig auf, es wurde von Eidechsen, Schleichen und Falterarten besiedelt. Wir wollten hier 1998 ein Strandcafé eröffnen, um das Gebiet auch einer allgemeinen Nutzung zuzuführen. Die Stadt lehnte ab, da das Gebiet – mit «meiner» Pflanzenwelt – unter Schutz gestellt werden sollte. Da habe ich mich gegenüber dem Gartenbauamt (heute Grün Stadt Zürich) zum ersten Mal geoutet, um zu belegen, dass es sich hier um ein künstliches Produkt handelt. Wir stellten der Stadt das Konzept «Respekt» vor, mit je einem Drittel naturbelassener Fläche, Gastronomie und Sport. So wurde es dann auch eröffnet, und die Stadträtin Martelli, damals Leiterin des Tiefbauamtes, konnte sich die neue Attraktion – eine Stadtoase – auf ihre Fahne schreiben.
Und um das zu erreichen, hast Du Dich geoutet?
Ja. Ich hatte mir doch selber beinahe ein Ei gelegt. Wir mussten über 40 Amtsstellen anlaufen und überzeugen, um die Bewilligung für unseren Gastronomiebetrieb zu erhalten.
War diese Mühsal die erwähnte Enttäuschung?
Nein, sondern vor allem das, was nachher kam. Der angrenzende Tunnel wurde zugeschüttet und das Areal nach einem Wettbewerb von Rotzler Krebs Partner neu gestaltet. Die Drittellösung blieb Grundlage der Gestaltung. Aber enttäuschend war, dass die Stadt die Künstlichkeit meiner Ansaat nicht erkannte, auf eine neue Saat verzichtete und so einfach ein Brombeergestrüpp entstehen liess, das zunehmend verwahrloster aussieht. Die Fachstelle Naturschutz hatte sich zum Nichtstun entschlossen.
Machst Du heute noch Aktionen im Verborgenen?
Ja. Heute säe ich aber grossflächiger, nach Farben getrennt ein, damit man die Künstlichkeit erkennt. Auch Malven, mein Markenzeichen, sind dabei, aber noch weitere Pflanzen, in ein oder zwei Farben. Zum Beispiel in Zürich West.
Welche Pflanzen verwendest Du neben den Malven am liebsten?
Neben den Malven bin ich streng und verwende nur einheimische Pflanzen. Die Wegwarte finde ich ganz toll, aber auch Wiesensalbei, Johanniskraut, Königskerzen, Wilde Möhren, Akelei, Karden und Distelarten. Leider erkennen die Gärtner viele Pflanzen nicht, sie lassen zwar die Malven stehen, schneiden aber die anderen runter oder beseitigen sie. Ich bin jetzt dran, meine Liste an die Stadträtin Frau Genner weiterzugeben, vielleicht ist eine Schulung der Gärtner möglich. Einzelne Gärtner lassen aber auch schon heute mehr stehen, das freut mich sehr.
Erhältst Du Rückmeldungen aus der Bevölkerung?
Viele. Die Menschen drücken ihre Freude aus, in Briefen und Telefonaten. Und sie weisen mich auf Orte hin, wo ich auch noch aktiv werden sollte. Viele schicken mir auch Samen aus ihrem Garten. Ich habe auch schon gehört, dass Anwohner die Pflanzen gegen die Pflegeequipen verteidigt haben. Ich freue mich natürlich über diese Akzeptanz.
Und das Medieninteresse scheint auch nicht nachgelassen zu haben?
Es ist unglaublich, wie lange das Interesse in den Medien anhält. Es nimmt eher zu als ab. Von Richard Reynolds ist 2009 ein neues Buch erschienen: Guerilla Gardening – ein botanisches Manifest. Über meine Tätigkeit wurden Filme gedreht, zum Beispiel von Florian Schaffner oder Roland Archini. Und an der Fachhochschule Osnabrück war kürzlich sogar ein Kongress über Guerilla Gardening, zu dem ich auch eingeladen war. Der Begriff ist allgemein eingeführt, aber ich mag ihn eigentlich nicht. Ich bezeichne meine Arbeiten lieber als Blumengraffiti.
Das Thema dieser «anthos»-Ausgabe sind ja die Stadtoasen. Kannst Du Deine Tätigkeit auch unter diesem Thema einordnen? Oder was verstehst Du unter Stadtoasen?
Ich glaube schon, dass ich dazu beitrage. Es gibt einige Orte, die für mich Stadtoasen sind. Zum Beispiel der Platz vor dem Tamedia-Gebäude an der Sihl. Als die Parkfläche verschwand, habe ich dort eingesät, und zwei Jahre lang wurde nicht gemäht. Es entstand eine wunderbare Wiese. Als ich letztes Jahr mit einer Fotografin den Ort besuchte, war ich überrascht, wie viele Schmetterlinge mir um die Ohren flogen. Toll, dachte ich. Doch dann erfuhr ich, dass sich meine Wege mit denen von André Rey kreuzten, der Raupen einheimischer Schmetterlinge ausgesetzt hatte. Ich war erst ein wenig enttäuscht, doch nachher freute ich mich, dass er dasselbe tut – und ich auf diese Art erwischt wurde, wie viele Leute, die glauben, dass die Pflanzen von allein die Stadt zurückerobern.
Müssten wir uns Freiräume, den öffentlichen Raum, noch mehr aneignen, sozusagen als Rückeroberung durch den Menschen?
Grünräume spiegeln immer auch die gesellschaftliche Situation wider. In meiner Kindheit war am Seebecken noch das Betreten des Rasens verboten. Heute würde das als Witz verstanden. Seht euch nur die Wiese beim Arboretum an einem warmen Tag an. Man besetzt heute Flächen schon ganz anders, doch ich glaube, man könnte das noch viel mehr ausreizen. Ich war gerade in Berlin. Am Moritzplatz in Kreuzberg haben zwei junge Leute einen «Prinzessinnengarten» angelegt. Sie nutzen eine Baubrache, bauen Gemüse und Wildfrüchte an, haben in einem Container ein Restaurant eröffnet, wo sie zusammen mit Arbeitslosen aus der Gegend ihr Gemüse verarbeiten und Marmelade herstellen. Sie haben auch zwei Bienenvölker für die Produktion von Honig. Und sie liefern ihr Gemüse mit dem Fahrrad sogar an Gourmet-Restaurants aus. Als Gärtner und Koch wollten sie mich gleich dort behalten.
Das erinnert sehr an den Ökotopia-Gedanken der 1970er und 1980er Jahre.
Natürlich, doch die Zeit ist wieder reif für solche ökologischen Projekte. Die Medienpräsenz in Berlin ist übrigens riesig. Auch am Kongress in Osnabrück wurden diese Fragen diskutiert. Es wurde nach neuen, besseren Nutzungsformen gesucht.
Die Suche nach einer besseren Nutzbarkeit der Freiräume und der Einsatz von Guerilla Gardening sind doch zweierlei Dinge. Das ginge ja auch ohne Guerillas.
Ja, aber wenn ich mir zum Beispiel die neuen Zürcher Parks anschaue, dann empfinde ich die nur noch als «designed», man muss sie intellektuell lesen. Ganze Generationen müssen nun damit leben. Entspricht das den Bedürfnissen der Bevölkerung? Ich glaube, dass man mit Eingriffen Konzeptkritik äussern kann, Aufmerksamkeit erzeugen, zeigen, dass es auch anders sein könnte.
Im Leutschenpark habe ich Blautöne zum gelben Mergelbelag und weisse Farben zum schwarzen Teerbelag eingesät, um die Strenge aufzubrechen. Die Pflanzen sind sehr schnell wieder verschwunden, um das landschaftsarchitektonische Werk zu schützen.
Hast Du schon Aktionen ausserhalb von Zürich gemacht?
In Bern, Basel, Berlin, München, Mailand, und natürlich in New York. Dort wohnte ich ja längere Zeit, bis 2002.
Seit den Anfängen sind nun 25 Jahre vergangen. Hat sich Deine Motivation verändert? Hast Du eine Entwicklung durchgemacht?
Ja. Am Anfang war es sehr subversiv, gesellschaftspolitisch gefärbt, ein Protest gegen die strenge Ordnung. Als dann das Naturnahe, der Gedanke der Vernetzung in die Pflegekonzepte Einzug hielt, wurde es poetischer. In der neuen Landschaftsarchitektur fühle ich mich aber wieder zur gesellschaftspolitischen Aussage, zum Protest animiert. So bin ich eigentlich nach 25 Jahren zu den Ursprüngen meines Handelns zurückgekehrt.anthos, Mo., 2010.09.27
27. September 2010 Bernd Schubert, Sabine Wolf