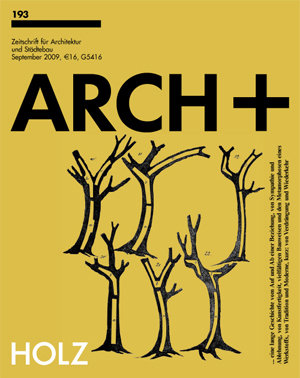Editorial
Holz – eine lange Geschichte
„Hätten wir das Holz nicht, dann hätten wir auch kein Feuer; dann müssten wir alle Speisen roh essen und im Winter erfrieren; wir hätten keine Häuser, hätten auch weder Kalk noch Ziegel, kein Glas, keine Metalle. Wir hätten weder Tische noch Türen, weder Sessel noch andere Hausgeräte.“
Wolf Helmhard von Hohberg, 1682
Von Hohbergs Würdigung des Holzes ließe sich leicht ergänzen, etwa wie folgt: „Wir hätten auch keine Schiffe, keinen Fischfang und keinen Handel mit fernen Ländern. Dann hätte es auch nicht den Reichtum und den kulturellen Glanz der Städte gegeben, allen voran die Seestädte, und nicht die Eroberung der Neuen Welt – oder zumindest hätte das alles einige Jahrhunderte länger gedauert.“
In welchem Maße das Leben bis ins 19. Jahrhundert vom Holz durchdrungen war, ist uns heute, wo wir über eine reiche Auswahl an Werkstoffen und Energiequellen verfügen, kaum noch bewusst. Das Bauen war nur eine unter vielen Möglichkeiten, sich des Holzes zu bedienen. Holz war der universelle Werkstoff schlechthin und meist der einzige unmittelbare Energielieferant. Von daher brachte jede Nutzung von Holz hohe Opportunitätskosten mit sich, da sie alle anderen Nutzungen ausschloss. Jede Form der Stoffumwandlung, die Energie benötigte, ob Metalle, Gläser oder andere Mineralien, war vom Holz abhängig, jede Form der Mechanisierung, ob mit Hilfe von Wasserrädern, Windmühlen oder Webstühlen, erfolgte mit Holz, jede Form der vehikulären Fortbewegung und des Transports bedurfte hölzerner Vorrichtungen und selbst für die Entwicklung der zentralen Faktoren, die den Industrialisierungsprozess vorantrieben, war Holz unverzichtbar: kein Kohlebergbau untertage ohne die Befestigung der Stollen und Abteufungen mittels Holz, keine Erschließung per Eisenbahn ohne die Lagerung der Gleise auf Schwellen aus Holz.
Wo stehen wir heute in der langen Geschichte des Menschen mit dem Holz – am Beginn eines neuen Kapitels mit der Überschrift: Postindustrielle Nachhaltigkeit? Glaubt man den Imagekampagnen, die von den Promotoren der Holzwirtschaft gefahren werden, ist das so. Und das schlechte Gewissen, das zum latenten Begleiter unseres Lebensstils geworden ist, möchte es gerne glauben. Holz fungiert als ein Lehrbeispiel für den ökonomischen Umgang mit Ressourcen, für die Wieder- und Weiterverwendung von Material und für die nachhaltige Bewirtschaftung. All das lässt sich in der Tat historisch belegen, aber erst, nachdem die Menschen die nachhaltige Waldbewirtschaftung während der zweiten Periode der kleinen Eiszeit bei Strafe des Untergangs gelernt hatten. Ob allerdings Europa ohne die spätere Entlastung durch die Kohle heute noch bewaldet wäre, ist zumindest fraglich.
Es erschien sinnvoll, in einer ARCH Ausgabe zum Thema Holz die schnellen Antworten, die im ökologischen Gewand daherkommen, auszuklammern. Es sind Antworten auf Fragen, die durchaus nicht so klar definiert sind, nicht im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Baustoffe untereinander und die Relation von Aufwand und Ertrag, und auch nicht im Hinblick auf die Einordnung der Zielsetzungen in einen allgemeinen gesellschaftlichen Kontext. Solche Antworten findet man zurzeit ohnedies in jeder Zeitschrift und einschlägigen Publikation – und sie besagen für das Bauen selbst rein gar nichts. Beim Bauen geht es zunächst schlicht darum, ob die neuen Holzbauweisen den vielfältigen Anforderungen, denen heute ein Gebäude entsprechen muss, genügen – von der Tragstruktur über die klimatische Performance bis zum Brand- und Witterungsschutz, ob die neuen Holzwerkstoffe sich für die je spezifischen Aufgaben, die ein Gebäude erfüllen muss, eignen, ob das Gebäude rationell und kos-tengünstig (vor)gefertigt werden kann und last but not least, ob Holz das Potenzial für eine zeitgemäße Rhetorik besitzt, was immer man darunter verstehen mag.
Ist das neue Kapitel also eine Geschichte von Verdrängung und Wiederkehr? In gewisser Weise ja, aber nur, was das Gebäude aus Holz, nicht was den Werkstoff betrifft. Holz war nie gänzlich aus dem Bauen verschwunden, sei es als eigenständiges Bauteil oder im Innenausbau oder sei es in „dienender Funktion“ vor allem für den Beton: Die weitspannenden Brücken eines Robert Maillart oder die kühnen Schalen eines Heinz Isler mussten, um überhaupt entstehen zu können, in Holz mit Bogenlehrgerüsten (wie seit der Antike) und gekrümmten Schalungen „vorgeformt“ werden. Relativ unabhängig von den wechselnden „Konjunkturen“ des Holzhauses verlief auch aufgrund einer sehr viel breiteren Nachfrage die Entwicklung des Werkstoffs Holz zu einer ganzen Familie von Holzwerkstoffen mit ständig neuen Abkömmlingen. Sie steht eher im Kontext der Werkstoffentwicklungen mit gezieltem Eigenschaftsprofil, wie sie in allen Stoffgruppen betrieben wird – übrigens zum Teil mit den ähnlichen Entsorgungsproblemen, die aus der sehr weitgehenden Umformung und dem Verschnitt der Urstoffe resultieren.
Eine Besonderheit des vorliegenden Heftes ist die Spiegelung aktueller Entwicklungen an der Geschichte des Holzbaus. Das Erfahrungswissen vieler Generationen und die große Kunstfertigkeit in der Bearbeitung und Verwendung von Holz, und das nicht nur im Hausbau, sondern auch im Schiffsbau und den anderen zahllosen mit Holz befassten Berufen, sind selbstverständlich nicht auf die heutigen Bedingungen übertragbar, aber es wäre falsch, sie nur unter die Kategorie „historisch überholt“ zu subsumieren, denn an den Bäumen selbst hat sich nichts geändert. Sie definieren einen Maßstab, den sich heutige Techniken, Produkte und Projekte gefallen lassen müssen. Das Heft ist in vier Hauptteile untergliedert:
• Im ersten Teil „Der lange Weg vom Stab zu Platte“ wird der neuere Massivholzbau in der Gegenüberstellung mit Stabkonstruktionen thematisiert. Diese Bauweise ist mit der zugrundeliegenden Plattentektonik ohne historisches Vorbild – tatsächlich etwas im Holzbau noch nicht Dagewesenes, das den vorläufigen Schlusspunkt einer sehr langen Entwicklung markiert und eine Bereicherung des ohnedies reichen Repertoires an Bauweisen bedeutet, keine Ablösung. Die Stabkonstruktionen werden sicher – wenn auch nicht in Form des klassischen Fachwerks – ihre Berechtigung behalten.
• Der zweite Teil „Der kleine Schritt von Vorfertigung bis Fertighaus“ beschäftigt sich mit dem großen Plus des Holzbaus, das bereits in den historischen Bauweisen angelegt war: der rationellen zeit- und kostengünstigen Vorfertigung einzelner Elemente und mittlerweile auch ganzer Bauteile eines Gebäudes. Die Möglichkeit der Trennung zwischen der ortsunabhängigen Herstellung der Bauteile und ihre Montage vor Ort bildet die Grundlage für den heute erreichten Stand der Fertigungstechnik und des Systembaus. Es ist, wie an historischen Beispielen gezeigt wird, kein Zufall, dass sowohl die Entwicklung von Bausystemen wie auch von Fertighäusern ihren Ausgang im Holzbau nimmt.
• Im dritten Teil „Für und wider Holz“ wird die aktuelle Tendenz zum mehrgeschossigen Hausbau im innerstädtischen Kontext aufgegriffen. Bis dato handelt es sich um „Exoten“, die nichts mehr von der Selbstverständlichkeit, die das städtische Holzhaus historisch besaß, ahnen lassen. Von daher sind neben praktischen bautechnischen Fragen und dem Vergleich der Vor- und Nachteile reiner Holzbauten mit den verschiedenen Formen der Mischbauweise vor allem Imagefragen angesprochen. Sie sind zurzeit für Materialentscheidungen wahrscheinlich genauso maßgeblich wie funktionale Erwägungen.
• Im vierten Teil „Mit dem Holz oder gegen das Holz bauen“ schließlich geht es um die Perspektiven des Bauens mit Holz. Es nimmt in den avancierten digitalen Entwurfs- und Fertigungstechniken eindeutig eine Vorreiterrolle ein. Eine ganze Serie experimenteller Projekte, die in diesem Kontext neu entstanden sind, wird mit einem gänzlich anderen Vorgehen und den entsprechenden Projekten konfrontiert, das insofern ungewöhnlich ist, als es sich in besonderem Maße die Eigenschaften des Werkstoffs Holz zunutze macht. In der Synthese dieser beiden Herangehensweisen liegt ein noch nicht erschlossenes Potenzial des Bauens mit Holz.
Sabine Kraft, Christoph Schindler
Für die vielen Anregungen, die in diese Ausgabe eingeflossen sind, bedanken wir uns herzlich bei Bruno Schindler.
Inhalt
02 Showtime!
Christian Demand
04 ARCH im Darwinjahr – Diskussion um Heft 188
06 Rezensionen
08 Bücher zum Thema „Holz“
Editorial
12 Holz – eine lange Geschichte ...
14 Der lange Weg vom Stab zur Platte
16 Konstruieren: Vom Stab zur Platte
Konrad Merz
18 Die Stabkonstruktion aus Holz
Gottfried Semper
20 Von Rutschbergen und Scream Machines
Sabine Kraft
22 Baumstützen im tropischen Regenwald
Marcos Acayaba
26 Wovon wir reden, wenn wir von Holz reden
Christoph Schindler
27 Holz: indifferent, synthetisch, abstrakt – Kunststoff
Andrea Deplazes
30 Bauen mit Massivholz
Geir Brendeland, Olav Kristoffersen
35 Genagelt und geschraubt
Christoph Schindler
36 Der kleine Schritt von Vorfertigung zum Fertighaus
38 Holzbausysteme: Konstruktion und Fertigung
Josef Kolb
42 Bauteile ab Werk: Hochregallager
Kaufmann Bausysteme
44 Bauen mit Modulen: Impulszentrum Graz
Hubert Rieß
46 Zur Geschichte der Holzbausysteme
Sandra Tabea Hirschler
50 Holz mobil
mit Fotos von Trude Lukascek
51 M-Velope
Michael Jantzen
52 Standardisierung im traditionellen japanischen Holzbau
Der Zimmermann – Bruno Taut
Japanische Baumaße – Ernst Neufert
56 Holz in der Wiederverwendung
Christoph Schindler
59 Das Schweizer Haus: Keimzelle des Fertigbaus
Edwin Huwyler, Karin von Wietersheim Eskioglou
62 Für und wider Holz
64 Vorrang für die stoffliche Nutzung von Holz
Ludger Dederich im Gespräch mit ARCH
69 Imageoffensive
Sabine Kraft
73 Wir sind dem Holz egal
Wolfgang Pauser
74 Holzhäuser in Istanbul
mit Fotos von Fritz Dressler
78 Der andere Holzbau – drei, vier, viele Geschosse
Anton Steurer, Charles von Büren
86 Mit dem Holz oder gegen das Holz bauen?
88 Die Bedeutung der Materialien – Holz
Frank Lloyd Wright
90 Bauen – mit dem Holz oder gegen das Holz?
Sabine Kraft, Christoph Schindler
93 Digitale Schreinerei
Sabine Kraft, Christoph Schindler
98 Biegen oder Brechen
Wilhelm Franz Exner
100 Spannbandbrücken
Richard J. Dietrich
102 Trabucchi: ultrastabile Holzkonstruktionen für den Fischfang
Franco Laner
104 Wikinger Schiffe: elastische Holzkonstruktionen für die Seefahrt
Michael Hensel
106 Holz-Form-Findung
Michael Hensel, Achim Menges
110 Ein Haus ist kein Segelschiff
Wolfgang Pöschl
112 Autoren von Heft 193
113 Baufokus
114 Holzbehandlung
115 Holzwerkstoffe
117 Holz-Bausysteme
118 Holz verbinden
119 Holz verformen
Bauen mit Massivholz
Holz war uns immer gegenwärtig. Das macht der norwegische Hintergrund. Gegenwärtig in der Natur und gegenwärtig als Bau-material. Wir sind an Holz im Außen- und Innenraum, in den Städten und auf dem Land gewöhnt. Der maschinell gefertigte Blockbau eines Bauernhauses von 1928 oder der vor 200 Jahren konstruierte Speicher eben dieses Bauernhofes. Die unbehandelte Holzfassade einer Hütte, die Südwand von der Sonne gebleicht, die Nordseite einheitlich grau. Eine Vielfalt von Bauweisen: Stabkirchen, alte Bauernhöfe, Boote, Brücken, große Hotels aus den 1890er Jahren im Chaletstil, Milchrampen, Gestelle zum Trocknen des Stockfisches im hohen Norden, große Anwesen des reichen Bürgertums aus dem 18. Jahrhundert in Trondheim. Alles aus Holz.
Als Kinder haben wir Hütten aus Holzresten gebaut, alle beide. Wir haben Bäume im Wald gefällt und beim Wandern Feuer gemacht. Denken wir an Häuser, oder genauer: an alte Häuser, dann unmittelbar an Holz, seine Maserung, seinen Geruch und an den Klang eines alten Holzfußbodens, wenn man darüber läuft. Risse, Muster und Äste in der Decke beflügeln die Phantasie eines Kindes, das im Liegen nach oben schaut.
1948 stellte der norwegische Bauunternehmer Selmer die kostengünstige Holzrahmenbauweise als preiswerte Möglichkeit vor, Wohnraum für die Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg zu schaffen. Es war eine Herausforderung der herrschenden Doktrin, die in Norwegen zu einer neuen Denkweise bezüglich Holzbau führte. Mit Unterstützung der norwegischen Regierung durch steuerliche Anreize und einer staatlichen Bausparkasse wurde der Holzbau zur konstruktiven Lösung für Hunderttausende von Einfamilienhäusern. In größeren Projekten jedoch setzten sich Beton und Stahl gegenüber Holz und Mauerwerk durch. Eine große Anzahl von Holzbauten in den Städten wurde abgerissen und durch Gebäude aus nichtbrennbaren Materialien ersetzt. Diese Erneuerungen waren zwar zeitgemäß, aber für viele Norweger architektonisch nicht so ansprechend wie ihre hölzernen Vorgänger. In den siebziger und achtziger Jahren begannen junge Leute sich für die Reize der erhaltenen alten Holzbauten, die sie in den norwegischen Städten entdeckten, zu interessieren. Sie hatten nicht mehr das Vorurteil ihrer Eltern gegenüber dem Leben in ärmlichen Arbeitervierteln. Darüber hinaus fand seit den neunziger Jahren ein Bauboom auf dem Land statt, bei dem wohlhabende Norweger Wochenendhäuser aus Holz bauten in Nachahmung der traditionelle Blockbauten, die mit Doppelgaragen, mehreren Badezimmern und Flachbildfernsehern ausgestattet wurden.
Als wir 2002 an dem Wettbewerb für „Neue Wohnbauten in Svartlamoen“ teilnahmen, bestand die praktikabelste Konstruktion für mehrgeschossige Bauten aus vorgefertigten Betonplatten auf feuergeschützten Stahlstützen, außen mit nichtbrennbaren Materialien verschalt und innen mit Gipskarton ausgekleidet. Das Wettbewerbsprogramm forderte jedoch für die neuen Gebäude eine Holzkonstruktion und daher begannen wir, vor allem wegen der Brandschutzvorschriften, uns mit den Möglichkeiten von Massivholzelementen auseinanderzusetzen. An dieser ersten Begegnung entzündete sich unser Interesse und seitdem haben wir das architektonische Potenzial dieser Bautechnik in einer Reihe verschiedener Projekte untersucht.
Brettsperrholzelemente
Es gibt verschiedene Arten von Massivholzelementen von einer Reihe verschiedener Hersteller aus verschiedenen Ländern. In unserer Arbeit haben wir sogenannte Brettsperrholzelemente verwendet, die aus mehreren Lagen kreuzweise verleimter Bretter bestehen. Brettsperrholzelemente sind ein Massenprodukt, das per Kubikmeter bestellt werden kann. Standardelemente bestehen üblicherweise aus niederklassiger Fichte, aber die Sichtoberfläche oder auch die anderen Schichten können in verschiedenen Qualitäten oder sogar in verschiedenen Holzarten bestellt werden.
Die Abmessungen eines Elements sind vor allem durch die Transportmittel zwischen Hersteller und Baustelle beschränkt. Die Hersteller bieten Elemente mit standardisierter Breite, in verschiedenen Stan-darddicken bzw. Lagenanzahl an. Die Form der Elemente kann vom Hersteller mit präzisen computergesteuerten Fräsmaschinen oder auf der Baustelle von einem Zimmermann weiter bearbeitet werden.
Materialität, Oberfläche und Präsenz
Ein Massivholzelement besteht durch und durch aus Holz. Wird die Oberfläche des Elements entfernt, ist es immer noch das gleiche Material. Es vermittelt eine Dichte, Festigkeit und ein Gefühl von Qualität, das mit den vergleichsweise windigen Holzrahmenkonstruktionen nicht zu erreichen ist. Dieses Gefühl verstärkt sich, wenn alle Oberflächen eines Innenraumes gleich gestaltet sind: Wände, Böden und Decken, Möbelstücke und Innentüren. Der Raum scheint aus einem einzigen Block herausgeschnitzt zu sein, ist aber dennoch mehrdeutig, da die einzelnen Elemente und die Bretter innerhalb dieser Elemente lesbar bleiben. In unserem Reihenhausprojekt in Longyearbyen haben wir Massivholzelemente sogar auf den Außenwänden angebracht, um den Eindruck einer scheinbar monolithischen, vollständig aus Massivholz bestehenden Struktur zu erwecken.
Standardelemente sind eben und legen eine abstrakte und einfache Architektur mit ebenen Oberflächen nahe. Winzige Variationen in Oberfläche, Farbe und Maserung reflektieren das Tageslicht auf subtile Weise. Die Oberfläche ist fest, jedoch weich genug, um die Spuren von Gebrauch und Leben innerhalb des Gebäudes aufzunehmen, wodurch sie im Lauf der Zeit immer interessanter wird. Die Farben verändern sich durch ultraviolettes Licht und Oxidation und dunkeln allmählich nach. Die Fasern scheinen lebendig zu sein und reagieren auf Feuchtigkeitswechsel mit Rissen und neuen Mustern. Die Oberfläche fühlt sich wärmer an als Gips oder Mauerwerk, sie eignet sich für das nördliche Klima. Aber während der warmen und sonnigen Sommer kühlt das Holz dennoch den Innenraum.
Wir lassen die Massivholzelemente gerne unbehandelt, wodurch wir den Einsatz von Chemikalien vermeiden und den Unterhaltsbedarf verringern. Nur die Fußböden und Details, die besonderen Schutz vor Schmutz und Wasser benötigen, werden mit einem transparenten, farblosen Lack überzogen. Die Oberflächen können während ihrer Lebensdauer geschliffen oder gestrichen, neue Öffnungen mit einer Kettensäge hinzugefügt werden, die Benutzer können schwere Möbel an den Wänden befestigen.
Vereinfachte Konstruktion
Ein Massivholzelement kann mehrere Funktionen gleichzeitig übernehmen, während bei der Holzrahmenbau-weise jede der zahlreichen Schichten ihre eigene spezifische Funktion erfüllt. Als konstruktives System tragen Massivholzelemente in sich das Potenzial für weniger komplexe und daher weniger riskante Detaillierung als der Holzrahmenbau. Massivholz kann zugleich als optische Trennung und Sichtoberfläche, Lastabtragung und Aussteifung, Brandschutz des Tragwerks und Unterteilung in Brandabschnitte, thermische Masse und Dampfbremse agieren. Bis zu einem gewissen Grad kann es sogar die Funktionen von Windbremse, Schallschutz, Wärmedämmung und Verkleidung erfüllen. Elektrische Leitungsführung, Anschlussdosen, Schalter und Beleuchtung können in Massivholzelemente integriert werden, wie wir dies in einer Reihe von Projekten getan haben, obwohl dies eine sehr sorgfältige Planung und gute Koordination auf der Baustelle erfordert.
Massivholz brennt in einer voraussagbaren Geschwindigkeit ab, wodurch es einfach wird, die notwendige Dicke der Elemente zu berechnen, um die Brandschutzanforderungen einzuhalten. Die zusätzliche Dicke der Wände und Scheiben schützt die Tragwerksfunktion und wirkt gleichzeitig als Brandabschnittstrennung. Grundsätzlich ist keine besondere Oberflächenbehandlung notwendig, um die norwegische Brandschutzverordnung zu erfüllen. In Svartlamoen setzten wir eine Sprinkleranlage ein. Sie war nicht wegen des Holztragwerks notwendig, sondern wegen der Nähe zu den benachbarten Holzbauten.
Das Svartlamoen Projekt bewältigte den Trittschallschutz mit einem speziell entwickelten schwimmenden Holzfußboden auf der Massivholzscheibe. Die größte Herausforderung lag darin, eine ökonomische Lösung für die Verbindung von sichtbarer Holzoberfläche und Schallschutzanforderungen zu finden. Zu unserer Erleichterung bestätigten die nach Vollendung des Gebäudes durchgeführten Messungen die Zulässigkeit unserer Lösung. Da sich der Bauplatz in der Nähe des Meeres befindet, wurden die Stöße zwischen den Elementen so entwickelt und berechnet, dass sie schweren Windlasten auf die Fassade Stand halten können. Nur die Außenwände sind lastabtragend; das bietet für künftige Sanierungen bzw. Veränderungen bessere Möglichkeiten. Massivholzelemente bilden im Vergleich zu Beton- und Stahlkonstruktionen ein relativ leichtes Tragwerk. Auf dem schwierigen Untergrund dieses Bauplatzes erlaubte die Massivholzkonstruktion deutlich kleinere und günstigere Fundamente.
Im Kindergarten in Svartlamoen von 2007, der eine Umnutzung eines Autohauses von 1983 ist, beschäftigten wir uns mit komplexen CNC-Fräsungen. Alle Holzelemente haben eine Form, die mit ihrer Position im Gebäude korrespondiert. Geneigte Wände, stumpfe und spitze Winkel, Türöffnungen, innenliegende Fenster und Luftkanäle sowie Einpassungen in die bestehende Struktur modifizieren die Elemente. Mit Hilfe eines 3D-Modells konnten wir jedes Element für seinen spezifischen Zweck gestalten und fräsen. Sogar die Einbaumöbel aus Massivholz wurden auf diese Weise gefertigt. 120 mm Massivholz erfüllte die Schallschutzanforderungen des Auftraggebers ohne zusätzliche Schichten.
Bei den Reihenhäusern in Longyearbyen von 2007 waren Logistik und ungewöhnliche klimatische Bedingungen die größten Herausforderungen. Jedes Teil dieser Gebäude wurde gezeichnet, gefertigt, in Transportcontainer verpackt und auf diese abgelegene Insel verschifft, um eine schnelle Montage während des kurzen arktischen Sommers zu ermöglichen. Allerdings hatte ein Mitarbeiter falsche Zahlen in die Fräsmaschine eingegeben und ein wichtiges Element wurde in fehlerhafter Form geliefert. Zum Glück war es etwas zu groß, so dass die Zimmerleute es auf der Baustelle mit einer Kettensäge korrigieren konnten. Die innenliegenden Decken, Türen, Treppenhäuser und einige Einbaumöbel sind Massivholzelemente ohne weitere Schichten. Alle anderen Bauteile bestehen aus drei Schichten – die Außenwände: lastabtragende 100 mm Massivholz, Mineralwolle mit Holzabstandshaltern und 60 mm Verkleidung aus Massivholz (in Abstimmung mit dem Farbschema des lokalen Gestaltungsplans), das Dach: Massivholz, Mineralwolle und einer Dachmembran, die Wohnungstrennwände: Massivholz, Mineralwolle, Massivholz. Als Faustregel gilt, dass der Preis eines Elements direkt proportional zu seinem Volumen ist. Um den strengen Wärmedämmanforderungen zu entsprechen, ist es wirtschaftlicher, eine Dämmschicht hinzuzufügen, als die Dicke des Elements zu erhöhen.
In unserer Villa in Ranheim von 2008 gehen große horizontale Massivholzelemente, Brettschichtholzträger und vertikale Ständer eine statische Einheit ein und bilden nahezu ein Monocoque, das von 6 Stahlstützen in Form eines auf dem Kopf stehenden Vs getragen wird. Bei diesem Gebäude hatte der Hersteller nicht genug Zeit, um die Fensteröffnungen zu fräsen, da die Bestellung knapp vor den Sommerferien in Auftrag gegeben wurde und der Bauunternehmer das Aufrichten während der Ferien ausführen wollte. Aus diesem Grund mussten die Fenster auf der Baustelle mit einer Handkreissäge ausgeschnitten werden.
Feuchtigkeitsausgleich
Holz quillt und schwindet gemäß seinem Feuchtigkeitsgehalt. Die Schwankungen in den Abmessungen eines Holzstücks sind quer zur Faser größer als in Faserrichtung. Da die verschiedenen Schichten eines Elementes kreuzweise miteinander verleimt sind, bleiben die Gesamtabmessungen eines Massivholzelements bemerkenswert konstant, während Veränderungen des Feuchtigkeitsgehaltes Spannungen aufbauen, die letztendlich zu Rissen in der Oberfläche führen können. Risse dieser Art kommen auch häufig in den Blockbauwänden und Dielenböden traditioneller norwegischer Holzbauten vor.
In Longyearbyen haben wir Elemente aus einem besonders gut getrockneten Holz verwendet, die während Lagerung und Transport speziell geschützt wurden. Die relative Luftfeuchtigkeit in dieser arktischen Wüste ist während des langen Winters nahezu Null. Ein Jahr nach der Fertigstellung zeigten die Oberflächen im Innenraum einige Risse, jedoch nicht mehr als erwartet. Da unverkleidetes Massivholz im Innenraum Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann, stabilisiert es den Feuchtigkeitsgehalt im Innern des Gebäudes. Ein Badezimmer oder eine Küche mit einer Decke aus unbehandeltem Holz fühlt sich nicht so feucht an wie eine mit Latexfarbe gestrichene Gipskartonplatte. In Longyearbyen haben die Bewohner festgestellt, dass sie nach dem Duschen nicht einmal den Spiegel zu wischen brauchten, da die Decke die Feuchtigkeit absorbiert.
Massivholzelemente dürfen, wenn sie trocken sind, als dampfdicht betrachtet werden. Selbst in einem sauber gebauten Kompaktdach gibt es keinen Grund für eine Dampfbremse. Allerdings sollte der Ausführung der Stöße besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, um Spalten und kleine Öffnungen zu vermeiden. Spalten können zur Kondensation innerhalb des Wandaufbaus und zum ungewolltem Eindringen von Außenluft führen. In der hohen Arktis sind die Konsequenzen schwerwiegender als auf dem norwegischen Festland. In einigen undichten Holzrahmenbauten enthielten dort Dach und Wohnungstrennwände bereits nach einer einzigen Wintersaison hunderte Kilo von Eis.
Fügen, Auseinandernehmen, Wiederverwendung und Recycling
Massivholzwände werden üblicherweise mit langen Schrauben sowie Nut- und Federverbindungen gefügt. Die notwendige Anzahl und die Abstände zwischen den Schrauben werden von einem Tragwerksingenieur berechnet. Diese Schrauben sind meist selbstschneidend und manche haben an ihren beiden Enden eine unterschiedliche Gewindesteigung, wodurch die Schraube beim Anziehen die Elemente zusammenzieht. Ein Vorteil beim Einsatz von Schrauben ist die Justierung der Elemente nach dem Fügen.
Außerdem kann die Struktur relativ einfach wieder auseinandergenommen werden, wenn sie saniert, verändert oder entfernt werden soll. Gebrauchte Elemente können grundsätzlich an neue Strukturen angepasst und wiederverwendet oder auch weiter aufgetrennt werden, um zu Spanplatten, Pellets, Brennholz usw. verarbeitet zu werden.
Da die Bauweise relativ neu ist, haben bislang nur sehr wenige Gebäude aus Massivholz einen kompletten Lebenszyklus durchlaufen. Für den Designmai 2005 in Berlin haben wir eine Massivholzhütte in den Edison Höfen in Berlin gebaut, die mit Erfolg auseinandergenommen, umgesetzt und in Neustrelitz wieder zusammengefügt wurde. Ein anderes kleines Gebäude, das wir für 100 % Design in London realisierten, wurde anschließend demontiert und in Einzelteilen in einem Londoner Lagergebäude aufbewahrt, bereit für einen neuen Einsatz.
Mit vorgefertigten Elementen gibt es bei sorgfältiger Planung nur wenig Abfall auf der Baustelle. Bei dem Wohnbau in Longyearbyen kam jedes Massivholzelement zum Einsatz, das auf die abgelegene Insel verschifft wurde. Selbst die Verschnittflächen von Kochfeld und Spüle wurden als Schneidebrett genutzt.
Baupraxis
Massivholzelemente sollten vorsichtig behandelt werden während des Transports, der Lagerung auf der Baustelle, dem Aufrichten und während der ersten Heizwochen nach dem Schließen der Gebäudehülle. Dies gilt insbesondere, wenn die Elemente als innere Sichtoberfläche gedacht sind. Abdrücke von Gabelstaplern, eingedrückte Seitenkanten und merkwürdige Fußspuren quer über Wände und Decken scheinen bei der Arbeit mit unerfahrenen Handwerkern an der Tagesordnung zu sein. Es empfiehlt sich ein Crashkurs mit allen Baubeteiligten (inklusive Installateuren, Elektrikern usw.) über das Bauen mit Massivholz. Unserer Erfahrung nach sollte ein erfahrener Zimmermann mit einbezogen werden, um an den letzten Tagen vor Fertigstellung mit kleinen Reparaturen und Korrekturen nachbessern zu können.
Freie Bewitterung über mehrere Tage kann das Wachstum von Pilzen anregen, die auf den Oberflächen graue Flecken hinterlassen. Oberflächen, die während der Bauzeit nass geworden sind, neigen auch zum stellenweisen Verwerfen oder Reißen, da die Qualität und Sortierung von Brettern in Standardelementen meist nicht die aller-beste ist. Einige Hersteller verwenden gut getrocknetes, hochwertiges Holz und drehen sogar alle sichtbaren Bretter mit der Kernseite nach außen, um die Oberfläche stabiler und homogener zu machen.
Bei unseren Projekten in Longyearbyen und Ranheim schützte der Hersteller die Sichtoberflächen mit einer Plastikfolie, die vom Bauunternehmer nach Fertigstellung der Gebäude entfernt wurde. Dies vermeidet nicht nur Schäden durch Regenwasser, sondern verhindert auch Flecken und Farbunterschiede infolge ungleicher Sonneneinstrahlung, bevor die Außenwände, das Dach und die Fenster positioniert werden. Abgesehen davon macht es Spaß, die Innenwände des fertigen Baus vor den Augen eines gespannten Auftraggebers zu enthüllen.
Der Einfluss des Architekten
Die alles in den Schatten stellende Forderung nach Kostengünstigkeit im Bauwesen führt zur Bevorzugung desjenigen Bauunternehmers, der weniger Arbeitsstunden benötigt und weniger gut ausgebildete (also günstigere) Arbeitskräfte einsetzt als seine Mitbewerber. Diese Tendenz ist eine wesentliche Quelle für Ausführungsschäden, beschränkte technische Qualität und Kopfschmerzen des Architekten. Wenn Fehler begangen worden sind, wird der Bauunternehmer eher vorschlagen, das Problem auf „kreative Weise“ zu bereinigen als noch einmal abzubrechen und die betroffenen Teile neu zu bauen mit dem Risiko, den vereinbarten Termin nicht halten zu können.
Bauen mit Massivholzelementen ist ein wenig anders, da die Elemente meistens im Voraus von einem Hersteller maßgeschneidert und anschließend von einem Bauunternehmer geprüft werden, wenn sie auf der Baustelle ankommen. Wenn der Hersteller während Fertigung oder Transport einen Fehler begangen hat, wäre er verpflichtet, neue fehlerfreie Elemente zu seinen Lasten auszuführen. Da die Elemente verschiedene Formen und Eigenschaften haben, die wie ein großmaßstäbliches Puzzle zusammenpassen, gibt es in vielen Fällen nur eine einzige Art, sie korrekt zu fügen. Ein Fehler bei der Montage würde den Bauunternehmer zwingen, die betroffenen Elemente wieder auseinander zu nehmen und von vorne zu beginnen. Um diesem Risiko zu begegnen, werden (unserer Erfahrung nach) Zeichnungen und Beschreibungen sowohl von Herstellern als auch Ausführenden peinlich genau befolgt. Dies gibt dem Architekten mehr Einfluss auf die Qualität des fertigen Gebäudes und gleichzeitig eine größere Verantwortung für die Korrektheit seiner Zeichnungen und Beschreibungen. Der Architekt kann sogar wesentliche Aspekte der Detaillierung in die Form der gefrästen Elemente integrieren, um den Einfluss möglicherweise schlechter Ausführung auf der Baustelle und um die Bauzeit zu verringern.
Wir fertigen die Werkstattzeichnungen für die Fräse betriebsintern, um den größeren Einfluss auf die Qualität des Gebäude nutzen zu können. Unserer Ansicht nach ist dies eine der interessantesten Eigenschaften der Massivbauweise im Vergleich zu herkömmlichen Holzrahmenkonstruktionen und anderen in situ Bauweisen. In all unseren Massivholz-Projekten bat der Hersteller um Pdf-Dateien mit 2D-Zeichnungen, die wir aus unseren 3D-Modellen ableiteten. Die Zeichnungen beinhalteten bereits alle Toleranzen und Details. Ein Mitarbeiter gab dann auf dieser zeichnerischen Grundlage manuell die Abmessungen und Winkel in ein CAM-Programm ein, ein zusätzliches Fehlerrisiko. Die Möglichkeit der direkten Weiterverarbeitung importierter 3D-Zeichnungen auf einem CNC-Bearbeitungszentrum bestand in unserem Fall nicht.
Klebstoff, Nägel und Dübel
Holz als Baustoff hat eine lange Geschichte. Moderne Klebstoffe haben das nicht. Werden sich Brettsperrholzelemente im Verlauf der Zeit aufblättern und eine Gefahr für Leib und Gut darstellen? Wird der Klebstoff „verschwinden“ nachdem das Holz verrottet ist, oder wird er länger in der Natur verbleiben und ein ökologisches oder ästhetisches Problem darstellen, während er sich langsam zersetzt? Die verschiedenen Hersteller verwenden unterschiedliche Klebstoffe und geben unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Zudem machen sie den Anspruch geltend, ihr Klebstoff wäre dauerhaft und nicht schädlich für Menschen während Verarbeitung, Montage, Nutzung, Demontage oder Brand.
Die Bretter eines Elements können auch mit Holzdübeln oder Nägeln anstatt Klebstoff zusammengehalten werden. Ähnliche Fragen kommen auf: Wie dauerhaft sind diese Elemente? Könnten die Dübel ihren Halt verlieren, könnte das Gebäude sich im Lauf der Zeit verformen oder sogar in sich zusammenstürzen? Einige der verdübelten Elemente haben interne Holzschichten für besondere strukturelle Anforderungen, z.B. als Verstärkung oberhalb einer Fensteröffnung. Solche Elemente sind kaum wiederzuverwenden ohne eine detaillierte Dokumentation. Dies könnte Bauunternehmer dazu veranlassen, gebrauchte Elemente eher weiter aufzutrennen als sie für ein neues Bauprojekt zu verwenden, wodurch ein potenzieller Vorteil des Massivholzes vergeben würde.
Eine Architektur in Massivholz
Jede Bauweise hat ihre Schwachpunkte und unbekannten Faktoren. Die obigen Fragen werden hoffentlich in Zukunft mit Ausreifen der Bautechnik beantwortet werden können. Niemand weiß genau, wie sich ein Gebäude aus Stahlbeton langfristig verhalten wird, aber wir haben heute ein besseres Verständnis seiner Eigenarten als vor hundert Jahren. Mit Sicherheit aber können wir sagen, dass sich aus Stahlbeton exquisite und zweckdienliche Architektur machen lässt. Offenkundig lässt sich damit, wie aus jedem anderen Baumaterial, auch schlechte und wenig nachhaltige Architektur machen. Es ist daher ein großes Privileg, an einer gemeinsamen Anstrengung um eine nachhaltige Architektur für den Massivholzbau teilzuhaben, eine Architektur, die andere bautechnisch etablierte Architekturen ergänzen kann.ARCH+, Di., 2009.09.29
29. September 2009 Geir Brendeland, Olav Kristoffersen