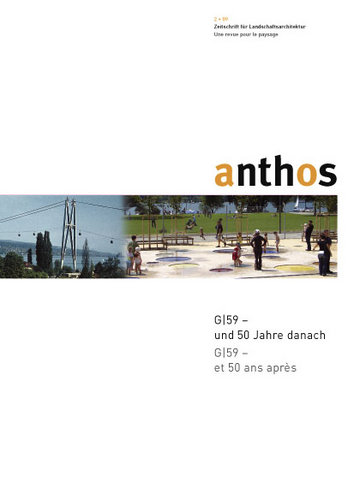Editorial
Grosse Jubiläen sind selten in der Schweizer Landschaftsarchitektur. Lasst sie uns deshalb feiern! Vor 50 Jahren, am 25. April 1959, öffnete die 1. Schweizerische Gartenbau-Ausstellung (G|59) in Zürich ihre Tore und versetzte die Stadt sechs Monate lang in Festtagsstimmung. Erst zwei Jahrzehnte später gelang es, mit der Grün 80 in Basel eine zweite nationale Ausstellung durchzuführen – die dann leider auch die letzte war. Weitere Versuche scheiterten. Umso höher ist die Leistung der acht beteiligten nationalen und regionalen Berufsverbände einzuschätzen, die 1959 zusammen mit der Stadt Zürich dieses grosse Ereignis organisiert haben.
Einer der wesentlichen Akteure der G|59 war der damalige Bund Schweizerischer Gartengestalter BSG (heute BSLA). Bedeutende Landschaftsarchitekten jener Zeit wurden in die Gestaltung einbezogen, so Johannes Schweizer, Klaus und Walter Leder, Fredy Klauser auf der linken, Ernst Baumann, Willi Neukom und Ernst Cramer auf der rechten Seeseite. Diese setzten Massstäbe und sorgten für eine landschaftsarchitektonische Stildiskussion weit über die Landesgrenzen hinaus.
Teile der Ausstellung blieben in ihrer Substanz bis heute erhalten, wie der Hexagonale Garten in der Enge, andere leben noch als Mythos fort, wie der Garten des Poeten. Die Bedeutung für die Stadt Zürich geht jedoch weit über die gestalterischen Highlights hinaus. Denn mit der G|59 wurde eine grossräumige, zum See hin geöffnete Parklandschaft geschaffen und damit der wertvollste Erholungsraum für die Bevölkerung von Stadt und Region.
anthos möchte mit diesem Heft die Bedeutung der G|59 reflektieren und aufzeigen, wie wir heute mit diesem grossartigen Erbe umgehen. Die Ansprüche an die Seeufer – und an den öffentlichen Raum überhaupt – haben sich gewandelt. Der Nutzungsdruck ist grösser geworden, temporäre Events und Sponsoreninteressen stehen oft im Widerspruch zur allgemeinen Nutzbarkeit für die Bevölkerung. Festivalisierung, Privatisierung und Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes sind aktuelle gesellschaftliche Prozesse.
anthos berichtet über die städtischen Instrumente, mit denen die Entwicklung am Zürichsee in geordnete Bahnen gelenkt werden soll. Neben dem Grünbuch von Grün Stadt Zürich sind dies vor allem der Masterplan für das Zürichhorn sowie Strategien zum Grünflächenmanagement. Das neuste Instrument ist ein wegweisendes, breit angelegtes Leitbild für das Zürcher Seebecken, das Kanton und Stadt gemeinsam erarbeitet haben.
Die G|59 war ein Markstein in der Entwicklung der Zürcher Uferlandschaft. Es ist unsere Pflicht, ihr Erbe auch für die Zukunft zu sichern.
Bernd Schubert
Inhalt
- Editorial
Annemarie Bucher
- Die G|59. Zwischen Blumen-Landi und abstrakt-modernen Gartenexperimenten
Judith Rohrer
- G|59 – ein herausforderndes Erbe
Gabor Oplatka
- Die Gondelbahn der G|59 über den Zürichsee
Stefan Rotzler
- 50 Jahre «Garten des Poeten» von Ernst Cramer
Annemarie Bucher und Sabine Wolf
- Fundstücke, oder das Seebecken als «Kunstlandschaft»
Bernd Schubert und Sabine Wolf
- Festival Zürich
Walter Vetsch
- Neu- und Umgestaltungen am Zürichhorn
Guido Hager
- Zwischen Bürkliplatz und Arboretum
Sara Landolt und André Odermatt
- Seeanlagen Zürich: Paradies unter Druck?
Hans-Jürg Bosshard und Reto Sigel
- Von der Grünflächenpflege zum Grünflächenmanagement
Margrith Göldi Hofbauer und Nica Pola
- Ein Leitbild für das Seebecken der Stadt Zürich
- Wettbewerbe und Preise
- Mitteilungen der Hochschulen
- Schlaglichter
- Literatur
- Agenda
- Schweizer Baumschulen
- Produkte und Dienstleistungen
- Markt
- Die Autoren
- Impressum
Die G|59
(SUBTITLE) Zwischen Blumen-Landi und abstrakt-modernen Gartenexperimenten
Am gleichen Ort wie zwanzig Jahre zuvor die «Landi 39», ein Jahr nach der «Saffa» 1958 und fast gleichzeitig mit der Bundesgartenschau in Dortmund, öffnete am 25. April 1959 die erste Schweizerische Gartenbau-Ausstellung ihre Tore. 50 Jahre danach sind ihre Impulse noch spürbar.
Die Planung und Realisierung der G|59 war dem Zusammenschluss nationaler und regionaler Berufsverbände zu verdanken. Die Trägerschaft setzte sich zusammen aus dem Verband Schweizer Gärtnermeister, dem Gärtnermeisterverband Zürich, der Association des Horticulteurs de la Suisse Romande, dem Verband Schweizerischer Topfpflanzen-Gärtnereien, dem Verband Schweizerischer Baumschulbesitzer, dem Schweizerischen Floristen-Verband, der Gemüseproduzenten-Vereinigung des Kantons Zürich und dem Bund Schweizerischer Gartengestalter (BSG).
Zwischen Gewerbeförderung und moderner Ideenplattform
Die unterschiedlichen Ansprüche und Erwartungen der einzelnen Träger unter einen Hut zu bringen, erwies sich als schwieriger Balanceakt. Entsprechend offen war die Leitidee formuliert: Im Zentrum der G|59 stand schweizerisches Gartenschaffen auf der Suche nach einer neuen Linie, die sowohl für die gewerblichen als auch für die gestalterischen Berufe gelten sollte. Das Programm orientierte sich an der bewährten Struktur deutscher Gartenschauen. Es beinhaltete temporäre Pflanzen- und Gewerbeschauen in Hallen sowie im Freien, vielfältige Themengärten und ein reichhaltiges Begleitprogramm, das von Kunstausstellungen bis zu Modeschauen reichte.
Der Gesamtplan
Die G|59 fand an beiden Zürichseeufern statt, die wie einst an der Landi und später an der Saffa durch Schiffe und eine über den See schwebende Gondelbahn (siehe Artikel Oplatka, Seite18) miteinander verbunden wurden. Letztere verlief über 55 Meter hohe Pylone, die als moderne Ingenieurswerke die Silhouette der Stadt und die Wahrnehmung der Ausstellung mitprägten. Auch die umliegende Landschaft, der Ausblick auf die Alpen und den See, wurden in die Ausstellung integriert. Insbesondere der Bezug zum See war ein neues Element, das die landschaftsarchitektonische Gestaltung prägte.
Unter der architektonischen Leitung von Werner Stücheli und Paul R. Kollbrunner entstanden an beiden Ufern zahlreiche schlichte, moderne Ausstellungsarchitekturen, die auf einem kubischen System aufbauten und sich der Gesamtstruktur unterordneten. Eine grössere Messefläche wurde am rechten Ufer durch eine Folge von quadratischen Räumen gebildet, die alternierend offen oder als Pavillons überdeckt waren. Eine Ausnahme bot die «Rotonde» auf dem Zürichhorn, ein nach dem Konstruktionssystem von Buckminster Fuller gebautes Kuppelzelt. Als Ganzes wirkte der Gesamtplan zwar homogen, die Ausstellungsufer trugen jedoch verschiedene Handschriften, war auch die Verantwortung dafür verschiedenen Planergemeinschaften übertragen worden.
Das linke Ufer
Das Gelände am linken Seeufer wurde von Johannes Schweizer sowie Klaus und Walter Leder konzipiert. Sie erreichten eine optimale Verbindung zwischen den Erholungsflächen am See und im Belvoirpark, indem sie eine grossflächige Fussgängerüberführung von 50_150 Metern über die Ausfallstrasse bauten und diese als Piazza ausgestalteten. Dort gab es Unterhaltungs- und Restaurationsmöglichkeiten, Miniaturgärten in Tischgrösse («Tischgärten») und Topfpflanzen-Ausstellungen.
Von den Themengärten am linken Ufer erregten vor allem der hexagonale Garten sowie der Staudengarten Aufmerksamkeit. Ersterer bildete am Haupteingang eine dekorative wabenförmige Struktur, die von der reinen Bodenzeichnung über bunte Blumenrabatten bis zu den Wasserbecken formbestimmend war. Im Zusammenspiel mit den «gewachsenen» Strukturen der Bäume und Pflanzen ergab sich ein eigentümlich modern anmutendes Spannungsmoment. Ähnlich markante geometrische Formen kamen im Staudengarten von Klaus und Walter Leder zum Ausdruck. Aus der Fläche gehobene, backsteingefasste Dreiecke bildeten das Raster für die Bepflanzung. Eine deutsche Kritikerin fühlte sich dabei an Panzersperren erinnert.
Der grosse Publikumserfolg des linken Ufers waren die Wasserspiele und Springbrunnen. Auf der Belvoir-Terrasse richteten Johannes Schweizer und Walter und Klaus Leder ein Springbrunnenparterre mit Lübecker Wasserspielen ein, für den seeseitigen Eingang des Belvoirparks zeichneten sie verantwortlich für einen von einer Pergola gerahmten Wassergarten mit einem spektakulären Springbrunnen. Ein streng geometrisch geordnetes Blumenparterre (Walter und Klaus Leder, Johannes Schweizer), ein fröhlich-bunter Sommerblumenteppich (Fredy Klauser, Rorschach) und ein Bündner Berggarten (August Eisenring, Thusis) setzten die Reihe der Sondergärten fort. Eine neue Haltung manifestierte der Landhausgarten von Walter und Klaus Leder: Er wurde nicht als klassische Umgebung für ein bestehendes Haus entworfen, vielmehr wurde umgekehrt ein entsprechendes Haus als Höhepunkt in den Garten gesetzt.
Das rechte Ufer
Im Vergleich zum linken wirkte das rechte Seeufer homogener, dessen Gesamtplanung Ernst Baumann und Willi Neukom leiteten. Sie konnten ein fast zusammenhängendes und ebenes Gelände bespielen und realisierten auch selbst zahlreiche Themengärten. Entlang der stadtauswärts führenden Seefeldstrasse wurden Ausstellungspavillons und Messehallen errichtet, während die dem See zugewandte Parklandschaft für Sondergärten und Vergnügungseinrichtungen vorgesehen war.
Die G|59 bot einen ersten Anlass, den See nicht mehr nur als fernes Bild, sondern als unmittelbare sinnliche Erlebnisqualität in die Parklandschaft einzubeziehen. Denn seit dem Bau des Wehrs in der Limmat 1951 erlaubte ein konstanterer Wasserspiegel eine Neudefinition der Wasserkante. Anlässlich der G|59 wurde eine Annäherung ans Wasser in unterschiedlicher Weise versucht. Während die Architekten den Zugang zum Wasser durch eine Ufertreppe mit Theater konstruierten, erprobten die Landschaftsarchitekten mit dem Staudengarten am See eine ganz andere und neuartige Lösung, die mit Geröll, einheimischen Stauden und Trittsteinen eine abstrakte Natürlichkeit schuf.
Für die Erschliessung des Geländes wurden zwei unterschiedliche Prinzipien der Wegführung kombiniert: Ein rechtwinkliges, rationales Wegnetz, das ein klares Ordnungssystem bildete, rasch zum Ziel führte und für den Unterhalt und die Versorgung gedacht war, wurde ergänzt durch einen Verbund von Spazierwegen, die dem Schlendern, Schauen und der Musse huldigten. Letztere waren weniger einem Ziel als vielmehr einem Tun verpflichtet und deshalb entsprechend abwechslungsreich gestaltet. Mal führten sie mit Trittsteinen über einen Rasen oder eine Wasserfläche, mal verliefen sie in Sand und Geröll. Ganz besonders die Wegführung um den «Nymphenteich» von Ernst Baumann und Willi Neukom eröffnete mit kreisrunden, über die Wasserfläche führenden Betontritten ein neuartiges Erlebnis.
Auch am rechten Ufer wurde mit Sondergärten ein breites Spektrum an gartengestalterischen Aufgaben demonstriert. Sie reichten von strenger Geometrie über spielerisch abstrakte Formen bis zu zweckmässigen und natürlich empfundenen Räumen. Der «Garten des Philosophen», der «Jardin d’Amour» von Ernst Baumann und Willi Neukom sowie der «Garten des Poeten» von Ernst Cramer (siehe Artikel Rotzler, Seite 22) waren Themengärten, die – wohl wegen ihrer abstrakten Gestaltung – unterschiedlichste Reaktionen auslösten. Die Kommentare reichten von «unverständlich», «banal» und «abschreckend » über «spielerisch und fröhlich» bis hin zu «künstlerisch hochstehend». Willi Neukom erläuterte diese «nicht orthodoxen Gartenideen»: «Ganz bewusst wurden Themen aus der Romantik gewählt, denen durch die Verwendung heutigen Baumaterials, Beton, Glas, Formsteine, eine gleichsam moderne Fassung gegeben wurde. Unter asketischer Vereinfachung der Form, die sich nur auf das Wesentliche beschränkt, ist ihnen direkte Aussage und unmittelbare Wirkung gewiss.» In ihrer Wirkung und in ihrem konstruktiven Formaufbau verweisen diese Gärten aber auch auf die Konkrete Kunst und die «Neue Grafik», die ebenso eine unmittelbare wie nachvollziehbare Ästhetik propagieren.
Gebrauchsfähiger und deshalb schneller akzeptiert waren der schon erwähnte Stauden- und der Badegarten und auch das Azaleental, die mehr der allgemeinen Vorstellung des Natürlichen entsprachen.
Gestalterische Innovationen drückten sich hauptsächlich in Sondergärten aus und wurden oft erst im Nachhinein entsprechend erkannt und gewürdigt. Mit diesen Themengärten offenbarte sich die Schweizerische Landschaftsarchitektur in ihrem Bestreben, eine moderne Formensprache zu finden und zu begründen. Obwohl eine Hinwendung zur klaren geometrischen Gliederung deutlich wurde, erwies sich die Suche nach einer zeitgemässen Ästhetik keineswegs als einfach. Der Redaktor Emil Steiner schrieb im Gartenbaublatt, im Vergleich zur «Züga» (Zürcher Gartenbau-Ausstellung 1933) sei die G|59 strenger und grundsätzlicher und stelle der organischen Form der Pflanze die Geometrie der Fläche, des Raumes und des Baus gegenüber.
Was ist geblieben?
Einerseits blieb die G|59 als «Blumenlandi» im Gedächtnis einer breiten Öffentlichkeit, und andererseits verhalf sie modernen Gartenideen zum Durchbruch. In vielerlei Hinsicht knüpfte sie an die Landesausstellung von 1939 an, war zukunftsgerichtete Fachmesse und Leistungsschau, aber auch Instrument der wirtschaftlichen Krisenbewältigung und Identitätsstiftung.5 Sie war die erste gemeinsame Selbstdarstellung von gewerblichen und gestalterischen Berufen auf nationaler Ebene. Gemeinsam versuchten Handelsgärtner und Landschaftsarchitekten, Pflanzenzüchter und Gartenplaner ein Plädoyer für einen zukunftskompatiblen und modernen landschaftsarchitektonischen Ausdruck zu formulieren. Die Anstrengung blieb allerdings zum grossen Teil stecken: zum einen in einem allgemeinen Loblied auf den Garten, zum anderen in unterschwelligen oder nicht ausformulierten Parallelläufen zu künstlerischen Strömungen der Zeit, insbesondere zur Ästhetik der konkreten Kunst. Die Vielfalt der vorgeführten Gestaltungsansätze erzeugte zwar das Gefühl eines Aufbruchs in eine moderne Zukunft, doch sie verwies auch auf das Fehlen einer klaren und verbindlichen Linie. Diese ambivalente Haltung ist nicht eine Besonderheit der G|59 sondern kennzeichnet grundsätzlich die Kunst und Kultur der 1950er Jahre.
Obwohl die G|59 in der Hauptsache als temporäre Ausstellung geplant war, konnten sich einzelne Gartengestaltungen, Bauten und Kunstwerke behaupten und für eine Nachnutzung geltend gemacht werden (siehe Artikel Rohrer, Seite 12 und Bucher/Wolf, Seite 26).anthos, Mi., 2009.06.03
03. Juni 2009 Annemarie Bucher
Festival Zürich
Die öffentlichen Räume unserer Städte, so auch die Parkanlagen rund um das untere Zürichseebecken, unterliegen mehr und mehr einer Festivalisierung, Kommerzialisierung und Privatisierung. Dauerhafte Werte sind gefährdet, die freie Nutzbarkeit durch die Bewohnerinnen und Bewohner wird – mindestens temporär – eingeschränkt.
Die ökonomischen und kulturellen Globalisierungsprozesse führen seit den 90er-Jahren zur Umstrukturierung unserer Innenstädte. Walter Siebel schrieb bereits 1992 über eine zunehmende «Festivalisierung der Stadtpolitik» und mit ihr jener des öffentlichen Raumes. Siebel verstand darunter eine Politik, die nur noch als Inszenierung von Bedeutungsvollem funktioniere. Ihr Instrument sei eine «Planung durch Projekte», durch punktuelle, inhaltlich, räumlich und zeitlich begrenzte Interventionen. Diese «Festivals» werden damit von der Politik für die Stadtentwicklung instrumentalisiert.
Diese Festivalisierung der Politik, also die Konzentration aller Ressourcen auf ein grosses Ereignis, sei jedoch weder neu noch nur ein Phänomen der Stadtpolitik, wie Siebel weiter festhält. Tatsächlich stellen Grossereignisse seit jeher kommunale Kristallisationspunkte dar, unter deren Deckmantel sich auch divergierende Interessen bündeln lassen. Sie werden als Preis betrachtet, den eine Kommune zahlt, um als Konstrukt sozialer Gemeinschaft zu funktionieren – als eine Stadt, die sich von anderen Städten unterscheidet, wenn auch nur kurzfristig. Die Festivalisierung der Politik erlaubt die Demonstration von Handlungskompetenz und die Mobilisierung von politischem Konsens in einer Situation, in der es immer schwerer wird, handlungsfähige Mehrheiten auf Dauer zusammenzubinden.
Diese Entwicklung wollte Siebel kritisch verstanden wissen. Zunehmend scheint es jedoch, als verstünden viele Städte, auch die Stadt Zürich mit ihrem bisherigen Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber, Siebels Worte als Imperativ: Festivalisiert eure öffentlichen Räume!
Festivalisierung, Kommerzialisierung, Privatisierung
Aus der in die Tat umgesetzten Aufforderung resultiert vielfach die Trias aus Festivalisierung, Kommerzialisierung und Privatisierung, die immer untrennbarer voneinander das Kapital eventbezogen an einen Ort lotsen. Im Zuge der Eventorganisation werden unsere öffentlichen Räume formatgerecht umgestaltet, im Sinne privatwirtschaftlicher Interessen geregelt, teil- und zeitweise der allgemeinen Nutzbarkeit entzogen. Dazu gehört, sie kontrollierbar zu machen. Denn nichts ist unerwünschter als negative Schlagzeilen. So installierte Zürich für die Ausrichtung der EURO 08 neun neue Kameras, sieben in der Fanmeile zwischen Limmat- und Utoquai, zwei am Bahnhof Stadelhofen – alle sind noch dort, teilweise in Betrieb, die übrigen bei Grossanlässen wieder aktivierbar. Zur Überwachung aus der Luft setzte die Stadt erstmals «Drohnen» als fliegende Kameras ein. Der intensive Ausbau der Raumüberwachung im Zusammenhang mit Grossereignissen ist vielerorts Usus. So wandelt der öffentliche Raum seinen Charakter.
Die Städte haben dafür zu sorgen, dass die Exklusivsponsoren zu ihrem Recht kommen, indem nur deren Werbung zu sehen ist und nur deren Getränke ausgeschenkt werden. Darüber hinaus bestimmen einige Sponsoren – noch räumlich begrenzt – die Kleiderordnung der Besucherinnen und Besucher. Schon heute verfügen die Veranstalter damit – noch zeitlich beschränkt – über ein Stück Stadt. Die Nutzungsrechte am öffentlichen Raum werden an den Meistbietenden verkauft, die Bewohner werden zu Statisten der Aufführung.
Von Event zu Event
Längst reicht es nicht mehr, nur gelegentlich eine Grossveranstaltung auszurichten. Um die mobile Eventgemeinde immer wieder anzulocken, stehen die Städte in einem harten Konkurrenzkampf. Das schafft weitere Probleme: Die Events verteilen sich zeitlich über das ganze Jahr, nicht aber räumlich. Sie finden dort statt, wo es der Sponsor wünscht – in den Topplagen. So drängten sich alleine 2008 zahlreiche Veranstaltungen rund um das Zürcher Seebecken: die Street Parade, die EURO 08, das Triathlon-Ereignis Ironman Switzerland, Scater Events, die Feierlichkeiten zum 1. August, der Frauentriathlon, der Gigathlon, die EuroPride, der Swiss Inline Cup, die Zürcher Radmeisterschaft, Freestyle.ch, das Theater Spektakel und das Massenbesäufnis Botéllon. Über 800 000 kamen 2008 zur Street Parade, an die Seepromenade kommen 40 000 Besucher an schönen Wochenenden.
Auch in den kommenden Jahren wird es nicht ruhiger um das Seebecken werden. Am 10. September 2008 tagten Fachleute an der 4. City Tourism Challenge zum Thema der Bedeutung von Events. «Wenn die Stadt mit der Konkurrenz mithalten wolle, müsse sie zulegen», sagte Tourismusdirektor Frank Bumann. Ausserdem müsse die Stadt eine klare Eventstrategie entwickeln und sich überlegen, welche Anlässe zu ihrer Persönlichkeitsstruktur passen. Dies klingt mehr nach ökonomischem Kalkül denn nach zukunftsfähiger Stadtentwicklung, die die Potenziale einer Stadt fördert, ohne sie um jeden Preis zu verkaufen. Auch Noch-Stadtpräsident Ledergerber sagte, «wir müssen das Label Zürich besser bewirtschaften», Zürich müsse eine führende Eventstadt Europas sein.
Der Stadtrat hat einen Kriterienkatalog aufgestellt, anhand dessen er entscheidet, welche Events gefördert werden sollen. Kriterien sind etwa internationale Bedeutung, Besucherzahl oder Medieninteresse. Für die von der Stadt bevorzugten Veranstaltungen sollen Defizitgarantien übernommen werden. Eine geeignete und langfristig stadtverträgliche Strategie, um dem Ausverkauf der Stadt Grenzen zu setzen, scheint jedoch zu fehlen. Rund um das Zürichseebecken ist die Belastungsgrenze längst erreicht. Grün Stadt Zürich verzeichnet einen immer grösser werdenden Aufwand für das Grünflächenmanagement am See (siehe Artikel Bosshard/Sigel, Seite 50).
Urbaner öffentlicher Raum als Kulisse
Im internationalen Wettbewerb um kaufkräftige Kundschaft und Touristen werden die urbanen Räume zu Visitenkarten umgestaltet, zu Werbeflächen für Veranstaltungen und Sponsoren. Der urbane Raum ist weniger Ort der Begegnung, sozialer Aktivitäten, des Verweilens und des Austauschs heterogener Gruppen denn Kulisse zur Inszenierung von Ereignissen. Die Stadt präsentiert sich primär als Bild, worin wiederum solche Aktionen passen, die selber reproduzierbare Bilder erzeugen, wie zum Beispiel der Teddy-Sommer 2005 in Zürich. Dieser hatte seinen direkten Vorgänger in Berlin, wo es ebenfalls aufgestellte Teddybären waren. In Hamburg war es der Wasserträger Hans Hummel, in Kaiserslautern waren es Fische, in Mannheim Pferde, und Zürich blickt bereits auf eine Herde von 850 Kühen 1998 und 1000 Sitzbänke 2001 zurück. Im Sommer 2009, dem Sommer der «Gartencity» in Zürich, sollen Pflanzen in grossen, bunten Töpfen die Innenstadt zieren.
Laufend wechselnde, durch Sponsoren gesteuerte, Ansprüche stehen damit dauerhaften kulturellen Werten gegenüber, wie sie die für die Stadtbevölkerung frei zugänglichen und vielseitig nutzbaren Parkanlagen rund um das untere Zürichseebecken in hervorragender Weise darstellen.
Man mag diese Entwicklung bedauern oder als Fortschritt sehen. Tatsache bleibt, dass man ihr Grenzen setzen, sie klaren, langfristig ausgerichteten Regeln unterwerfen muss. Es ist gefährlich, den öffentlichen Raum, den Ort unserer urbanen Identitätsbildung, zum austauschbaren Stereotyp werden zu lassen. Wenn er nichts mehr über eine Stadt und deren Besonderheiten aussagt, werden dann nicht auch die Bewohnerinnen und Bewohner zur austauschbaren Masse, die keine Verantwortung mehr für ihre Stadt übernimmt? Das Grundproblem der imperativen Deutung der Festivalisierung ist, dass sie zerstört, was sie zu inszenieren versucht. Was eine Stadt liebenswert macht, sind neben ihrer Lage und Aufenthaltsqualität, die wesentlich durch einen anspruchsvoll gestalteten öffentlichen Raum bestimmt wird, auch ihre versteckten Schätze. Und die entstehen durch Geschichte, Leben und Benutzung, nicht durch Inszenierung.anthos, Mi., 2009.06.03
03. Juni 2009 Sabine Wolf, Bernd Schubert