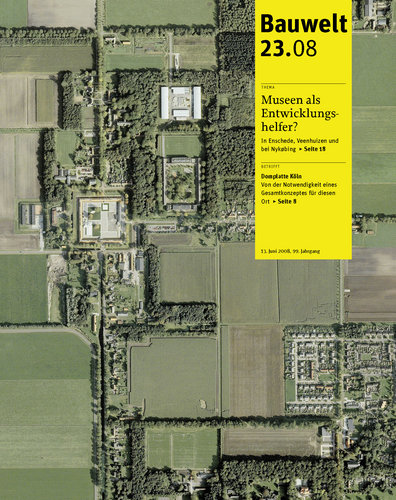Inhalt
„Das Eröffnungsdatum kennen die Architekten nur aus dem Eintrag zu dem Bahnhof im Internetlexikon Wikipedia. Dass ihr Wettbewerbsentwurf überhaupt realisiert wurde, haben sie eher zufällig entdeckt: auf einem Luftbild bei Google Earth.“
WOCHENSCHAU
02 Beiyuanlu North. Wie sich eine Pekinger U-Bahnstation irgendwie von selber baute | Jan Friedrich
03 DMY – Designfestival in Berlin | Nicole Heptner
04 Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen | Jan Friedrich
05 Digitale Raumkunst. Ausstellung in Duisburg | Gudrun Escher
BETRIFFT
08 Domplatte Köln | Uta Winterhager
WETTBEWERBE
14 Städtebauliche Reparatur der Gesamtanlage der Meisterhäuser in Dessau | Günter Kowa
16 Auslobungen
THEMA
18 Textilfabrik wird Museum | Kaye Geipel
26 Strafkolonie, Gefängnis, Museum | Hubertus Adam
32 Referenz an die dänische Landschaft | Hubertus Adam
REZENSIONEN
39 Ausstellungsbriefe | Eva Maria Froschauer
39 Weltausstellungen | Thomas Werner
40 Wörterbuch Design | Dagmar Steffen
40 Design im Alltag | Dagmar Steffen
40 Manuskripte | Dagmar Steffen
RUBRIKEN
06 wer wo was wann
06 Leserbriefe
38 Kalender
41 Anzeigen
48 Die letzte Seite