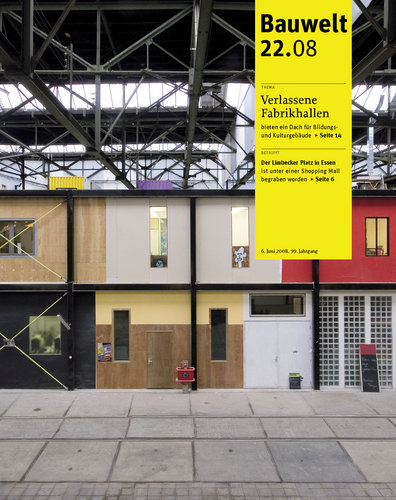Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Vom Werden einer neuen Stadt. Wolfsburg wird siebzig | Bettina Maria Brosowsky
03 Neue Cafeteria der TU Berlin | Brigitte Schultz
03 Franziska Stünkels „Vineta“ | Olaf Bartels
04 Was Canaletto sah, was wir heute sehen | Tanja Scheffler
BETRIFFT
06 Limbecker Platz, Essen | Ludger Fischer
WETTBEWERBE
10 Interview mit Peter Kulka zum Zuschauersaal der Staatsoper Berlin | Friederike Meyer
12 Umbau und Sanierung Hans-Sachs-Haus. Gelsenkirchen | Grudrun Escher
12 Entscheidungen
13 Auslobungen
THEMA
14 Hörsaalgebäude der TFH Wildau | Friederike Meyer
22 Mensa und Medienzentrum der TFH Wildau | Wolfgang Kil
28 Die Grande Halle von Arles | Florence Accors
32 NDSM-Atelierstad Amsterdam | Ulrich Brinkmann
RUBRIKEN
05 wer wo was wann
05 Leserbriefe
36 Kalender
39 Anzeigen
44 Die letzte Seite