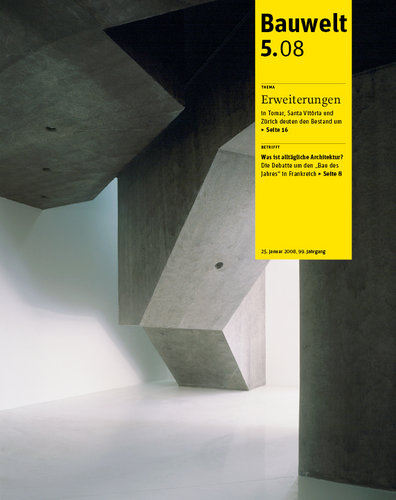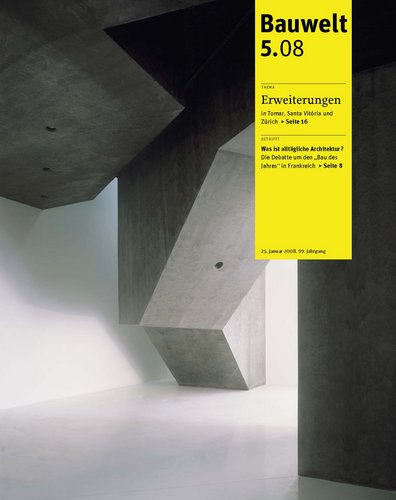Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Die neue Hungerburgbahn in Innsbruck | Eva Maria Froschauer
04 Harald Deilmann 1920–2008 | Herbert Pfeiffer
04 Das Amsterdam von A.A. Kok | Hubertus Adam
05 Heinrich-Zille-Ausstellung in Berlin | Nils Ballhausen
06 Die 60er Jahre in Hannover | Dietmar Brandenburger
BETRIFFT
08 Was ist alltägliche Architektur? | Sebastian Redecke
WETTBEWERBE
10 Justizvollzugsanstalt Heidering | Oliver Elser
12 World Park auf Governors Island | Friederike Meyer
14 Auslobungen
THEMA
16 Kulturzentrum in Tomar | Doris Kleilein
22 Wohnhaus in Santa Vitória | Gerrit Confurius
26 Schulanlage Hirzenbach in Zürich | Axel Simon
REZENSIONEN
33 Oswald Mathias Ungers. Eine intellektuelle Biographie | Peter Rumpf
33 Carlo Scarpa – Layers | Sandra Hofmeister
34 An Architecture of Invitation. Colin St John Wilson | Michael Kasiske
34 Lewis. Tsurumaki. Lewis. | Frank F. Drewes
RUBRIKEN
06 wer wo was wann
32 Kalender
35 Anzeigen
40 Die letzte Seite