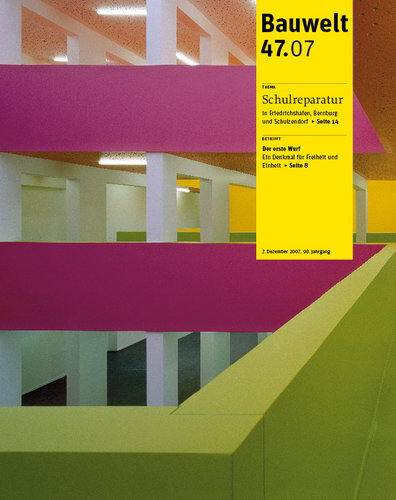Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Werkbundausstellung Paris 1930 | Michael Kasiske
03 Architekturbiennale São Paulo | Dagmar Hoetzel
04 Graber-Pulver-Ausstellung in Zürich | Hubertus Adam
05 Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses | Sebastian Redecke
06 Studie zur Weiterentwicklung der „European Kunsthalle“ | Christian Holl
BETRIFFT
08 Der erste Wurf | Sebastian Redecke
WETTBEWERBE
10 Erweiterung der Asplund-Bibliothek in Stockholm | Jan Schrenk
12 Entscheidungen
13 Auslobungen
THEMA
14 Schreienesch-Schule Friedrichshafen | Nils Ballhausen
22 Martinszentrum Bernburg | Günter Kowa
28 Grundschule Schulzendorf | Ilka und Andreas Ruby
REZENSIONEN
35 Max Ziegler. Bauten und Projekte 1946–1982 | Axel Simon
35 Hildebrand Machleidt. Planungen für die Stadt | Robert Frank
RUBRIKEN
06 wer wo was wann
34 Kalender
36 Anzeigen
44 Die letzte Seite: Lommel ist Spitze