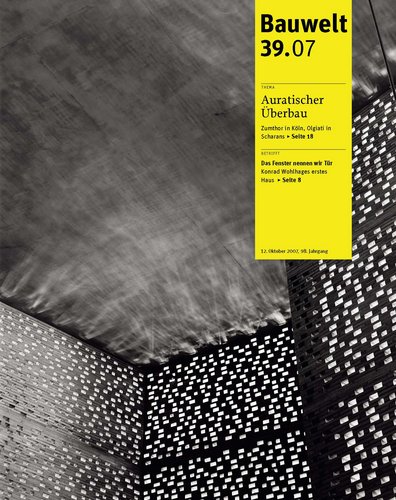Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Japan und der Westen | Bettina Maria Brosowsky
03 Gründungskonvent der Bundesstiftung Baukultur | Jan Friedrich
04 Innenarchitektur aus Indien | Utel Ziegler
04 Berliner Brücken | Frank Peter Jäger
06 Buchpräsentation Al Manakh im NAi | Mathijs Cremers
06 Sanierung des Neuen Palais in Potsdam
BETRIFFT
08 Das Fenster nennen wir Tür, und die Küche heißt Schrank | Konrad Wohlhage
WETTBEWERBE
12 Büro- und Geschäftshaus am Karlsruher Marktplatz | Ulrich Maximilian Schumann
14 Auslobungen
THEMA
18 Eine Kirche für die Kunst | Doris Kleilein
28 Das rote Haus | Axel Simon
32 47 Tonnen Ton | Carolin Mees
REZENSIONEN
40 Der Architekt, der Koch und der gute Geschmack | Alexander Kluy
41 Structure and space | Alfred Meistermann
41 Entwicklung im Ingenieurholzbau | Alfred Meistermann
41 Unschuld des Betons | Alfred Meistermann
42 Berlin/DDR, neo-historisch | Wolfgang Kil
42 Al Manakh. Dubai Guide| Kaye Geipel
RUBRIKEN
07 wer wo was wann
07 Leserbriefe
38 Kalender
43 Anzeigen
48 Die letzte Seite: Der größte Baustein der Welt