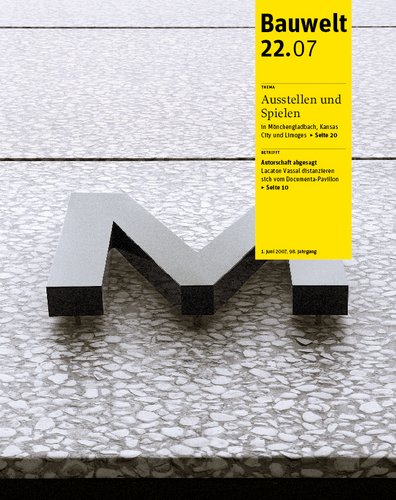Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Die Stadt von morgen. Ausstellung zu 50 Jahren Berliner Hansaviertel | Christoph Tempel
03 Christian de Portzamparc in der Cité de l’Architecture et du Patrimoine | Boris Maninger
04 „Max Laeugers Arkadien“ im Museum Langmatt in Baden | Hubertus Adam
04 Fotografien von Ulrike Ludwig in der Galerie Loris in Berlin | Michael Kasiske
BETRIFFT
10 Festwiese Documenta | Anne Lacaton, Jean-Philipp Vassal
WETTBEWERBE
14 Interview mit Bernard Tschumi über den Wettbewerb für die neue Pariser Philharmonie | Anne Kockelkorn
18 Auslobungen
THEMA
20 Museum X | Nils Ballhausen
26 Nelson-Atkins Museum of Art | Paul Goldberger
36 Zénith Limoges | Anne Kockelkorn
REZENSIONEN
41 Architekturmodelle. Anregungen zu ihrem Bau | Uli Meyer
42 Ausstellungsgestaltung. Konzepte und Techniken | Tobias Neumann, Moritz Schneider
RUBRIKEN
05 wer wo was wann
05 Architekturtheorie
40 Kalender
43 Anzeigen