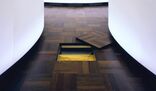Mit der Pinakothek der Moderne ist diese Woche einer der grössten Museumsbauten Europas eröffnet worden. Nebst Design, Architektur und Grafik zeigt das Haus vor allem Kunst aus allen Epochen des zwanzigsten Jahrhunderts.
Mit der Pinakothek der Moderne ist diese Woche einer der grössten Museumsbauten Europas eröffnet worden. Nebst Design, Architektur und Grafik zeigt das Haus vor allem Kunst aus allen Epochen des zwanzigsten Jahrhunderts.
Das Projekt der Moderne ist längst abgeschlossen, und niemand erwartet heute noch ernsthaft von der Kunst, dass sie Visionen einer besseren Zukunft verbreite, dem noch Unsagbaren einer kommenden Zeit mit ersten Formulierungen entgegeneile oder gar die Zeitgenossen grundlegend verändere. Das Fortschritts- oder besser Forschungsprojekt des Menschenmöglichen, das die Moderne war, hat im zwanzigsten Jahrhundert seinen Aufstieg und - mit all den blutigen Kriegen - auch seinen Fall erlebt. Dieses zwanzigste Jahrhundert ist zu Ende gegangen - und dieser arbiträre Schlusspunkt einer Epoche hat in unseren Köpfen mit seiner Symbolkraft wohl mehr bewirkt, als wir voraussehen konnten. Plötzlich scheint es, als seien wir nun wirklich aus einer Zeit herausgetreten, in der sich zumindest in der Kunst noch alles mit dem heroischen Zeitalter der klassischen Moderne zu messen hatte.
Startrampe klassische Moderne
Daher rührt wohl auch das leichte Befremden ob der in dieser Woche mit Staatsakten und Publikumsfesten grossartig gefeierten Eröffnung einer Pinakothek der Moderne in München. Nun ist eine Pinakothek ja ein Museum - und solche Häuser haben traditionell die Aufgabe, Dinge vor dem Verschwinden und Vergessen zu bewahren. Die neue Pinakothek stellt sich jedoch nicht als ein Haus dar, das vorrangig Vergangenheit konserviert, sondern versteht sich als eine Institution mit Ausrichtung in die Zukunft. Die klassische Moderne, die hier zur Hauptsache gezeigt wird, erscheint somit nach wie vor als die Startrampe für alles, was mit Zukunft zu tun hat. Um dies plausibel zu machen, wurde mit Bernhart Schwenk gar ein Konservator für die Kunst der Gegenwart engagiert (NZZ 16. 9. 02), der nun in einem Raum mit Positionen der Jetztzeit den ständigen Beweis der anhaltenden Aktualität des Vergangenen erbringen muss.
Dass diese Pinakothek sich heute als Zukunftshaus darstellt, obwohl sie zur Hauptsache Vergangenheit sichtbar macht, hat allerdings auch mit ihrer Geschichte zu tun. Eigentlich hätte das Haus nämlich bereits vor rund hundert Jahren gebaut werden sollen - als eine Art Katapult, das die Avantgarde von damals noch schneller in die Zukunft vorausschleudern sollte. Dann aber kam der Erste Weltkrieg dazwischen, es kamen die mageren Jahre danach und schliesslich die Nazis. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Sammlung auf ein paar wenige Bilder geschrumpft - ironischerweise fand sie ausgerechnet im Haus der Kunst, diesem Tempel aus der Hitlerzeit, wieder zu einer stattlichen Form. Hier bekam die Staatsgalerie moderner Kunst 1980 auch ihren provisorischen Ort. Das Ringen um einen Neubau für die Schätze der Moderne dauerte mehrere Jahrzehnte, und die verschiedensten Standorte wurden ins Auge gefasst. Als dann die Technische Universität ihre Lokalitäten auf dem Areal der Türkenkaserne verliess, war der ideale Ort in unmittelbarer Nachbarschaft zur Alten und zur Neuen Pinakothek gefunden. 165 Architekten bewarben sich 1991 um den Bauauftrag, der schliesslich an den Münchner Stephan Braunfels vergeben wurde. Es vergingen weitere fünf Jahre bis zum Baubeginn. Und auch der Bauverlauf war begleitet von Rechtsstreitigkeiten, politischem Geplänkel, Mehrkosten und anderen Hindernissen.
Landung am Ort der Türkenkaserne
Nun aber steht sie da, die Pinakothek der Moderne. Die Alte und die Neue Pinakothek sind keinen Steinwurf entfernt, und auch die Glyptothek, die Antikensammlung und das Lenbachhaus mitsamt seinem Kunstbau liegen in unmittelbarer Nähe. München verfügt somit über ein Museumsareal, das Kunst von der Antike bis heute in manch edler Hülle und schier unermesslicher Fülle bereithält. Die Pinakothek der Moderne präsentiert sich zunächst als weisser Kubus, der bei Sonneneinstrahlung leuchtet wie ein Kykladendorf. Zwei auf einer Diagonale zum Zentrum hin angelegte Eingänge führen den Besucher unter ein gigantisches Kuppelgewölbe - 25 Meter hoch, 30 Meter weit. Von allen Seiten und von oben dringt Licht in diese Halle. Hier sind wir im Zentrum des ganzen Baus, daran kann kein Zweifel bestehen. Von der Kunst gibt es an dieser Stelle noch nicht viel zu sehen, hier ist die Architektur ganz bei sich selbst. Hat sich das Auge erst einmal an diesem Pantheon gesättigt, findet es weitere Nahrung in der Form von zwei monumentalen, keilförmig zugeschnittenen Treppen. Die eine führt hinab in das lichte Untergeschoss, die andere hinauf - und da, auf den letzten Stufen, entdecken wir denn auch die erste Kunst: Ein «Oxydation Painting» von Andy Warhol und eine riesige Skulptur von Olaf Metzel - leuchtend farbige Plasticbahnen, die von der Decke herabzuhängen scheinen. Ein gewaltiger Kunst-Auftakt - zu rücksichtslos für den Architekten Stephan Braunfels, der Metzels Arbeit gegenüber dem «Spiegel» als «Faschingsgirlande» bezeichnet hat.
Die Pinakothek der Moderne versteht sich als ein Haus, das vier Museen unter einem Dach vereint: Das Architekturmuseum der Technischen Universität liegt im Erdgeschoss, daneben befinden sich die Galerien der Staatlichen Graphischen Sammlung. Die «Neue Sammlung» zeigt in einer quirligen Schau im Untergeschoss einen Teil der rund 60 000 Designobjekte, die sie ihr eigen nennt. Den grössten Raum aber nehmen die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ein, die das ganze Obergeschoss besetzen.
Sosehr sich die Architektur in der zentralen Rotunde ganz in den Vordergrund drängt, so sehr nimmt sie sich in diesen Sammlungsräumen zurück. Die Oberlichter sind unauffällig, die Einteilung des Raumes ist nüchtern, der Boden macht sich mit einem leichten Grau diskret - in diesen klassischen «White Cubes» kann die Geschichte der Moderne störungsfrei erzählt werden. Diese Geschichte hat in München allerdings einige Lücken. Dass ausgerechnet eine Münchner Pinakothek der Moderne die frühe Entwicklung der abstrakten Kunst heute nicht nachzeichnen kann, ist wohl auf die Geschehnisse während der Nazi- Zeit zurückzuführen. Dass aber auch die Nachkriegs-Abstraktion, die russischen wie auch die amerikanischen Beiträge zur Kunst des letzten Jahrhunderts fast völlig fehlen, muss auf spätere Versäumnisse in der Sammlungspolitik zurückgeführt werden.
Generaldirektor Reinhold Baumstark und sein Konservatorenteam haben jedoch nicht versucht, diese Lücken zu verbergen - sie zeigen, was sie haben. Der Rundgang beginnt mit dem erwähnten Gegenwartsraum, wo sich die Berliner John Bock und Michel Majerus breit gemacht haben. Dann springen wir, quasi von Stein zu Stein, durch die vergangenen Jahrzehnte: Donald Judd, Sigmar Polke, Joseph Beuys, Georg Baselitz, Jeff Wall und ein halbes Dutzend weiterer Stars der Nachkriegskunst werden hier meist in Einzelräumen vorgestellt - repräsentativ ist das nicht, doch erlaubt es eine gewisse Konzentration. Im Bereich der klassischen Moderne sind die Maler der Brücke mit einer Reihe prominenter Werke vertreten. Der Auftritt des Blauen Reiters indes wirkt im Vergleich zur Präsentation im nahen Lenbachhaus eher disparat. Exklusiv wirkt der Saal mit Werken von Max Beckmann: Grossartige Bilder wie die «Versuchung» von 1936/37 oder die «Frau mit Mandoline in Gelb» sind hier geschickt mit zwei seiner weniger prominenten Plastiken kombiniert. Auch der Picasso-Saal ist elegant, und ein Kabinett mit kleinformatigen Bildern von Max Ernst bietet einen delikaten Auftakt zum Thema Surrealismus, das mit Dalí, Magritte und Giorgio de Chirico weitergeführt wird.
In der Pinakothek der Moderne hüpfen wir also, wenn auch nur auf einem Bein, von der Jetztzeit durch die Kunstgeschichte bis zu den Anfängen der Moderne zurück. Mit dieser Inszenierung wird eine kontingente Geschichte angedeutet, die durch die Zeiten hindurch alles mit allem auf geheimnisvolle Weise verknüpft. Die ewige Wiedergeburt des Kindes im Manne, die John Bock seit einigen Jahren erfolgreich inszeniert, und die «Grosse Sterbeszene», die Max Beckmann 1906 gemalt hat - beides ist Kunst. Doch zu welchen Gedanken sollen wir angeregt werden, wenn Bock und Beckmann in denselben Bezugsrahmen einer Pinakothek der Moderne gestellt sind? Krampfhafte Aktualisierung des Vergangenen auf der einen, Historisierung der Gegenwart auf der anderen Seite - beides dient letztlich auch der Suggestion geheimer Kunst- Wirkkräfte, stützt die Macht der Theorie und verstellt den Blick auf das, was es zu sehen gibt.
[Handbuch zur Pinakothek der Moderne, Euro 16.80. Kurzführer Malerei, Skulptur. Neue Medien, Euro 24.80.]