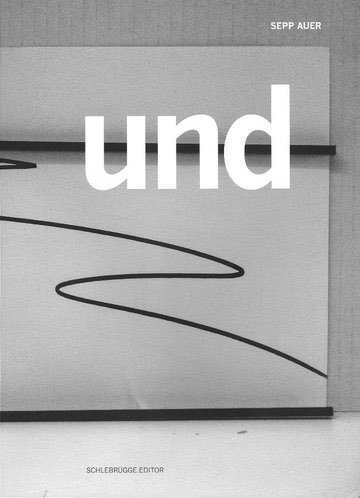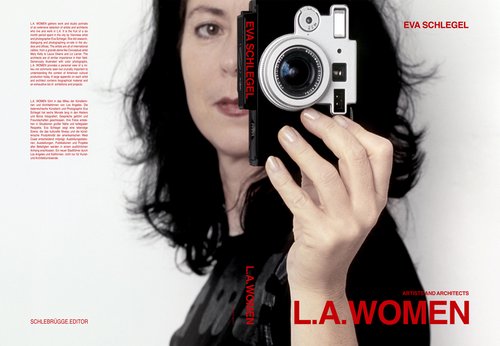Raimund Abraham 1933-2010
Architekt Raimund Abraham, ein Befürworter des Einfachen und Sinnfälligen in der Baukunst, wirkte als Künstler, Anreger und Lehrer. Er ist 76-jährig einem Verkehrsunfall in Los Angeles zum Opfer gefallen.
Architekt Raimund Abraham, ein Befürworter des Einfachen und Sinnfälligen in der Baukunst, wirkte als Künstler, Anreger und Lehrer. Er ist 76-jährig einem Verkehrsunfall in Los Angeles zum Opfer gefallen.
Vergangenen Mittwochabend hielt Raimund Abraham am Southern California Institute of Architecture seinen letzten Vortrag: Die Verklärung der Stars unter den Architekten war einer der zentralen Punkte, die Abraham, der die Komplexität des Einfachen bedingungslos gegenüber dem Spektakulären, dem technisch gerade noch Machbaren verteidigte, dabei ein letztes Mal scharf kritisiert hat.
Ein letztes Abendessen mit Freunden und Wegbegleitern wie Eric Owen Moss und Peter Noever später war Abraham tot, mit einem Bus in Downtown L.A. kollidiert, noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen erlegen. Raimund Abraham hat - prototypisch für sein Leben - nicht die vorgeschriebene Fahrtrichtung eingeschlagen.
Der 1933 in Lienz in Osttirol geborene Architekt war nicht im Ruhestand, hat nicht daran gedacht, das eigene Haus, an dem er seit Jahren in Mexiko baute, als Alterssitz zu nutzen.
Er hat dort umgesetzt, was seine Sache, seine Haltung war: kompromissloses Bauen, elementare Architektur, schlichte Häuser mit einer sinnstiftenden Verschränkung von internen und externen Blicken, Häuser, die skulptural erscheinen mögen, im Kern aber der Funktion verpflichtet sind - Orte, die Intimität und Öffentlichkeit versöhnen.
Verbindliche Botschaft
„Ich werde“, sagt Dietmar Steiner, Direktor des Architekturzentrums Wien, „die Botschaft von Raimund Abraham niemals vergessen: ,Jeder Bau verletzt die Erde. Jeder Architekt hat deshalb die Verantwortung, dass diese aufgeladene Schuld der Verletzung der gegebenen Erde nur durch eine kulturelle und künstlerische Verbesserung versöhnt werden kann.'“
In Mexiko und in New York, der Stadt, in der er seit 1971 lebte, hat er weitergeplant, gezeichnet, gedacht, seine Vorlesungen (an der Cooper Union und am Pratt Institute in New York) ausgearbeitet. In Vorbereitung war etwa ein Musikerhaus auf dem ehemaligen Militärgelände bei Neuss in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Projekts „Museumsinsel Hombroich“.
Als Raimund Abrahams Hauptwerk gilt das Austrian Cultural Forum in New York, das, so Dietmar Steiner, „nur unter schwierigsten Rahmenbedingungen verwirklicht werden konnte, aber heute als Manifest und Landmark zeitgenössischer Architektur in die globale Architekturgeschichte eingeschrieben ist“. Das Magazin Wallpaper hat Abrahams Bau, der auf nur sieben Metern Breite und - für New York - mickrigen 24 Etagen den großen Bürotürmen locker Paroli bietet, unter die fünf wichtigsten Gebäude New Yorks gereiht.
Protest gegen FP-Beteiligung
Zwei Jahre vor der Eröffnung des Hauses legte Abraham aus Protest gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ seinen österreichischen Pass nieder. 2002 wurde er amerikanischer Staatsbürger. Österreichs aktuelle Kulturministerin Claudia Schmied würdigte Abraham in einer ersten Reaktion kenntnisreich: „Diese Qualität betraf nicht nur sein architektonisches Werk, sondern auch sein öffentliches Wirken. Er ging keine Kompromisse ein, da er bedingungslos an seinen Prinzipien festhielt.“ Und diese Prinzipien vor allem auch weitergab.
Elementarteile
Abraham, der wenig gebaut hat - einige Wohn- und Geschäftshäuser in den USA, die Hypo-Bank-Filiale in seiner Heimatstadt Lienz - war ein ungemein bedeutender und einflussreicher Lehrer; hierzulande leider nur im Rahmen von Gastvorträgen bei Kollegen.
"Raimund Abraham hat der Architektur unserer Zeit von seinen ersten Recherchen der bäuerlichen „elementaren Architektur“ des Alpenraums bis zu seinen großartigen literarisch-poetischen Zeichnungen und den wenigen ihm vergönnten Bauten (Anm: bei den internationalen Wettbewerben zum Centre Pompidou und der Bastille-Oper in Paris wurde er jeweils auf den zweiten Rang gereiht) eine neue Begründung ermöglicht", sagt Dietmar Steiner stellvertretend für viele, denen Abraham weit mehr war, denn der „Schwierige“ mit dem Kulturinstitut.
Der Standard, Sa., 2010.03.06
verknüpfte Akteure
Abraham Raimund