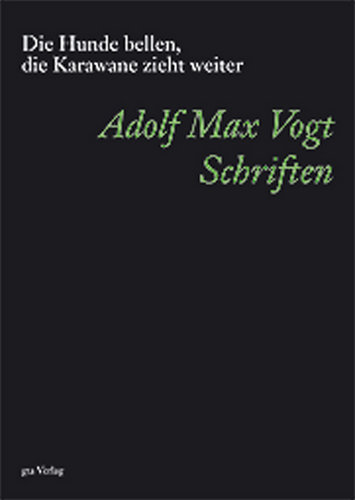Hauptstädte vom Reissbrett
Würfe jemand die Frage auf, ob Architektur und Städtebau denn nicht doch befugt und in der Lage seien, den «Staat darzustellen» - dann würde ich eher entgeistert...
Würfe jemand die Frage auf, ob Architektur und Städtebau denn nicht doch befugt und in der Lage seien, den «Staat darzustellen» - dann würde ich eher entgeistert...
Würfe jemand die Frage auf, ob Architektur und Städtebau denn nicht doch befugt und in der Lage seien, den «Staat darzustellen» - dann würde ich eher entgeistert ausrufen: Vorsicht, von dem haben wir im 20. Jahrhundert mehr als genug gehabt! Erinnert sei nur an Paul Ludwig Troost und Albert Speer, die beiden Gestaltungsknechte Hitlers, und an Marcello Piacentini, den Chefbaumeister Mussolinis.
Jedermann weiss, dass das 19. Jahrhundert die Reihe der Baustile seit der griechischen und römischen Antike historisch aufgearbeitet hat und selber - als Neoromantik, Neogotik und so weiter und so fort - wieder zur Anwendung brachte. Was aber hat das 20. Jahrhundert mit diesem Erbe angefangen? Es hat zugelassen, dass ausgerechnet eine der edelsten Stilformen - der Klassizismus - an die Diktatoren verschachert oder doch preisgegeben wurde, um der damaligen Politik eine zudienend legitimierende Architektur beizugesellen. Architektur: eine wortferne Gattung, hilflos dem Missbrauch durch die Wortwelt ausgesetzt?
Aus einem Guss
Wenn nun ein Titel auftaucht, in welchem über stattliche 300 Seiten hin genau diese Frage, eben: «Representing the State», diskutiert wird, dann wandelt sich besagte Entgeisterung immerhin in Verwunderung. Der Autor des Buches, Wolfgang Sonne, der an der ETH Zürich am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur dissertiert hat und heute in Schottland wirkt, präsentiert eine stolze Reihe von neu gegründeten Hauptstädten, welche - so die These - allesamt als Bedeutungsträger der Staatsrepräsentation verstanden worden sind. Er beschreibt Washington D. C. 1902, dann Grossberlin 1910, Canberra 1912 und schliesslich Delhi 1913.
Alle diese «Kapitalen aus einem Wurf» zeichnen sich entweder durch eine dominante Achse mit grüner Mall und Wasserbecken oder durch zwei Achsen im Kreuz samt Diagonalen aus. Weiter kann die eine Grundachse in Kreisformen und Radialsegmente entfaltet werden, was Eliel Saarinen in seinem Entwurf für Canberra 1912 gelungen ist, der doch wohl das erfreulichste Konzept des ganzen Bandes darstellt.
Die von Sonne beobachtete und beschriebene Reihe von neu gegründeten Hauptstädten wird durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 unterbrochen. Kaum jemand konnte damals ahnen, dass nach bloss 20 Jahren Unterbruch (1918-1939) ein zweiter Weltkrieg von ebenso grauenvoller Dimension folgen würde. Kein Wunder, dass diese düsterste Phase des 20. Jahrhunderts heute auch als «zweiter Dreissigjähriger Krieg - 1914-1945» bezeichnet wird. - Die verbitterte, verhärmte und verarmte Szene liess keine weiteren Realisierungen von geplanten Neustädten zu - und der Gedanke, eine solche Gründung gar mit der Dedikation «to represent the state» zu versehen, wäre als Zumutung oder schlechter Witz oder simple Geschmacklosigkeit zurückgewiesen worden. Für Städteplaner blieb nur eines: der Schritt auf die platonische Ebene der Idealstadt. Doch auch diese gehobene Bezeichnung «Idealstadt» wollte einer desillusionierten Generation nicht mehr über die Lippen, folglich wird die Umschreibung «World Center of Communication» vorgezogen.
Sonne referiert auch über diese abgehobene, platonische Stufe mit der ihm eigenen Sachkenntnis und Kompetenz: Unter dem Titel «Peace Conferences, Peace Palace and World Capital of Peace» verweist er auf die letzten verzweifelten Bemühungen unmittelbar vor Kriegsausbruch 1914. Mit Recht stellt er dabei das International World Center von Andersen und Hébrard in den Vordergrund, das auf zwei Sockeln im Meer - in der Grössenordnung der Freiheitsstatue vor Manhattan - eine Eva und Adam mit Fackeln in der erhobenen Hand zeigt. Eine innerlich geladene Epoche steigert hier die Harmonisierung der Geschlechter bis zu einem unglaubhaften Grade.
Hendrick Christian Andersen, der damals in Rom wohnte, kämpfte aktiv um eine Verwirklichung des mit Ernest Hébrard entworfenen «World Center». Er versuchte Zugang zu finden bei Benito Mussolini, dem Duce. Man versprach ihm Unterstützung, eine faschistische Zeitung pries das Projekt als «eine Stadt wie keine andere, Seele, Herz und Hirn der Welt». Da Andersen, selber in pazifistischen Kreisen aufgewachsen, nun so weit ging, auch Mussolinis Eroberung Äthiopiens zu applaudieren, wurde ihm als Gegenleistung von Mussolini die Verwirklichung seines «World Center» in der faschistischen Weltausstellung E 42 bei Ostia versprochen. - Dies als Beispiel dafür, wie Architekten, die sich zu effektivem, nicht nur idealistischem Städtebau berufen fühlen, die gewünschte Repräsentation plötzlich mit dem Verrat ihrer eigenen Überzeugung bezahlen müssen.
Wie gesagt kann Sonne von 1914 an keine Planungen von Hauptstädten aus einem Guss mehr vorlegen. Die im VI. Kapitel beschriebenen «Friedensstädte» führen ihn schliesslich nach Genf, das zum Sitz des Völkerbunds erhoben wird. 1920 findet dort die erste Sitzung (noch im Hotel National) und 1926/27 der Architekturwettbewerb um den Völkerbundspalast statt.
Drang zum Ausdruck
Gerade an dieser Stelle fügt Sonne einen Abschnitt ein, den ich als «seine» Definition von Architektur übersetzen und zitieren möchte: «Transparenz und Ehrlichkeit in der Konstruktion sind damals gleichzeitig von politisch völlig entgegengesetzten Positionen her gefordert worden - den säbelrasselnden Faschisten einerseits, den Friedenspolitikern des Völkerbunds anderseits. Dies beleuchtet nicht nur die politische Ausdrucksfähigkeit von Architektur. Es beleuchtet auch die Tatsache, dass Architektur unfähig ist, eine politische Botschaft eindeutig zu übermitteln. Doch sie, die Architektur, ist andererseits auch nicht fähig, diesen Drang zum Ausdruck aufzugeben.» Kurz: repräsentieren müssen, aber ohne klare Artikulation zu erlangen.
Alles in allem: Wolfgang Sonne präsentiert einen überreichen Strom von Material, der ihn bisweilen zu überschwemmen droht. Stets ist er sachbeflissen, doch seine Beschreibung läuft horizontal, kennt kaum Steigerungen, Spannungen oder erquickende Pausen. «Weniger wäre mehr gewesen», denkt man mitunter. Sicherlich hätte die Beschränkung auf die Zeitspanne 1902-1913 (statt bis 1927) mehr Verdichtung und farbigere Profilierung ermöglicht. So sind es nun anderthalb Bücher geworden statt eins. Doch wer die Neugier hat, der wird dennoch grosszügig entschädigt.
Neue Zürcher Zeitung, Di., 2005.03.08
verknüpfte Publikationen
Representing the State