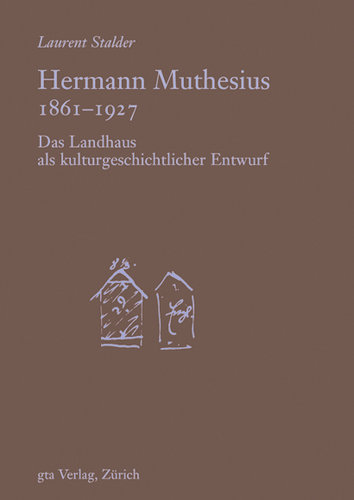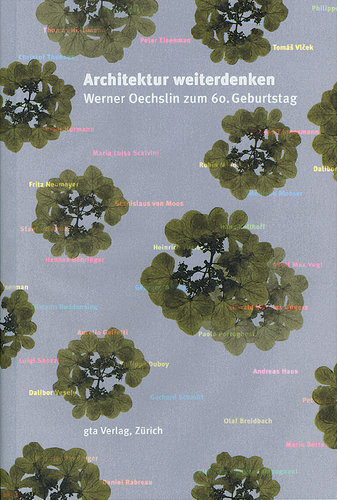Die 1970er Jahre werden in der Schweizer Architektur gerne als Beginn einer neuen Entwicklung gesehen. Diese hat in der Gegenwart ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden.
Die 1970er Jahre werden in der Schweizer Architektur gerne als Beginn einer neuen Entwicklung gesehen. Diese hat in der Gegenwart ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden.
Mit einem Bau oder einem Ereignis den Anfang einer architektonischen Entwicklung einzuläuten, ist – bis zu einem gewissen Grade – immer mit einer gewissen Beliebigkeit verbunden. Doch kaum ein anderer Wettbewerb vermag den Stand der Architektur in der Schweiz zu Beginn der 1970er Jahre besser zu veranschaulichen als jener für den neuen Campus der Ecole Polytechnique Fédérale in Lausanne (EPFL). Es war die letzte Konkurrenz, die einen gesamtschweizerischen Überblick vermittelte, hatte doch die Schweizerische Eidgenossenschaft sieben die Grossregionen der Schweiz repräsentierende Büros zur Teilnahme eingeladen. Die von ihnen gewählten Entwurfsansätze – vom rasterförmigen «Richtplan» der siegreich aus der Ausschreibung hervorgegangenen Arbeitsgruppe «Zürich» um Jakob Zweifel über den «Planungsraster» von Paul Waltenspühl (Genf) und die scheinbar unendlich erweiterbare Struktur der Gruppe «Basel» bis hin zur «Matrix» der Gruppe «Solothurn» um Fritz Haller, Alfons Barth und Hans Zaugg – beruhten auf einem gemeinsamen Verständnis der Universität als Produktionsanlage von Wissen, welche sich – vergleichbar mit einer industriellen Produktionsanlage – durch ihre flexible, offene Struktur den wechselnden Bedingungen anzupassen hatte.
Problem der Form
Auch wenn sich im Projekt der Tessiner Gruppe mit Mario Botta, Tita Carloni, Aurelio Galfetti, Flora Ruchat und Luigi Snozzi durchaus vergleichbare Tendenzen zur Grossform verorten lassen, stellt das, was in diesem Projekt trotz seinem Massstab in einer einzigartigen Klarheit zum Ausdruck kommt, einen Paradigmenwechsel dar, der in der Schweizer Architektur nach wie vor wirksam ist. Die Vorstellung der Architektur als einer anpassbaren, veränderbaren, erweiterbaren Umgebung ist hier ersetzt durch ein Verständnis der Architektur als ein Problem der Form. Ausgangspunkt des Entwurfs ist die physische Wirklichkeit, sei es die der Stadt oder des Territoriums. Sie bildet den Beginn jeder Analyse, aber auch den Kontext, an dem jeder neue Eingriff gemessen werden muss.
Der Entwurf der Tessiner Gruppe zeigt zum ersten Mal in einer gesamtschweizerischen Konkurrenz, dass die Thesen zur «Autonomie», wie sie in der Schweiz ab den 1970er Jahren in der theoretischen Debatte aufgestellt worden waren, als überzeugende Alternative auch in der architektonischen und städtebaulichen Wirklichkeit Bestand hatten. Mit der Forderung nach Autonomie war hier zuerst und vor allem der Anspruch auf ein Verständnis der Architektur als Disziplin – mit ihren eigenen formalen Regeln – beschrieben. Damit waren die Grundlagen für eine äusserst differenzierte ästhetische Auseinandersetzung festgelegt, die das architektonische Schaffen der Schweiz bis heute massgebend bestimmt und an der Schnittstelle zur bildenden Kunst und den damit einhergehenden wahrnehmungsästhetischen Diskursen bis heute erfolgreich geführt wird.
Aus dieser Perspektive würden die 1970er Jahre einen Bruch mit einem Neuanfang bedeuten. Doch solche Erklärungen, die architektonische Entwicklungen an Daten oder Bruchstellen festzumachen versuchen, sind immer vereinfachend. Sie scheinen ein modernistisches Verständnis von Geschichte weiterzutragen, welches über Brüche und Neuanfänge argumentiert und gerade in einer Disziplin, die sich durch ihre Langatmigkeit auszeichnet, nicht glaubwürdig ist und in der Regel mehr über die Autoren, die diesen Bruch feststellen und propagieren, als über die Wirklichkeit aussagt. Wenn man jedoch die 1970er Jahre nicht nur auf eine architekturtheoretische Debatte reduziert, sondern politisch mit dem Aufkommen einer Verwaltungs- und Kontrollgesellschaft verknüpft oder ökonomisch mit der umfassenden Kommerzialisierung der Kultur in all ihren Bereichen verbindet, dann erweist sich diese Entwicklung als etwas komplizierter.
Tessin und Solothurn
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass das Projekt der Solothurner Gruppe für die EPFL gerne und mit guten Gründen als Gegenprojekt zum Tessiner Wettbewerbsbeitrag verstanden worden ist. Drei Aspekte können beim Solothurner Projekt beispielhaft hervorgehoben werden: Zunächst ein Verständnis der Architektur als technisches Ensemble von Bauteilen, Infrastrukturen, Apparaten und anderen Elementen, die miteinander koordiniert werden müssen und deren Leistungsfähigkeit bemessen und kontrolliert werden kann. Dann der Versuch, die Architektur in ihrer zeitlichen Dimension zu planen und entsprechend auch in ihrer zukünftigen Entwicklung rational zu verwalten. Und schliesslich ein Verständnis der Architektur, das sich nicht auf das einzelne Objekt beschränkt, sondern die gesamte Umwelt, die künstliche wie die natürliche, als ein Problem der Gestaltung versteht.
Was diese Entwicklung, zu Ende gedacht, bedeuten konnte, hat Fritz Haller in seiner Studie der «Totalen Stadt» gezeigt, die 1968 in erster und 1975 in zweiter Auflage erschien. Sie kann als optimistische und technokratische Antwort auf die kulturkritische Betrachtung des «Bauens als Umweltzerstörung» verstanden werden. In ihrem umfassenden Anspruch, die Probleme technisch-infrastrukturell zu lösen, ist sie zu Recht in eine moderne Tradition gestellt worden. Doch wenn die Stadt der Moderne die Stadt der Industriegesellschaft ist, ist das, was Haller hier auf der territorialen Ebene beschreibt, die architektonische Antwort auf die Verwaltungsgesellschaft der späten Nachkriegszeit, deren Merkmal in einer zunehmenden Regulierung von Menschen, Ressourcen, Produkten, Handlungsabläufen, aber auch von architektonischen Prozessen und der Kontrolle der damit erbrachten Leistung mündet.
In der Tat ist das, was sich bei Haller in den atemberaubenden Zeichnungen einer fünf Milliarden Einwohner grossen, netzwerkartig organisierten Stadt abspielt, die zu Ende gedachte Formulierung einer umfassenderen Entwicklung in der Gesellschaft, die Architektur und Städtebau in der späten Nachkriegszeit bestimmt und sich weniger in der invasiven Technik des Hallerschen Modells äussert, sondern viel allgemeiner in den Weisungen, Normen und Gesetzen einer Verwaltungsgesellschaft zeigt. Was Hallers Studie für die damalige Zeit so zukunftsweisend und noch heute so bedeutsam macht, ist nicht ihr vermeintlicher utopischer Charakter, sondern ihre schonungslose Darstellung von Prozessen und Entwicklungen, die sich vorerst noch diskret und unter der kulturellen Wahrnehmungsschwelle abspielen, aber zunehmend sichtbar und für die Architektur ab den 1970er Jahren bestimmend werden.
Welt der Normen
Zielten die Normalisierungsbemühungen bis in die frühen 1960er Jahre darauf, das Bauen in einem rationalen, steuerbaren Rahmen zusammenzufassen, und wurden damit vorerst qualitative Argumente ins Feld geführt, zeigt sich ab der Mitte der 1960er Jahre eine zunehmende Institutionalisierung des Normwesens mit der damit verbundenen Tendenz zur Quantifizierung der Architektur nach ihrer messbaren Leistungsfähigkeit. Diese Bemühungen umfassen nicht nur technische Normen, etwa zu Wärme- oder Schallschutz, sondern betreffen so unterschiedliche Bereiche wie das behindertengerechte Wohnen, die Kunst am Bau oder auch raumplanerische Fragen. Doch unabhängig davon, wie relativ diese vermeintlich objektiven, aber wieder neu verhandelten Kriterien formuliert und wie weit davon entfernt sie sind, sich in ihrer eigenen Kontradiktion aufzulösen, erweisen sich die Bemühungen zur Normalisierung der Architektur als eine zunehmend eigenständige Entwicklung, die im Laufe der späten 1980er und in den 1990er Jahren durch die Forderungen einer europaweiten Vereinheitlichung verstärkt werden.
Die Norm jedoch, welche die veränderte Berufsauffassung des Architekten am deutlichsten widerspiegelt, ist ohne Zweifel jene, welche die «Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten» beschreibt. Sie wird im Laufe der 1970er Jahre vor dem Hintergrund der zunehmend bestimmenden Rolle der Generalunternehmer revidiert, um die neuen Organisationsformen in Planung und Ausführung – Totalunternehmer, Generalunternehmer, Generalplaner und Architekt/Ingenieur – zu unterscheiden. Unabhängig von den unterschiedlichen Positionen, die im Laufe dieser Debatte formuliert wurden, war das, was zur Diskussion stand, die Frage, wer in Planung und Führung die leitende Rolle übernehmen sollte: der Architekt oder der Apparat des Managers, der zunehmend in den Entwurfsprozess eingreifen konnte.
Zur gleichen Zeit, in welcher die Frage der Autonomie in der Architekturtheorie den Diskurs zu bestimmen beginnt, fängt eine parallele Entwicklung an, welche die Autonomie in der Architektur zu untergraben beziehungsweise ihre Grenzen legal und ökonomisch, administrativ und juristisch zu definieren beginnt. Dabei wird die Rolle des Architekten zunehmend – wie Franz Füeg es 1980 bereits festgestellt hatte – zu der eines Spezialisten.
Autonome Disziplin
Damit verbunden ist eine umfassende Transformation des Konzeptes der Autorschaft in der Architektur sanktioniert, vom singulären Autor, der den Entwurf autorisiert und von anderen umsetzen lässt, zur multiplen Autorschaft, in der der Entwurf von verschiedenen Autoren, dem Architekten, dem Ingenieur, dem Produzenten, dem Bauphysiker, dem Unternehmen und anderen, mit signiert und in der die unterschiedlichen Phasen von Entwurf und Umsetzung überlagert sind.
Diese Verschiebung ist oft mit der digitalen Revolution in Verbindung gebracht worden. Doch wie ein Blick in die jüngste Vergangenheit zeigt, ist diese Verschiebung Ausdruck einer viel umfassenderen Entwicklung in Architektur und Gesellschaft, die in sicherheitstechnischen, energetischen, feuerpolizeilichen und anderen Gesetzen und Normen ihre Bürokratisierung, aber auch in der polytechnischen Forschung ihre Akademisierung erfahren hat. Denn diese Entwicklungen sind sozial, bevor sie technisch oder architektonisch sind.
Sosehr die Vorstellung der Architektur als autonome Disziplin für die Architekturdebatte in der Schweiz der letzten 40 Jahre von Bedeutung gewesen ist, so spiegelt sie, zu Ende gedacht, eine weitere Spezialisierung der Disziplin, in deren Folge die Architektur auf ein Formproblem reduziert wird: Zeitschriften und Monografien, Campus-Anlagen wie diejenige von Novartis, Signature-Buildings wie die Flag-Ship-Stores von Prada oder das Guggenheim-Museum in Bilbao zeugen davon.
Es ist wohl kein Zufall, dass die zeitgenössische Schweizer Architektur von Mario Botta über Herzog & de Meuron bis Peter Zumthor dank ihrer verfeinerten Bildhaftigkeit auf diesem medialen Markt, auf dem die Architektur als eine spezifische Form der Wertschöpfung gesehen wird, eine besondere Aufmerksamkeit erfährt. Dabei wird der Anspruch auf Autonomie des architektonischen Objekts gerade wegen seiner Autonomie als – vermarktbares – Artefakt unterwandert und werden die Grenzen zwischen der architektonischen Form und ihrer ökonomischen Wertschöpfung beziehungsweise Leistung (um noch einmal diesen Begriff zu verwenden) verwischt.
Neue Zürcher Zeitung, Sa., 2015.12.12
![]()