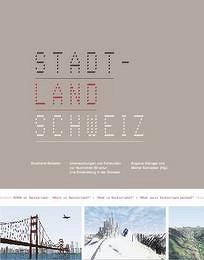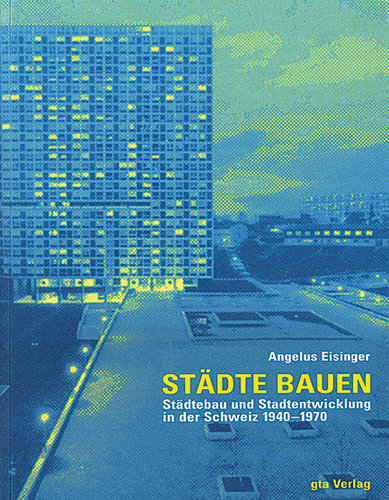Im Londoner Osten findet zwei Jahrzehnte nach dem Umbau der Docklands zum Finanzzentrum erneut ein Umbruch statt. Bis 2012, wenn hier die Olympischen Spiele stattfinden, soll das East End, die «schmutzige Seite der Stadt», ein «attraktiver Standort» werden. Die Renaissance der Planung unter Mayor Ken Living-stone und die im «London Plan» publizierten Szenarien der Stadtregierung vermitteln das Bild einer Metropole, die nach dem Laisser-faire der Thatcher-Ära wieder Verantwortung für das Gemeinwohl übernimmt. Doch ist unsicher, ob das gelingt; die Spielräume der Planung sind klein, die Interessen vielschichtig.
Im Londoner Osten findet zwei Jahrzehnte nach dem Umbau der Docklands zum Finanzzentrum erneut ein Umbruch statt. Bis 2012, wenn hier die Olympischen Spiele stattfinden, soll das East End, die «schmutzige Seite der Stadt», ein «attraktiver Standort» werden. Die Renaissance der Planung unter Mayor Ken Living-stone und die im «London Plan» publizierten Szenarien der Stadtregierung vermitteln das Bild einer Metropole, die nach dem Laisser-faire der Thatcher-Ära wieder Verantwortung für das Gemeinwohl übernimmt. Doch ist unsicher, ob das gelingt; die Spielräume der Planung sind klein, die Interessen vielschichtig.
Aldgate, ein Verkehrskreisel, dessen bauliche Umgebung allen Aufwertungsmassnahmen zu trotzen scheint, markiert den östlichen Zugang zum Nervenzentrum der Global City. Bis 1761 stand hier ein Stadttor, und auch heute wird der Eintritt zur «Square Mile» streng kontrolliert: Strassenmarkierungen und Videoüberwachung sorgen dafür, dass alle, die mit ihrem Auto passieren, die Congestion Charge entrichten, jene Gebühr für den motorisierten Individualverkehr, die Londons Innenstadt ein wenig vom Stauchaos befreit hat. Hier verläuft auch der Ring of Steel, den die Sicherheitsbehörden nach dem IRA-Bombenterror der 1980er- und frühen 1990er-Jahre rund um den Finanzdistrikt errichtet haben, mit Kameras, Wachhäuschen und Fahrbahnverengungen an den Einfahrten. Unter dem Asphalt liegt ein Gleisdreieck des U-Bahn-Netzes, hier zweigt die District Line vom Stammnetz der Circle Line ins East End ab. Am 7. Juli 2005 war es einer der Schauplätze der Anschläge islamistischer Attentäter auf Londons öffentlichen Nahverkehr (Bild 11).
Aldgate ist das Scharnier zwischen Innenstadt und East End. Hier treffen die unterschiedlichen Interessen und Lebenswelten der 7.3 Mio. Londoner aufeinander. Auf der einen Seite steht das boomende Geschäftsviertel mit seiner global orientierten, hochqualifizierten Klasse von Managern und seinen Armeen von Angestellten. Auf der anderen beginnen die deindustrialisierten Aussenquartiere mit einer Bewohnerschaft, die häufig über eine geringe Berufsqualifikation verfügt und schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs nachgeht.
Bereits Brick Lane, eine Strasse, die unweit von Aldgate in Nord-Süd-Richtung durch das East End verläuft, liegt im Schatten der City. Sie stellt einen «liminal space» dar, wie die Stadtforscherin Sharon Zukin diese Schnittpunkte der unterschiedlichen Logiken, Dynamiken und Realitäten einer postindustriellen Stadt nennt.[1] Seit Jahrhunderten wird hier der Textilhandel abgewickelt, doch seine Bedeutung hat stark abgenommen. Zuerst wurde der Markt von Hugenotten, später von Juden kontrolliert. Seit den 1960er-Jahren haben ihn muslimische Einwanderer aus Bangladesch übernommen, von denen heute rund 40000 im East End leben. Die Synagoge wurde schon 1976 zur Moschee umgenutzt, nur eine Bagel-Bäckerei erinnert noch an die ehemals jüdische Einwohnerschaft der heutigen «Banglatown».
Einen kritischen Blick auf die gelebte Multikulturalität in «Banglatown» lieferte 2003 der Roman «Brick Lane» von Monica Ali. Ihre Darstellung eines Frauenschicksals kam zwar beim britischen Publikum gut an. Einige Wortführer der muslimischen Gemeinde betrachteten den Roman aber als verunglimpfende Darstellung ihrer Lebensweise und blockieren derzeit seine Verfilmung vor Ort.
Noch immer ist das East End für viele Londoner eine Terra incognita. Doch in den letzten Jahren hat sich die Gegend um Brick Lane immer mehr zu einem Schwerpunkt des Nachtlebens und zur Touristenattraktion entwickelt. Zahlreiche Clubs und um Kundschaft kämpfende Curry-Restaurants bieten einen ersten Zugang zum Londoner Osten. Der Gentrifizierungsprozess gewann an Fahrt, als der Spitalfield’s Market, eine alte Obst- und Gemüsemarkthalle, von Trödelhändlern übernommen und die ehemalige Truman-Brauerei zum Kulturzentrum mit Szenecafés und Boutiquen umgenutzt wurde. Inzwischen stösst man unweit der Brick Lane auf die Dependance der Zürcher Galerie Hauser & Wirth, die wie andere Galerien die Gegend als Adresse für zeitgenössische Kunst erschliesst. Das Gelände des Güterbahnhofs Bishopsgate ist leergeräumt, hier soll eine grosse Büroüberbauung nach Plänen von Kees Christiaanse entstehen.
Der rote Ken – Kaiser ohne Land?
Der Ausbau der East London Line dürfte das East End über «Banglatown» hinaus zum attraktiven Stadtviertel machen. Ihre bisherige Endstation Shoreditch wird seit Juni wegen der Baumassnahmen nicht mehr angefahren. Hinter Brick Lane versteckt, kündet der Zustand dieses Bahnhofs von der jahrzehntelangen Unterfinanzierung von London Underground und erinnert daran, dass die traditionellen Arbeiterbezirke einst nur zögerlich in den Einzugsbereich des U-Bahn-Netzes integriert worden waren. Um die East London Line ins ebenfalls ärmliche Hackney zu verlängern, sollen nun stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert und zusammengeschlossen werden. Eine langfristige Planung beabsichtigt, die East London Line mit weiteren Bahnstrecken im Norden, Süden und Westen zu verknüpfen und in einem neuen innerstädtischen S-Bahn-Ring (Orbirail) aufgehen zu lassen
(vgl.Kasten Bahnverkehr in London, S.13).
In den überlasteten Zügen von Londons U-Bahn-Netz ist einer allgegenwärtig: Ken Livingstone, Mayor of London. Sein Konterfei und sein fast schon zur Marke gewordener Name erwecken nach den Jahren, in denen die Alltagsbelange von den 33 Stadtbezirksverwaltungen geregelt wurden, die wichtigen Entscheidungen über Londons Zukunft aber die britische Regierung traf, den Eindruck: «London regiert sich wieder selbst». 1986 hatte Premierministerin Margaret Thatcher den Greater London Council (GLC), den damals vom linken Labour-Flügel dominierten Londoner Magistrat, kurzerhand abgeschafft, weil er sich ihren Angriffen auf den Sozialstaat widersetzte. Der Name des GLC-Vorstehers lautete – Ken Livingstone.
An die politische Spitze der Stadt zurückgekehrt, besitzt der «rote Ken», eingezwängt zwischen dem Zentralismus von Westminster und den Ansprüchen von Stadtbezirken mit bis zu 340000 Einwohnern, bisher nur eingeschränkte Macht. De facto unterstehen dem Mayor Polizei, Feuerwehr, Teile des Strassennetzes sowie der Grossteil des öffentlichen Verkehrssystems. Im Londoner Alltag sind es jedoch weiterhin die 33 Boroughs, in denen sich die Stadt für ihre Einwohner verkörpert. Sie haben ihre eigenen Parlamente, die Councils, sind für Volksschulen, Bibliotheken und die medizinische Grundversorgung zuständig und verwalten den sozialen Wohnungsbau. Auch die Council Tax, die von Thatcher eingeführte, je nach Stadtteil unterschiedlich hohe Kopfsteuer, wird von den Boroughs erhoben. Alex Bax, Senior Policy Advisor von Ken Livingstone, behauptet, dass der Londoner Bürgermeister nur 10% der Kompetenzen seiner Kollegen in anderen europäischen Grossstädten besitze. Die seit 1997 in Grossbritannien regierende Labour-Partei hat sich trotz ihres Bekenntnisses zur Dezentralisierung lange gescheut, Befugnisse von der nationalen auf die regionale oder die städtische Ebene zu übertragen. Im Zuge einer Überprüfung ihrer regionalpolitischen Ziele beabsichtigt sie jetzt, Londons Rathaus mit mehr Entscheidungsgewalt auszustatten. Die wichtigste Änderung: In Zukunft kann der Bürgermeister über das bislang national verwaltete, 850 Mio. Pfund schwere Budget für die Wohnbauförderung in London verfügen. Für die Verbesserung der beruflichen Ausbildung und Qualifikation der Arbeitskräfte soll demnächst ein von Livingstone geführtes Skills and Employment Board zuständig sein.
Die Vertreter der Boroughs kritisieren, dass die Neuausrichtung der kommunalen Zuständigkeiten die Autonomie der Bezirke beschneide. Denn bisher liegt auch das Recht zur Ausschreibung und Genehmigung von Bauprojekten in ihrer Hand. Der Bürgermeister kann auf planerische Entscheidungen der Bezirke nur über Leitbilder, Empfehlungen und Richtpläne einwirken. Als stärkste Handhabe bleibt ihm die Möglichkeit, Vorhaben zu stoppen, die der gesamtstädtischen Planungsstrategie zuwiderlaufen. Künftig soll der Mayor aber Entwicklungsprojekte, die von stadtweiter Bedeutung sind, selbst in die Wege leiten können – auch über Einsprüche der Bezirke hinweg. Livingstone hat jedoch verlauten lassen, dass er diese Befugnis nur sparsam und vor allem zum dringend nötigen Bau von erschwinglichem Wohnraum in Anspruch nehmen will.
Der «London Plan»
Die hinzugewonnene Entscheidungsgewalt ist die Anerkennung Westminsters für Livingstones starke Regierungsleistung während der letzten sechs Jahre. So betreibt Londons Stadtoberhaupt mit beschränkten Mitteln eine äusserst ambitionierte Stadtplanung, die er 2004 im «London Plan» bündelte. Dieser soll die künftige Entwicklung Londons in eine sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Richtung lenken. Drei Jahre dauerte die Arbeit an dem Planwerk, das sich 2006 in der Vernehmlassung befindet. Den eigentlichen Anstoss dazu gab das Gesetz zur Schaffung der Greater London Authority (GLA). Es verpflichtete die Stadtregierung, eine Strategie zur räumlichen Entwicklung Londons für die nächsten 15bis20 Jahre zu entwerfen, die das Stückwerk aus bisher existierenden Plänen ersetzen soll.
Die GLA geht bei ihrer Planung von der Annahme aus, der in der Globalisierung begründete Zentralisierungsdruck werde über die nächsten Dekaden anhalten. Sie rechnet von 2003 bis 2016 mit einer Zunahme der Londoner Bevölkerung um 810000 Einwohner. Um dieses Wachstum aufzufangen, müssten pro Jahr rund 30000 neue Wohnungen errichtet werden. Die Planer kalkulieren auch mit 636000 neuen Jobs vor allem im Finanz- und Firmendienstleistungssektor in der City und in den Docklands sowie in der Freizeit-, Tourismus- und Kulturindustrie.
Livingstone problematisiert die Wachstumsprognosen nicht. Im Gegenteil: Jeder Versuch, das Wachstum zu bremsen und London die zum Erhalt seiner Wettbewerbsfähigkeit notwendigen Ressourcen zu verweigern, würde, so sein Vorwort zum 2002 erschienenen ersten Entwurf des London Plan, «die ökonomische Effizienz der Stadt schwächen, die Lebensqualität der Londoner mindern und Londons Umwelt zerstören».2 Denn aus Livingstones Sicht bietet der Zentralisierungsdruck die Chance, den ökologisch bedenklichen Suburbanisierungstendenzen der vergangenen Jahrzehnte zu begegnen. Keinesfalls sollen die neuen Wohnungen und Arbeitsplätze den Green Belt, den nach 1945 um London gelegten Grüngürtel, tangieren. Vielmehr soll innerhalb des Green Belt zwischen schon vorhandenen Bebauungen oder auf stillgelegten Industriearealen verdichtet werden, und zwar mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Der London Plan weist die grössten dieser spezifischen Lagen als «Opportunity Areas» aus. Sie sollten mindes-tens 5000 Jobs, 2500 Wohnungen oder eine Mischung aus beidem beherbergen und mit Einkaufs-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen ausgestattet sein. Daneben werden Gebiete, die unter einem hohen Mass an sozialer Ausgrenzung und ökonomischem Niedergang leiden, zu «Areas of Regeneration» erklärt. Planung soll hier mit gesundheits-, sicherheits-, bildungs-, arbeits- und wohnungspolitischen Programmen verzahnt werden, um die durch den Wohnort bedingten Benachteiligungen der Bevölkerung dieser Quartiere innerhalb der nächsten zehn bis zwanzig Jahre zu beseitigen.[3]
Diese strategischen Vorgaben mit ihren stadtweiten Effekten erfordern die koordinierte Anstrengung der 33 Boroughs. Deren Entwicklungspläne müssen den neuen gesetzlichen Grundlagen der GLA zufolge eine «generelle Konformität zum Gesamtplan» aufweisen. Um die Zusammenarbeit zu forcieren, teilt der London Plan die Stadt in die fünf Subregionen West-, North-, Central-, South- und East-London ein, für die es konkretere Planungsrahmen zu erarbeiten gilt.
Den Osten regenerieren
Ein solcher Planungsrahmen liegt für den Londoner Osten seit Mai 2005 vor. Die Stadtregierung weist der Entwicklung dieser Subregion oberste Priorität zu, denn ihr haftet nach wie vor der Ruf an, die «schmutzige Seite» der Stadt zu sein, obwohl der Hafen, die Werften und der überwiegende Teil der Fabrikation, die den Osten über Jahrhunderte zum wirtschaftlichen Motor Londons gemacht hatten, spätestens Ende der 1970er-Jahre stillgelegt wurden (Bild 12). Nach 1980 entstanden in den Docklands, dem von der Thatcher-Regierung angeschobenen Stadtentwicklungsprojekt, zwar 17000 neue Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor. Doch der Bezirk Tower Hamlets, in dem die Docklands liegen, gehört wie Hackney und Newham weiterhin zu den zehn ärmsten Verwaltungseinheiten Englands. Die drei Boroughs weisen mit bis zu 16% die höchsten Arbeitslosenzahlen des Landes auf. Nirgendwo sonst in London leben so viele Menschen in derart vernachlässigten Sozialbausiedlungen – eine Folge des ebenfalls unter Thatcher vollzogenen Rückzugs des Staates aus der Verantwortung für ihren Unterhalt (vgl. Kasten Das gentrifizierte Hochhaus»», S.16). Deshalb identifiziert der London Plan weite Teile der drei Bezirke als «Areas of Regeneration».
In deren unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich aber auch die meisten der «Opportunity Areas», die der London Plan für den Osten markiert, wie etwa das Gelände der Olympischen Spiele 2012. Nicht zuletzt die erklärte Absicht der Stadtregierung, die Ausrichtung der Spiele als aktives Instrument zur Aufwertung des vernachlässigten East End einzusetzen, überzeugte das IOC von Londons Bewerbung, weshalb die Stadt überraschend den Zuschlag vor der Favoritin Paris bekam. Wenige Kilometer östlich von Brick Lane entstehen nun innerhalb von sechs Jahren im ehemals stark industrialisierten Lower Lea Valley ein neues Olympiastadion und Wettkampfarenen für Schwimmen, Hockey, Basketball, Handball und Radsport (vgl. Kasten Die Olympischen Spiele 2012, S.17).
Die Kandidatur Londons war auch deshalb erfolgreich, weil die Sportstättenplanung sich auf schon fast fertig gestellte Verbesserungen des öffentlichen Transportsystems gründen kann. So wird 2007 mitten auf dem zukünftigen Olympiagelände der Bahnhof Stratford International eröffnet, eine Haltestelle auf dem Channel Tunnel Link für die Züge vom Kontinent, der dann weiter bis in den erneuerten Bahnhof St.Pancras am nördlichen Innenstadtrand führt. Von St.Pancras soll 2012 die unterirdische Shuttle-Verbindung Zehntausende Olympiabesucher in nur sieben Minuten ins Lower Lea Valley befördern.
Südöstlich von Stratford International und des Olympiageländes entsteht ein komplett neues Büro- und Geschäftsviertel, das nach der City und den Docklands als dritter Londoner Standort für global agierende Finanz- und Firmendienstleistungen vorgesehen ist. Hier sollen 30000 der rund 213000 Jobs angesiedelt werden, für die in den «Opportunity Areas» des Ostens laut London Plan Kapazität besteht.[4]
Planung als Symbolpolitik
Die Greater London Authority versucht mit Hilfe des London Plan der zunehmenden sozialräumlichen Polarisierung der Stadt entgegenzutreten, die nach 1980 im Gefolge von Deregulierung und dem Aufstieg Londons zur prosperierenden Global City einsetzte. Der Banken- und Firmendienstleistungssektor der Stadt erwirtschaftet heute rund ein Fünftel des britischen Bruttosozialprodukts. Doch dem Londoner Stadtforscher und Planer Michael Edwards zufolge wirkte das metropolitane Wachstum der vergangenen zwei Jahrzehnte ebenso als Armuts- wie als Wohlstandsmaschine. Statistiken legen die Schattenseiten der Entwicklung rasch frei: So leben über 40% der Kinder Londons in Armut, um nur ein Beispiel zu nennen.[5]
Livingstone will von nun an ökonomisches Wachstum nachhaltig gestalten und alle Bewohner daran teilhaben lassen. Diese Zielsetzung lässt sich heute nicht mehr mit flächendeckenden und starren Konzepten und noch viel weniger mit in Architektur und Städtebau verfestigten Bildern einer Stadt oder Region verfolgen. Planung als Antwort auf die Effekte der Globalisierung und vergangener Privatisierungspolitiken erfordert vor allem Moderation, Vertrauensbildung und Kommunikation – erst recht in London, wo nationalstaatliche Ministerien und Behören, die Verwaltungen der 33 Boroughs, Nichtregierungsorganisationen und Nachbarschaftsinitiativen und natürlich auch die Privatwirtschaft im Planungsprozess mitreden. Livingstone versucht mit seiner für die kommunale Politik ungewöhnlich gut geölten PR-Maschinerie und Schlagwörtern wie «accessible city», «inclusive city» oder «examplary sustainable world city» die Hoheit über den Planungsdiskurs zu erlangen. Dabei wendet er auch geschickt die Taktik der Personalisierung und Symbolisierung an. So realisierte Norman Forster 2002 Livingstones Amtssitz an der Themse gegenüber dem Tower of London als futuristisch transparentes Objekt, das zugleich Zukunftsorientierung und Verschlankung der Bürokratie demonstrieren soll. Ein weiterer Etablierter der britischen Architekturszene, Sir Richard Rogers, ist Chef der Architecture and Urbanism Unit des Rathauses. Diese übernimmt die Funktion einer Ratgeberin für «good urban design» und hat jüngst eine Richtschnur für Behörden zur Durchführung von – bisher praktisch unbekannten – Architektur- und Städtebauwettbewerben formuliert.
Livingstones Planwerk: offene Fragen
Es entbehrt nicht der Ironie, dass die Kritik an Livingstones Entwicklungsstrategie sich ausgerechnet daran entzündet, dass diese das Prunkstück der Londoner Planungsgeschichte, den Green Belt, für sakrosankt erklärt. Generationen europäischer Planer haben ihre britischen Kollegen um das Amalgam von Siedlungstrenngürtel, Erholungsraum und Agrarfläche beneidet. Heute sind es gerade die älteren britischen Planer wie Sir Peter Hall, Michael Edwards oder Drummond Robson, die den Green Belt als mittlerweile sinnentleertes Relikt einer längst vergangenen Ära taxieren. Für sie steht seine Unantastbarkeit besseren Lösungen im Weg. Diese Sichtweise wird leicht nachvollziehbar, betrachtet man die Entwicklung der durchschnittlichen Reisezeit zum Arbeitsplatz in der Metropolregion. Zwischen 1991 und 2001 haben die Pendeldistanzen – durchaus im Einklang mit dem europaweiten Trend – erheblich zugenommen, und zwar gerade in den Distrikten, die am weitesten von der Londoner City entfernt sind. Mit anderen Worten: Der Green Belt hat die Sogwirkung des Zentrums nicht unterbinden können. Vielmehr hat er, weil er viel potenzielles Siedlungsgebiet besetzt, zu einer beträchtlichen Verteuerung der Immobilien geführt.
Mit der Erhaltung des Green Belt vergibt der heutige London Plan nach Ansicht seiner Kritiker die Chance, die monozentristische Tendenz des jüngsten Entwicklungsschubs aufzubrechen. Alternative Wege zu beschreiten hiesse aber, den Fokus auf die Stadt aufzugeben und ein grossräumiges Vorgehen anzustreben, wie dies 1944 der Greater London Plan tat (vgl. Kasten S.16). Vorschläge dieser Art liegen vor, so das Orbinet-Konzept, das mehrere Verkehrsknoten in den äusseren Stadtteilen effizient miteinander zu verbinden sucht. Damit liesse sich nicht nur das Zentrum entlasten, sondern die Planer könnten sich direkt der Aufgabe stellen, an welcher sich nach Ansicht vieler Experten die Zukunft Londons entscheiden wird: der Entwicklung der Suburbs, in denen heute der grösste Teil der Londoner Bevölkerung zuhause ist.[6]
Livingstones London Plan, meinen seine Kritiker, weiche dieser Herausforderung aus. Stattdessen entfache er eine unerquickliche Debatte über die Verdichtung der City mit weiteren, diesmal jedoch ökologisch korrekten Hochhaus-Ikonen. Livingstones Politik vertraue auf eine Fortsetzung des ökonomischen Booms und treffe keine Vorkehrungen für den Fall, dass die Wachstumsmotoren der Londoner Entwicklung ins Stottern kommen sollten.
Kooperationen innerhalb begrenzter Spielräume
Livingstone untersteht ein Gebiet, dessen Einwohnerzahl jene der Schweiz übertrifft. Doch anders als die Eidgenossenschaft hat London innerhalb eines knappen halben Jahrhunderts vier unterschiedliche Regierungsformen erfahren (vgl. Chonik S.12). Politische und wirtschaftliche Umbrüche haben aus London einen fragmentierten Raum gemacht, in dem sich die Machtsphären lokaler, regionaler und nationaler Institutionen überschneiden, blockieren und teilweise wieder auflösen. In diesem Gebilde fehlt es dem Mayor an Macht, um direkt auf die Triebkräfte der Stadtentwicklung einzuwirken, wie dies seinen Vorgängern nach 1945 z.B. über Investitionslenkungen und grossflächigen so-zialen Wohnungsbau möglich war. In den sechs Jahren seiner Amtszeit hat Livingstone jedoch demonstrieren können, dass die wichtigsten Mittel der Planung längst nicht mehr das Reissbrett und die grossen Entwürfe sind, sondern mediale Präsenz und ein moderierender Regierungsstil, der die unterschiedlichsten Akteure in Entscheidungsprozesse einbindet. So lassen sich trotz des beschränkten Handlungsspielraums Dinge in Bewegung setzen. Beispielsweise schafft der London Plan eine stadträumliche Wahrnehmung über die Grenzen der Boroughs hinweg und befördert so die Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit und neue Formen der Kooperation. Oder er legt Orientierungslinien für Standards im Wohnungsbau fest und präsentiert in den von Richard Rogers orchestrierten Arbeiten Typologien höherer Dichte.
Der London Plan ist voll von Absichtserklärungen zu allen zentralen Belangen der Londoner Stadtwirklichkeit. Doch die Umsetzung, insbesondere von Livingstones sozialpolitischen Zielen, hängt wesentlich davon ab, inwieweit es der Greater London Authority gelingt, stabile Kompromisse zu etablieren zwischen den stark divergierenden Interessen der Privatwirtschaft und einer breiten, auf staatliche Unterstützung angewiesenen Bevölkerung. Ein letzter Blick auf das East End macht den Balanceakt deutlich, den die GLA vollführen will. Ohne eigene Ressourcen ist die Stadt auf Developer angewiesen, um den Raum östlich von Aldgate baulich weiterzuentwickeln. Doch mit ihren auf grösstmögliche Rendite ausgerichteten Inszenierungen einer exklusiven Urbanität waren Developer in der Vergangenheit treibende Kräfte bei der Verdrängung ärmerer Bevölkerungsgruppen. Die Frage stellt sich, ob der Bau des Olympiageländes im Lower Lea Valley oder des neuen Geschäftsviertels in Stratford dieses Muster durchbrechen kann. Es bleibt abzuwarten, ob es dem Bürgermeister mit der erweiterten Planungsbefugnis und seiner neu gewonnenen Zuständigkeit über die Wohnungsbauförderung gelingt, der sozialräumlichen Polarisierung Einhalt zu gebieten. Mit der Verkehrspolitik hält Livingstone jedoch einen Trumpf in der Hand, den er jetzt schon im Sinne der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit der Stadtentwicklung einzusetzen versucht. Die Eindämmung der allgegenwärtigen Staus mit Hilfe der Congestion Charge, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und erste Tarifermässigungen haben der Stadt schon jetzt eine neue Prägung verliehen. Die Massnahmen zielen nicht zuletzt darauf ab, den Lebens- und Arbeitsalltag der Londoner mit geringerem Einkommen zu erleichtern. Ihr Erfolg und ihre Popularität könnten für jenen Rückhalt in der Bevölkerung sorgen, den die Stadtregierung braucht, um die ambitionierten Ziele des London Plan zu erreichen. Angesichts der vielschichtigen Machtfelder und Interessenlagen, die in der Global City aufeinanderstossen, ist Planung hier ein Moderieren instabiler Koalitionen in einem unberechenbaren Kräftespiel.
Zusatz 1:
Vier Regierungsformen Londons
1888 –1964 London County Council (LCC): erste Londoner Zentralbehörde
1965 –1985 Greater London Council (GLC): Reorganisation Grossraum London zu 33 Bezirken (bis heute gültige Einteilung)
1986 –1999 London Planning Authority Committee: Rumpfbehörde nach Abschaffung von GLC (Aufteilung der Kompetenzen zwischen Nationalregierung und 33 Stadtbezirken)
seit 2000 Greater London Authority (GLA) unter Mayor Ken Livingstone (erste Direktwahl eines Bürgermeisters in Londons Geschichte)
Chronik
1944 Veröffentlichung des Greater London Plan im Hinblick auf den Wiederaufbau, Verfasser Patrick Abercrombie im Auftrag der Churchill-Regierung, Entscheid zur Gründung von 10 New Towns in der Agglomeration
1947 Town and Country Planning Act der Atlee-Regierung: Stärkung der Planungshoheit von LCC, Eindämmung von Sonderprivilegien der City, Unterbindung von Grundstückspekulation
1951 Festival of Britain im Jubiläumsjahr der Weltausstellung von 1851: Ankurbelung von Regeneration am deindustrialisierten Südufer der Themse (Southbank-Kulturzentrum) und von Wohnungsbau im East End (Wohnbauausstellung Lansbury Estate)
1956 – 1968 nationale Wohnungsbaupolitik: Subventionierung von Wohnhochhäusern («tower flats», umfangreiche Flächen-sanierung und Wohnungsbauproduktion im East End
ab 1969 Umwandlung stillgelegter Hafenanlagen im East End, Landverkauf finanziert neuen Containerhafen an der Themsemündung
1970 Baubeginn Thamesmead: letzte GLC-Grosssiedlung mit 60 000 Einwohnern
1973 erste Docklands-Planungen unter GLC
1976 Annahme Greater London Development Plan (Vorgänger des aktuellen London Plan)
1981 Rückzug von GLC aus sozialem Wohnungsbau, schrittweise Übertragung des Bestands an Bezirke, Right to Buy (Privatisierung von 177 000 Einheiten in 10 Jahren)
1981 Gründung London Docklands Development Corpora-tion durch Thatcher-Regierung: marktwirtschaftlich orientierte Regeneration von East-End-Hafenbrachen, GLC und Bezirk Tower Hamlets verlieren Planungshoheit
1985 Local Government Act der Thatcher-Regierung: Beschluss zur Abschaffung von GLC
1987 Eröffnung London City Airport und Docklands Light Railway (privat erstellte Hochbahn zur Verbindung des Regenera-tionsgebiets mit der City)
1988 Baubeginn Docklands-Finanzzentrum Canary Wharf, Hauptmieter Credit Suisse First Boston
1994 Schaffung des Amts «Minister for London» im nationalen Umweltministerium
1999 Greater London Authority Act der Blair-Regierung: Beschluss zur Schaffung einer Londoner Zentralbehörde mit Bürgermeister
2000 Wahl von Ken Livingstone zum Mayor of London
2001 Schaffung von Transport for London: Zuständigkeit für
U-Bahn, Busse, Strassen, ab 2006 S-Bahn auf Stadtgebiet
2003 Einführung der Congestion Charge (Strassenmaut im Stadtzentrum, 2007 Verdoppelung nach Westen)
2004 Veröffentlichung London Plan, Wiederwahl von Ken Livingstone
2005 (6. / 7. Juli) IOC-Entscheid für London als Austragungsort der Olymischen Spiele 2012
2005 Attentate islamistischer Terroristen auf öffentlichen Verkehr in London mit 52 Todesopfern
2007 unterirdische Schnellverbindung zum Kanaltunnel, neuer Eurostar-Terminal in London St. Pancras, Stratford International als Zwischenstation im East End (Fahrzeit nach Brüssel: 1. 45 h)
Zusatz 2:
Bahnverkehr in London
London war nie eine Metropole aus einem Guss, sondern in den Worten des Schriftstellers Henry James «a tremendous chapter of accidents». Stadträumliche Orientierung hängt hier weniger von städtebaulichen Hierarchien als von individuellen Interessen ab. Im Unterschied zu Paris, Wien oder Berlin verfügt London über keine «eindeutige» Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie. Nach einem übergeordneten Strukturprinzip wurde jedoch in der Moderne gesucht: Im Hinblick auf den Wiederaufbau nach Kriegsende erfand der Greater London Plan von 1944 eher willkürlich eine konzentrische Struktur für den Londoner Grossraum. Immerhin erhielt der zweitäusserste von vier Ringen eine Bestätigung, als dort die Ringautobahn M25 gebaut wurde. Dass London heute als Stadt mit Kern und Rand wahrgenommen wird, hängt vor allem mit dem in den 1970er-Jahren eingeführten Tarifsystem des öffentlichen Verkehrs zusammen. So berechnet London Underground die Fahrpreise nicht nach zurückgelegter Distanz, sondern nach starren Tarifzonen. Diese legen sich als Ringe um das Herz von Greater London. Angesichts der horrenden Tarife kann sich ein Leben innerhalb oder ausserhalb von «Zone 1» auf das persönliche Budget ähnlich auswirken wie der Steuerfuss einer Schweizer Gemeinde.
Eher von infrastrukturellen als von stadtmorphologischen Ordnungen diktiert, erscheint die Modellierung des Grossraums London manchmal beinah japanisch. Ihre «Abstraktheit» ist Ausdruck schierer Grösse und Komplexität, aber auch die Folge einer britischen Tradition: Stets stand die Hauptstadt Machtdemonstrationen einzelner Akteure in Gestalt von städtebaulichen Inszenierungen skeptisch gegenüber. In diesem Vakuum wird Städtebau über Verkehrssysteme betrieben, seit Mitte des 19. Jahrhunderts private Unternehmer die Grundlagen zu «London Underground» legten. Weil diese den Ausbau des Netzes zum wohlhabenden Westen und Norden forcierten, bekamen der Osten und der Süden erst mit grosser Verspätung U-Bahn-Anschluss.
Eine leistungsfähige und moderne Verkehrsinfrastruktur erhielt das East End erst im Zug der Docklands-Planungen. Als frühe Formen von Public-Private-Partnerships sind die Docklands Light Railway (DLR) und die Jubilee Line Beiprodukte von Thatchers privatisierter Stadtentwicklung. Sie waren als reine Direktverbindungen zwischen dem Dienstleistungszentrum Canary Wharf und dem Westen vorgesehen, konnten aber nach langen Verhandlungen zu Verteilern für das East End aufgewertet werden. Über die Docklands hinaus verlängert, bilden DLR und Jubilee Line nun das künftige Rückgrat für den Ausbau Stratfords zum metropolitanen Geschäftszentrum. Die weitere Erschliessung des Londoner Ostens beabsichtigt auch das seit kurzem aufliegende Crossrail-Projekt: Eine neue S-Bahn-Durchmesserlinie soll die U-Bahn entlasten und im Grossraum London eine grössere Mobilität in ost-westlicher Richtung ermöglichen. Dazu ist ein leistungsfähiger Innenstadttunnel mit vielen neuen Haltestellen bis hinaus zum Flughafen Heathrow vorgesehen. Allerdings bestehen erhebliche finanzielle und politische Unwägbarkeiten auf dem Weg zur Realisierung des Vorhabens, das ausserhalb von Livingstones Einflussbereich auf nationaler Ebene verhandelt wird. Umstritten ist Crossrail gerade auch im East End, würde doch seine Sogwirkung den wirtschaftlichen Druck auf Viertel wie Brick Lane weiter steigern.
Zusatz 3:
Greater London Plan 1944
Livingstones London Plan lässt Erinnerungen an den Greater London Plan wach werden – einen Meilenstein der Planungsgeschichte. Seine Verfasser, Patrick Abercrombie und John Henry Forshaw, legten 1944 im Auftrag der Churchill-Regierung ein Wiederaufbaukonzept für die massiv durch deutsche Bomben geschädigte Hauptstadt vor. Dabei erachteten sie die Zerstörungen als Chance zu einer grundlegenden Neuorganisation des Londoner Grossraums. Kernstück bildete ein Konzept von vier konzentrischen Ringen, deren entscheidender der Green Belt war. Dieser in einem Umkreis von 25 bis 35 Meilen um die City gelegte Landschaftsgürtel trennte die Stadt und den ersten Vorortering markant vom Umland ab. So sollte die seit Jahrzehnten anhaltende wirtschaftliche und demografische Sogwirkung der Hauptstadt gebrochen werden. Ausserhalb dieses Gürtels sah der Plan autarke Städte von bescheidener Grösse vor, wie sie dann nach 1947 mit den «New Towns» realisiert wurden.
Im Greater London Plan konkretisierte sich das an der Kleinstadt orientierte Stadtideal der britischen Planer jener Zeit, das auch Abercrombies Reorganisationsvorschläge für die inneren Zonen anleitete. Zugleich war der Plan Ausdruck eines sich seit der Jahrhundertwende verfestigenden planerischen Denkens, wonach gesellschaftliche Probleme wie die Dominanz Londons, die anhaltend prekären Lebensverhältnisse in der Stadt und die Strukturkrisen in Nord- und Mittelengland durch Raumpolitik zu lösen waren. Der Greater London Plan beabsichtigte eine regionale Umverteilung von Zehntausenden von Arbeitsplätzen und Wohnungen für über eine Million Menschen. Unter Planung verstand man damals massive bauliche Eingriffe: Abercrombie und sein Team entwarfen das städtische Leben auf dem Reissbrett, formulierten «Neighbourhoods» als ideale, überschaubare Wohneinheiten, definierten maximale bauliche Dichten, verteilten Quartiere und Stadtteile und konzipierten dafür neue Zent-ren mit allen notwendigen Einrichtungen.
Diese Form von Planung prägte die britische Politik bis Mitte der 1970er-Jahre. Doch bereits seit den 1960er-Jahren mehrten sich in den grossen Sozialbausiedlungen in London oder Liverpool die Zeichen dafür, dass es unmöglich war, gesellschaftliche Entwicklungen allein mit physischer Planung langfristig positiv zu beeinflussen. Erfolglos waren auch die Bemühungen, die New Towns als neue Wachstumskerne in Krisenregionen zu etablieren.
Der Greater London Plan fokussierte auf die Anforderungen der traditionellen britischen Industriegesellschaft und schuf dafür ein prägnantes räumliches Bild. Als gesellschaftliches Entwicklungsszenario hatte er aber für Probleme der Nachkriegszeit wie Massenmotorisierung oder Deindustrialisierung keine Antworten parat. Nach 1970 wurde seine Logik der technokratischen Bearbeitung und Standardisierung örtlicher Belange von lokalen Protestbewegungen in Frage gestellt. Die Konservativen warfen schliesslich den Stadtplanern vor, jede unternehmerische Initiative im Keim zu ersticken. In ihrer zweiten Amtszeit entmachtete Thatcher den Greater London Council und riss planerische Kompetenzen an sich. Die Umrüstung Londons in eine Schaltzentrale globalisierter Kapitalströme geschah nun mittels Entscheidungen hinter verschlossenen Türen, privaten Sonderwirtschaftszonen und Public-Private-Partnership-Projekten.
Zusatz 4:
Das gentrifizierte Hochhaus
Mit seinen exorbitanten Wohnpreisen steht London heute bei den Lebenskosten an der Weltspitze. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Nach Jahrzehnten des Bevölkerungsrückgangs begann 1984 die Einwohnerzahl von Greater London wieder zu wachsen. Zugleich befand sich damals der Staat auf dem Rückzug aus der Wohnungsbauförderung. Mietern wurde der Kauf ihrer Sozialwohnung ermöglicht, was den Wohnungsbesitz in öffentlicher Hand in zehn Jahren um beinah 200 000 Einheiten reduzierte. Das Wohnen wurde vom Kräftespiel des freien Marktes erst richtig erfasst, als sich im folgenden Jahrzehnt die Konjunktur erholte und die Zuwanderung zunahm, seit 2004 auch aus den neuen EU-Ländern in Osteuropa. Im East End spürt man diese gesteigerte Nachfrage lange vor den Aufwertungsmassnahmen, die im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen von 2012 zu erwarten sind. Bereits heute reagieren Immobilienfirmen mit spektakulären Instandsetzungen, so etwa in Whitechapel hinter der East London Mosque. Dort wird das ehemalige Männerwohnheim Tower House zu Lofts umgebaut. In dieser denkmalgeschützten viktorianischen Trutzburg logierte einst Stalin, als er, wie viele andere Russen, nach der fehlgeschlagenen Revolution von 1905 im East End unterkam.
Denkmalgeschützt ist auch das Keeling House in Bethnal Green (Bild 17). Das 1959 nach Plänen von Denys Lasdun errichtete Wohnhochhaus gehört zu den wenigen innovativen Beispielen der Baugattung «Tower Flats», die damals dank staatlichen Zuschüssen im ganzen Land starke Verbreitung fand. Keeling House war der Versuch, Eigenschaften der lokalen Reihenhausviertel in ein skulptural moduliertes System vertikaler «Nachbarschaften» zu übertragen. Dazu stapelte Lasdun 64 Duplexwohnungen an Laubengängen kleeblattförmig um einen offenen Erschliessungskern. Dieses von strukturalistischen Theorien inspirierte Cluster-Prinzip vermochte dennoch nicht den Herausforderungen standzuhalten, mit denen die britische Wohnungsbaupolitik in den folgenden Jahrzehnten konfrontiert war. Die Schwierigkeiten im Viertel, die sozialen Probleme der Mieterschaft, unzureichender Unterhalt und zunehmender Vandalismus in den öffentlich zugänglichen Bereichen des Gebäudes liessen Lasduns Turmexperiment schliesslich scheitern. Ohne den Eingriff des Denkmalschutzes wäre das Keeling House 1993 gesprengt worden. Von einem Developer grundlegend saniert und umgebaut, erscheint es heute wie ein Design-Fetisch aus dem Lifestyle-Magazin «Wallpaper». Den Sockel umgeben nun ein Gitter und ein japanisierender Teich mit schicker Beleuchtung; in der neu zugefügten Eingangshalle sitzt ein Portier. Eine mehrheitlich in der City tätige Bewohnerschaft ist bereit, für eine Zweizimmerwohnung über dem harten Pflaster von Bethnal Green 700 000 Franken zu bezahlen.
Zusatz 5:
Die Olympischen Spiele 2012
Die Queen stand schon hier oben, um sich ein Bild von der Zukunft des East End zu machen: Der Blick von der Kabine auf dem Dach des Holden Point, einem 21-stöckigen Altersheim im Bezirk Newham, fällt gegen Westen auf eine planierte Brache, die vom Channel Tunnel Rail Link durchschnitten wird (Bild 14). Dahinter erstreckt sich ein Wirrwarr aus Fabrikruinen, kleinen Werkstätten, Schrottplätzen, Busdepots, Wiesen und Gestrüpp entlang des River Lea. In sechs Jahren finden auf dem rund 438 ha grossen Areal die Olympischen Spiele statt. 86 % der Fläche befinden sich schon im Besitz der Organisatoren, und diese hoffen, dass bis Ende Dezember eine Einigung mit den rund 100 Betrieben erzielt sein wird, die sich der Räumungsanordnung noch widersetzen. 2007 soll der Bau der Sportstätten beginnen.
Politiker und Planer versprechen sich von dem Mega-Event, dass es die verarmten Stadtteile des Ostens in eine blühende Landschaft verwandelt, und verweisen dabei auf Barcelona, das die Ausrichtung der Olympiade 1992 mit einer allseits als gelungen betrachteten Stadterneuerung verband. Stets wird betont: Für den Erfolg der Londoner Spiele sei entscheidend, was nach ihrem Ende für die Bewohner in der Nachbarschaft übrig bleibt. Schon jetzt ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs östlich der City sichtbar, in den bis 2012 7 Mrd. Pfund investiert werden. Um die Lebensqualität im East End zu steigern, wird das Olympiagelände nach dem Ereignis zum grössten Stadtpark umfunktioniert, der in Europa in den letzten 150 Jahren entstanden ist. Das olympische Dorf soll dann 4000 Wohnungen bieten; weitere 35 000 Wohnungen sollen später hinzukommen, die Hälfte für Haushalte mit geringem Einkommen. Kritiker befürchten jedoch, dass es schon vorher zu einer Verdrängung einkommensschwacher Bevölkerungsteile kommen wird. Kurz nachdem London den Zuschlag für die Spiele erhalten hatte, zogen in Newham die Immobilienpreise massiv an.
Für die Vergabe einzelner Bauprojekte an Architekten werden keine Wettbewerbe durchgeführt. Einzig für das Schwimmstadion ist aus mehreren Entwürfen jener von Zaha Hadid ausgewählt worden. Der Olympiapark wird vom EDAW-Konsortium in Zusammenarbeit mit Arup und Atkins gestaltet, das schon den Masterplan für die Bewerbung entworfen hat (Bild 16). Unklar ist noch, wer das neue Olympiastadion baut. Es soll 80 000 Zuschauer fassen, nach den Spielen auf 25 000 Plätze reduziert werden und als Leichtathletikarena dienen.
Die Kosten für die Spiele werden derzeit auf 3.5 Mrd. Pfund geschätzt. Neben Geldern von privaten Sponsoren werden Mittel aus der staatlichen Lotterie fliessen. Zudem zahlt jeder Londoner Haushalt bis 2012 eine jährliche Olympiasteuer von 20 Pfund.
Für Unmut sorgt bei vielen Bürgern, dass sie Olympia wegen steigender Lohnkosten im Bausektor und verstärkter Sicherheitsmassnahmen noch teurer zu stehen kommen könnte. Bereits rechnet die Bauindustrie mit 400 statt wie ursprünglich mit 280 Mio. Pfund für das Stadion. Alle Mehrkosten muss die Stadt übernehmen. Dieser Tage wird entschieden, welches Unternehmen die Aufsicht über den Bau des Olympiageländes führen soll.
TEC21, Mi., 2006.10.04
verknüpfte Zeitschriftentec21 2006|40 The London Plan
![]()