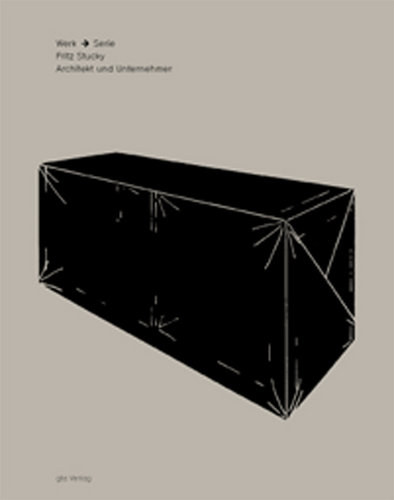In jüngster Zeit ist es Chicago gelungen, sich mit verschiedenen Projekten wieder als Architekturmetropole in Erinnerung zu rufen. Hinter den Entwürfen stehen oft ausländische Architekten. Das Projekt eines Neubaus, der den Titel des höchsten Gebäudes der Welt wieder nach Chicago zurückholen soll, allerdings stammt vom ortsansässigen Büro SOM.
In jüngster Zeit ist es Chicago gelungen, sich mit verschiedenen Projekten wieder als Architekturmetropole in Erinnerung zu rufen. Hinter den Entwürfen stehen oft ausländische Architekten. Das Projekt eines Neubaus, der den Titel des höchsten Gebäudes der Welt wieder nach Chicago zurückholen soll, allerdings stammt vom ortsansässigen Büro SOM.
Mit verschiedenen neuen Projekten hat Chicago - nach eigenem Urteil «the world's most architectural city» - in letzter Zeit wieder auf sich aufmerksam gemacht: mit Renzo Pianos Erweiterung für das Art Institute of Chicago, Frank Gehrys Entwurf für eine Konzertbühne im neuen Millennium Park (dem Grant Park), den Erweiterungen für die University of Chicago von Ricardo Legorreta und Cesar Pelli oder Rem Koolhaas' Wettbewerbsbeitrag für den Campus des Illinois Institute of Technology (NZZ, 3. 7. 98). Ein Umstand verdient dabei Beachtung, nicht zuletzt weil er in Chicago für einige Irritation sorgt. Mit Ausnahme des Kaliforniers Gehry handelt es sich nämlich durchwegs um ausländische Architekten, die mit diesen prestigeträchtigen Aufgaben beauftragt werden. In einer Stadt wie Chicago, die auf eine ruhmreiche Architekturtradition zurückblicken kann und mit der Chicago School of Architecture lange Zeit stilbildend war, gibt dies natürlich zu Diskussionen Anlass.
Wettstreit um das höchste Gebäude
Dabei handelt es sich durchaus nicht um ein neues Phänomen. Bereits in den achtziger Jahren wurden wichtige innerstädtische Bauten von auswärtigen Architekten erstellt, etwa von Philip Johnson, Robert A. M. Stern, dem Japaner Kenzo Tange oder dem Spanier Ricardo Bofill. Trotzdem lösen die neuen Projekte Kritik aus. Ein Teil von Chicagos Architektenzunft befürchtet gar, dass in einer auch architektonisch globalisierten Welt der Bezug zur lokalen Tradition der Chicago School verlorengehe. Andere Stimmen argumentieren besonnener: Selbstkritisch wird auf den schon seit einigen Jahren verblassten Glanz von Chicagos Architekturtradition verwiesen und vermerkt, dass der architektonische Anspruch der Stadt auf der Vergangenheit beruhe. Zugleich überlegt man sich, wie dieses Erbe im nächsten Jahrtausend zu erhalten sei.
Die plakativste Antwort der Stadt, aber auch privater Investoren auf den ganzen Problemkreis sind die genannten Projekte - allen voran jenes für das höchste Haus der Welt, das im September der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Schon beim neuen Campus Center für das IIT prophezeite die «Chicago Tribune» das Ende einer jahrzehntelangen Durststrecke, das Chicago wieder erlauben werde, den Titel der Architekturhauptstadt der USA zurückzufordern. Das jüngste Projekt nun gelangte noch mehr in die Schlagzeilen. Vom neuen Stolz der Stadt, von einer «landmark» in der City oder von einer neuen Touristenattraktion war die Rede. In den Kommentaren konnte man aber auch vom neu entbrannten Wettstreit um das höchste Haus der Welt und vom Kräftemessen zwischen der traditionsreichen Hochhausstadt Chicago und den Metropolen der Tigerstaaten lesen. Das neue Hochhaus im Herzen Chicagos würde sogar die Petronas Towers in Kuala Lumpur überragen, die 1996 das zuvor höchste Haus der Welt, den 1974 in der «Windy City» fertiggestellten Sears Tower, in den Schatten stellten. Damit aber wird der geplante Wolkenkratzer zum Symbol für das Wiedererstarken Chicagos.
Das Projekt «7 South Dearborn»
Das von Adrian Smith vom renommierten Büro Skidmore Owings & Merrill (SOM) entworfene Hochhaus «7 South Dearborn» soll an der Ecke von Dearborn und Madison Street mitten im Loop, im Stadtzentrum Chicagos, zu stehen kommen. Der ohne die 137 Meter messende Dachantenne bereits 472,5 Meter hohe, 108geschossige Turm wird rund 500 Millionen Dollar kosten und neben Büros, Ladenlokalen, Restaurants und Parkflächen auch die höchstgelegenen Eigentumswohnungen aufweisen. Diese sollen über einen hotelähnlichen Zimmerservice, einen Fitnessklub, eine Wäscherei und eine hauseigene Apotheke verfügen. Die obersten Geschosse werden technische Funktionen enthalten und den Kommunikations- und Übermittlungseinrichtungen vorbehalten sein.
Die Fassade ist in Aluminium, Chromstahl und Glas geplant. Sechs unterschiedliche Geschossgruppen werden von aussen sichtbar sein. Sind die unteren zwei durch einen Rücksprung voneinander abgehoben, so werden die oberen vier durch einen Luftzwischenraum, eine Art Fuge, voneinander getrennt. Diese Fuge veranschaulicht das statische Prinzip des Hauses, das aus einem durchgehenden Kern aus Stahlbeton besteht, an den die Geschosse einfach angehängt werden. Damit soll nach Vorstellung des Architekten die zentrale Funktion des Hauses als Kommunikationszentrum ebenso wie die Besonderheit der auskragenden Konstruktion zum Ausdruck gebracht werden.
Obwohl das Projekt auch die Gestaltung des Aussenraumes berücksichtigt - die Plaza vor dem Haus soll unter anderem mit einem Brunnen und einer Plastik möbliert und eine direkte Verbindung vom Gebäudeinnern zur Untergrundbahn hergestellt werden -, lässt es städtebaulich und architektonisch einige Fragen offen. Kann es den vorauseilenden Superlativen, die von einer neuen Epoche im Hochhausbau sprechen, gerecht werden, und kann es zu einer Belebung des umliegenden Stadtraumes beitragen - und schliesslich: wie präsentiert es sich in der bereits bestehenden Skyline von Chicago?
Mit dem Büro SOM zeichnen für das Projekt weltweit ausgewiesene Fachleute verantwortlich, die Chicago mit Bauten von hoher architektonischer Qualität, etwa dem Sears Tower oder dem John Hancock Center, bereicherten. Ebenso klangvoll wie der Name des Architekturbüros ist die städtebauliche Adresse des Neubaus im Herzen des Loop. Damit soll - nachdem in den sechziger und siebziger Jahren Bauten wie das Amoco Building oder das Hancock Center an den Rändern von downtown Chicago errichtet worden sind - das eigentliche Stadtzentrum wieder aufgewertet werden. So stehen denn die Chancen gut, dass der geplante Wolkenkratzer den Ruhm Chicagos ins nächste Jahrtausend tragen kann.
Neugierig macht das Konzept, das hinter dem Gebäude steht: Es ist einerseits der Tradition der Haut-und-Knochen-Architektur von Sears Tower oder Hancock Center verpflichtet, andererseits bricht es radikal mit ihr. Ein Beispiel dieser widersprüchlichen Auffassung sind in Chicago die Marina City Towers, die mit ihrer runden Form und den ebenfalls auskragenden Geschossplatten an das neue Projekt erinnern. Statt nun aber die Tragstruktur aussen sichtbar aufzuzeigen, wie dies das Hancock Center mit seinen Ausfachungen auf fast schon expressive Weise macht, hält das neue Haus seine Struktur verborgen. Einzige Ausnahme ist der das Gebäude durchdringende Betonkern, der - wie erwähnt - an den Gebäudeeinschnitten sichtbar wird. Dieses auffällige Gestaltungsmittel gliedert den Bau in einen Sockel mit Parking und Büros, zwei Mittelteile mit Eigentumswohnungen und in den für Übermittlungseinrichtungen reservierten Schlussabschnitt. Die beiden Antennen werden eine Höhe von 610 Metern erreichen, die aber für die offizielle Messweise nicht berücksichtigt wird.
Eine bauliche Innovation des Entwurfs stellt die Auskragung der Wohnungen aus dem Betonkern dar, wodurch rundum stützenfreie Räume entstehen, die einen unverstellten Blick auf Stadt und See bieten. Ausserdem resultiert daraus ein einfacher Bauablauf, der im Vergleich zu einer herkömmlichen Konstruktion einen Zeitgewinn von etwa sechs Monaten verspricht und dem Bauherrn so Kosten von rund 10 Millionen Dollar einsparen hilft. Weiter erwähnenswert ist die dank den abgerundeten Ecken und den erwähnten Einschnitten vergleichsweise geringe Einwirkung von Windkräften auf das Gebäude.
Muskulöse und fragile Hochhäuser
Doch kann man den Wert eines Hochhauses nicht allein an seinen technischen Innovationen messen. Die besten Beispiele dieses Bautyps überschreiten die Grenze der Ingenieurkunst und werden zu städtischen Identifikationsfiguren. Im Gegensatz etwa zum dunklen, muskulösen, manchmal sogar ein wenig bedrohlichen Sears Tower, der von einer ernsthaften, nüchternen Stadt kündet, erscheint das neue Projekt wie ein fragiles, zerbrechliches Fliegengewicht. Vielleicht gelingt es den Projektverfassern, das Potential des Gebäudes als schimmernder Leuchtturm von kühner Gestalt noch besser auszuschöpfen. Dann könnte es durchaus zum Zeichen unserer medialen Zeit werden. - Da die Spitze des Gebäudes beim jetzigen Projektierungsstand noch nicht ganz überzeugt und der abgerundete Grundriss im Kontext eines präzis gefassten Strassenraums städtebaulich fragwürdig erscheint, möchte man sich eine sorgfältige Überarbeitung des Entwurfs wünschen. Das Vorhaben ist aber noch im Entwicklungsprozess. Daher werden Aspekte wie das Verhältnis des geplanten Hochhauses zur Bautradition Chicagos oder zur bestehenden Stadt sicherlich noch präzisiert werden.
Dafür dürfte nicht zuletzt auch der Bürgermeister Chicagos, Richard M. Daley, mit seiner Vision «putting the pride back in Chicago» garantieren. Bereits während der Rezession unterstützte er Projekte wie die Neugestaltung des Navy Pier oder die Umgestaltung der State Street in einen lebendigen Strassenraum. Jetzt, in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums, in denen sich die Stadt wie von selbst zu regenerieren scheint, ist er bemüht, in enger Zusammenarbeit mit Investoren und Architekten das Bild Chicagos weiter zu verfeinern. Seine Reaktion auf das neuste Hochhausprojekt fiel allerdings - wohl nicht zuletzt im Hinblick auf noch höher geplante Bauten in Schanghai, Hongkong oder Melbourne - etwas zurückhaltend aus. Sollte es seinen angestrebten Rang auch nicht lange halten können, so dürfte ihm immerhin eine Rolle im internationalen Hochhausdiskurs zukommen.
Neue Zürcher Zeitung, Fr., 2000.02.04
![]()