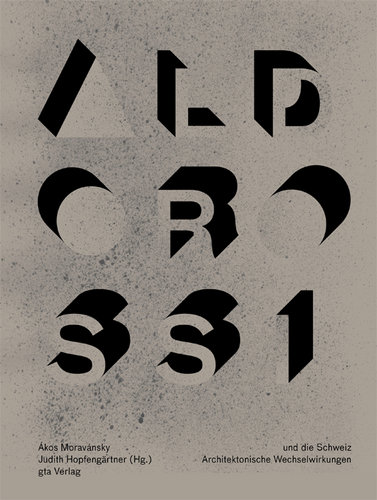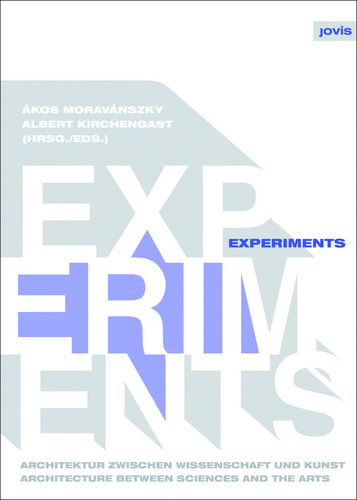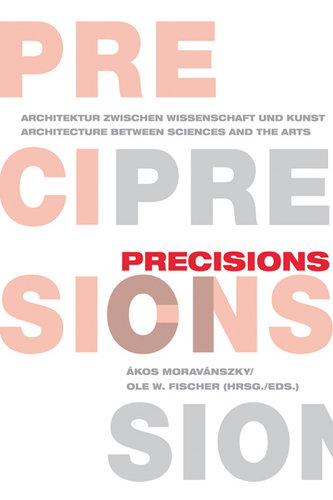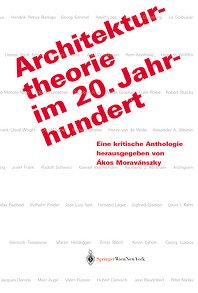Das Problem des Ausdrucks in der Architektur der Donaumonarchie 1900-1914
Das Problem des Ausdrucks in der Architektur der Donaumonarchie 1900-1914
„Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozeß einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinbaren Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst.“ Siegfried Kracauer1
Der Abbau des Semperianismus
Die Wiener Ringstraßenzone wurde als das monumentale Stadtdenkmal des Habsburgerreiches entworfen, Modell für ein urbanes Gesamtkunstwerk am Rande Europas. Der kaiserliche Befehl zum Schleifen der Stadtmauern war der Auftakt zu „Wiens erster Renaissance“, die laut Ferdinand Feldegg, des Redakteurs der Architekturzeitschrift „Der Architekt“ „einen wesentlich aristokratischen Zug hatte.“2 Feldegg betonte in seinem programmatischen Aufsatz zum ersten Jahrgang seiner Zeitschrift (1895), daß die „großen Bauindividuen“ der Ringstraßenzeit Produkte des Bedürfnisses nach Monumentalität waren. Nachdem jetzt die Monumentalwerke alle vollendet seien - schrieb er -, beginne eine neue Periode. Die zweite Wiener Renaissance werde jedoch „mit ihren vorwiegenden Nutzbauten einen demokratischen Zug aufweisen.“3
Die Erkennung der objektiven historischen Bedingtheit als Grundlage architektonischen Schaffens, zugleich jedoch ihre freie künstlerische Aneignung und Transzendierung ins Monumentale4 durch die Symbolik der Kunst war Gottfried Sempers zentraler Gedanke. Schönheit ist kein Zweck in sich, sondern eine Eigenschaft, die aus diesem intuitiv-schöpferischen Akt resultiert.5 Das „große Bauindividuum“ der Ringstraßenzeit war der Baukünstler, der den von Semper beschriebenen divinatorischen Akt vollbringt.
Als Feldeggs Aufsatz erschien, gab es bereits Zeichen für einen Paradigmenwechsel. Das Wiener Kaiserforum, die von Semper zwischen 1869 und 1876 geplante räumliche Apotheose der monumentalen Stadt blieb ein Fragment, wie um 1895 Sempers monumentale Theorie selbst ein aufgelassenes und nur zum Teil verstandenes Konstrukt war.6 Otto Wagner und die Architekten der Wiener Moderne waren bemüht, statt Sempers Metaphysik eine Alltagssprache der Architektur zu entwickeln. In der Philosophie, in der Literatur und Musik gab es parallele Bestrebungen. Intellektuelle hüteten sich überall, die Sprache überzubelasten, an die Grenze der Sprache anzurennen, wie es Wittgenstein formulierte. Josef Hoffmanns frühe Aufsätze und Skizzen „Architektonisches aus der österreichischen Riviera“ (1895) und „Architektonisches von der Insel Capri“ (1897), veröffentlicht in „Der Architekt“, haben zuerst die Aufmerksamkeit auf diese Vorbilder gelenkt, hoffend, daß sie „befruchtend und anregend“ wirken werden. Der maßgebende Raum der Architektur war nicht mehr durch historische Typologien, fixierte räumliche Achsen bestimmt, sondern durch die Zeitlichkeit der alltäglichen Benutzung. Die anonyme Architektur war laut Hoffmann „in ihrer ursprünglichen Natürlichkeit […] frei von übercivilisiertem Kunstverständnisse“, ihre Sprache fragmentiert, ihre Werte nur aus dem Kontext herauszulesen. Die wachsende Aufmerksamkeit für die Formen des einfachen Lebens als Grundlage einer neuen Ästhetik führte die Architektur der Donaumonarchie auf neue Gebiete.
Sprache und Verständigung
Bereits Janik und Toulmin haben die Probleme der Donaumonarchie als Sprachprobleme interpretiert. „Sprache“ bedeutet in ihrem Buch die abstrakte symbolische Struktur7 - ungeachtet der Anzahl der wirklichen Sprachen und Dialekte, die im Gebiet des Doppelstaates gebraucht wurden. Die üblichen Karten der Sprachgebiete der Donaumonarchie, die man in Geschichtsbüchern findet, entsprechen kaum der Wirklichkeit. Nicht nur in den Randgebieten oder in den Großstädten, sondern auch in vielen Kleinstädten und Dörfern lebte eine sprachlich gemischte Bevölkerung, wobei auch die einzelne Person oft mehrere Sprachen kannte und benutzte; Latein, Deutsch, Tschechisch, Ungarisch, Slowenisch, Jiddisch, um nur einige zu nennen. Die Sprachregionen könnten also bestenfalls nur mit einer Reihe von Karten dargestellt werden, die sich zum Teil überlappen. Alle diese Sprachen erfüllten spezifische Funktionen in dem multi-ethnischen Gewebe der Donaumonarchie.
Die Frage der Sprache wurde besonders wichtig, als im Laufe des 19. Jahrhunderts das lang überlebende feudale System langsam von einem neuen, kapitalistischen überlagert wurde. Im alten System sprach die herrschende Aristokratie die ruralen Sprachen der Bauern nicht. Im 19. Jahrhundert, als Nation im Sinne einer Sprach- und Kulturgemeinschaft verstanden wurde, hat man ein romantisch-idealisiertes Bauerntum als Hüter der Identität betrachtet.
Die Verbindung von Baukunst und Sprache hat eine lange Geschichte, mit Höhepunkten wie dem Konzept der „architecture parlante“ in der französischen Revolutionszeit. Architektur war für Semper ein System von Symbolen wie die Sprache, und keine darstellende Kunst:
„So wie die Sprachwurzeln ihre Geltung immer behaupten und bei allen späteren Umgestaltungen und Erweiterungen der Begriffe, die sich an sie knüpfen, der Grundform nach wieder hervortreten, wie es unmöglich ist, für einen neuen Begriff zugleich ein ganz neues Wort zu erfinden, ohne den ersten Zweck zu verfehlen, nämlich verstanden zu werden, eben so wenig darf man diese ältesten Typen und Wurzeln der Kunstsymbolik für andere verwerfen und unberücksichtigt lassen“.8
In seiner Studie „Wissenschaft, Industrie und Kunst“ schrieb Semper, daß selbst wenn die neuen technischen Erfindungen die alten Formen der Kunst zerstören würden, etwas Neues und Gutes entstehen kann, weil Kunst, als Sprache, soziale Verhältnisse nicht nur reflektiert, sondern ihre eigene Existenz hat.9 Hier wird Sprache als Monument verstanden, dessen aktuelle Erscheinung untrennbar von den Urformen ist, die sie in der kollektiven Erinnerung verankern.
Um die Jahrhundertwende war das Denken über Ausdruck in Sprache und Kunst von neuen Entwicklungen in der psychologischen Forschung beeinflußt. Sempers Interesse für die Symbolik des Ausdrucks wich der Aufmerksamkeit für die Freude am Ausdruck. Der „Trieb nach Ausdruck“ und die „zureichende Freude an Formen, welche der Befriedigung dieses Triebes dienen“ als Grundlagen der Kunst wurden in einem Aufsatz von Hans Schmidkunz diskutiert, den er 1904 in der Zeitschrift „Der Architekt“10 veröffentlichte:
„Vorangestellt haben wir den Trieb nach Ausdruck, das Streben nach einer Aussprache; damit ist vor allem jegliche Kunst abgelehnt, welche lediglich ein Interesse an dem äußeren Um und Auf des Schönen sein würde. Dasjenige, was die sogenannte Formalästhetik als das Wesen der Kunst bezeichnet: die wohlgefälligen Verhältnisse im Gegensatze zu rein inhaltlichen Wirkungen, ist in unserer Bestimmung durch den zweiten von jenen Faktoren anerkannt. Wir suchen dabei den sogenannten Expressionalismus [sic] und den sogenannten Formalismus in einer Weise zu vereinigen, die auf dem Nebeneinanderbestehen und Zusammenwirken der beiden hier zugrunde liegenden Triebe im Menschen beruht.“11
Schmidkunz kritisierte die Unterscheidung zwischen darstellenden und freibildenden Künsten, Malerei und Architektur: „ […] wenn ich […] meine Bilder von statischen Verhältnissen in architektonischen Leistungen ausspreche, so ist es schließlich im Wesen auch nichts anderes, als wenn ich einen Menschen oder ein anderes Objekt „abbilde“. Schmidkunz tadelte Semper, da in seiner Theorie das „spezifisch Artistische“ hinter dem „spezifisch Technischen“ zurücksteht, die „biologische Kraft“ der Freude an den Formen des Ausdrucks nicht erkennend.12 Seine Interpretation der Sprache beruht nicht auf dem Verhältnis von Bedeutung und symbolischer Form, sondern auf der psychologischen Wichtigkeit des gestenhaften Ausdrucks. Sprache wird nicht als Informationsträger verstanden, sie drückt Machtansprüche oder Widerstand bildhaft aus, zwingt den Sprecher in gewisse Sehweisen hinein.
Die architektonischen Sprachen, die zwischen 1900 und 1914 im Gebiet der Donaumonarchie verwendet wurden, können wie die gesprochenen Sprachen ihren Funktionen entsprechend kategorisiert werden. Trotz der Probleme einer klaren Abgrenzung der einzelnen Gruppen wird im folgenden versucht, die „Oberflächenäußerungen“ als Ausdruck gesellschaftlicher Funktionen zu lesen.
Sprachen der Kontinuität
In den Städten Mitteleuropas war Historismus die infrastrukturelle Sprache der Urbanisierung, eine Art „Amtssprache“, die Kommunikation ermöglichte und homogenisierend wirkte. Der Historismus war die Sprache der Kontinuität; Sempers zitierte Bemerkung hatte hier unbegrenzte Gültigkeit. Der homogenisierende Effekt des Historismus schloß eine Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten nicht aus. Es sind grundsätzlich zwei architektonische Positionen in der Beziehung zur Vergangenheit zu unterscheiden. Die eine betrachtet die historischen Stile wie Gotik, Renaissance oder Barock als voneinander unabhängige Systeme mit ihren eigenen Stilgesetzen, denen der Architekt folgen muß; die andere mißt den Erfolg des künstlerischen Schaffens am Grad der schöpferischen Transformierung traditioneller Formen. Im ersten Fall waren bei der Stilwahl Faktoren wie die politischen Konnotationen der einzelnen Stile oder Assoziationen mit der Funktion die bestimmenden Faktoren. Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde die Normativität des homogenen Stils aufgegeben zugunsten einer freien, heterogenen Formensprache, die geeignet war, die individuelle Phantasie des Baukünstlers zu demonstrieren. Es war vor allem die Budapester Architektur um 1900, wo überraschende, malerische Wirkungen, die Betonung von Farben- und Oberflächenwerten, die Häufung von epischen Details aus allen historischen Perioden und geographischen Regionen beliebt waren.
Die zahlreichen Veröffentlichungen architektonischer „Träume“, „Phantasien“, „Skizzen“ in dieser Periode zeigt das große Interesse für die scheinbar flotte, unverbindliche Architekturzeichnung. Auch in Otto Wagners Ideal des Architekten als „Krone des modernen Menschen in seiner glücklichen Vereinigung von Idealismus und Realismus“13 spielte die „göttliche Flamme“ der Phantasie eine dominante Rolle - was auch seinen Architekturunterricht fördern sollte. Die Entwürfe der Studenten waren in der Zeitschrift „Der Architekt“ sowie in den Heften „Aus der Wagnerschule“ veröffentlicht. Ungarische Architekten wie Gyula Kosztolányi Kann haben historisierende Motive mit Elementen des „Nationalstils“ von Ödön Lechner gemischt.14 Die Architekturskizze wurde zum impressionistischen Medium architektonischer Stimmungen.
In der gebauten Architektur war es der Stil des Neobarocks, der am besten geeignet war, absolutistische Pathosformeln mit dem neuen, kommerziellen Geist der Städte zu vereinen. Das Wiener Architekturbüro Fellner und Helmer hat 48 Theaterbauten in vielen europäischen Städten in diesem Stil entworfen, gut funktionierende Grundrißtypen den lokalen Gegebenheiten anpassend - trotz Protest lokaler Architekturbüros, die darin den Ausdruck Wiener Dominanz sahen. Friedrich Ohmann war der virtuoseste Architekt, der die lokalen Varianten des Barocks in Prag und Wien „jugendstilisieren“ und für neue Aufgaben verwenden konnte, etwa als Palmenhaus der Wiener Burg oder als die architektonische Einfassung des Wienflußes im Wiener Stadtpark (mit Josef Hackhofer, 1903-06). Otto Wagners für den kaiserlichen Hof bestimmte Arbeiten (z.B. Hofpavillon in Wien-Hietzing, 1899) sind dieser Formensprache sehr verwandt, wo applizierte symbolische Elemente die Rolle des Semperschen „Festapparatus“ erfüllen. Die Fluidität der Grenze zwischen Neobarock und Jugendstil erlaubte, daß die Festdekoration der Masken, Kränze und Hermesstäbe die Rolle einer biomorphen Gestaltung übernimmt. Dieser imperiale Jugendstil war durch ornamentale Vorlagemappen wie „Das Detail in der modernen Architektur“ in ganz Mitteleuropa verbreitet.15 Architekten wie Aladár Kármán und Gyula Ullmann in Budapest, Jan Kotera in Prag, Josip Vancas in Sarajevo und Ljubljana haben alle zu dessen Popularität beigetragen. Diese Architektur war sowohl von der floralen Art Nouveau in Frankreich und Belgien als auch von dem Secessionsstil von Olbrich oder Hoffmann verschieden. Der wesentliche Unterschied ist das Verhältnis zur Geschichte: Art Nouveau und Secession verstanden sich nicht mehr als „Amtssprachen“ des Habsburgerreiches, sondern als von dem Zentrum historischer Macht unabhängige Ausdrucksmöglichkeiten einer symbolischen Befreiung. Dabei wurde ein Aspekt der Funktion als eine verbindende, urbane, nicht-regionale Sprache erhalten.
Sprachen der Örtlichkeit
Als im Kriegsjahr 1915 Otto Wagner auf Einladung des Verbandes Ungarischer Architekten Budapest besuchte, hat er die zunehmende Uniformität der Erscheinungsformen des städtischen Lebens als Grundlage einer modernen Architektur betont.16 Dies war keine neue Idee des vierundsiebzigjährigen Meisters: seit seiner Inauguraladresse an der Akademie der bildenden Künste im Jahre 1894 hat er ständig an dieser Argumentation gearbeitet, und in den vier Ausgaben seiner „Modernen Architektur“ revidiert, erweitert und verfeinert. In Budapest wendete er sich gegen Bemühungen um einen Nationalstil: „ […] wir müssen jegliche Bestrebung zur Schaffung eines Nationalstils als falsch, sogar unmöglich beurteilen.“17 Die Metaphorik seiner Argumentation war vom Krieg inspiriert: „In der Zeit der Millionenarmeen, Dreadnoughts, Mörser von 16 km Schußweite, sind sich die Welt und damit selbstverständlich die Künste darin einig, daß die richtige Zweckerfüllung die Hauptbedingung der Kunst ist, daß eine glatte aber zielsichere Kanone schöner ist als eine verzierte ohne diese Eigenschaft.“18 Die glatte Kanone war ein beliebtes Beispiel Wagners; er wollte damit bereits den Kronprinzen Franz Ferdinand zur Aufgabe seiner konservativen Ansichten in Sachen Kunst bewegen19, und verwendete dann dieselbe Metapher in der Einleitung zur vierten Ausgabe seines Buches „Die Baukunst unserer Zeit“ 1914.20 Wagner selbst war von seinen Zeitgenossen als „Heeresführer“, „Kondottiere“ der modernen Architektur gewürdigt worden.21
In Budapest haben Wagners Argumente ihr Ziel nicht verfehlt. Wie kann man von einem österreichischen Architekten Verständnis für nationale Bestrebungen erwarten, fragte der Architekt Robert K. Kertész, wenn Österreich als politisches Gebilde keine nationale Identität hat?22 Wagners Beobachtung der Intensivierung internationaler Kontakte, der homogenisierenden Tendenzen im modernen Leben ist nur die eine Seite der Wirklichkeit, schrieb der Architekt Jenö Lechner in der Zeitschrift des Verbandes.23 Diese Einflüsse werden immer lokal rezipiert, interpretiert, „gefiltert“. Wagner könnte laut Lechner nur recht haben, wenn eine stärkere Nation ihr „Genie“ auf eine schwächere oktroyiere.
Die Dialekte der Regionen waren von modernen Architekten als atavistische, ornamentale, sogar wilde Sprachen betrachtet, und entweder als der Ausdruck des Anderen abgelehnt oder als Symbol der wiedererkannten Identität angenommen worden. Im zweiten Fall waren städtische Entfremdung und Nostalgie nach dem verlorenen Paradies eines idealisierten Dorflebens wesentliche Erfahrungen. Die Identifizierung mit dem Bauern, dem früheren Inbegriff sozialer Rückständigkeit, fehlender Zivilisation, bedeutete jetzt Widerstand gegen den Machtausdruck der „glatten Kanonen“. Beabsichtigt war nicht eine Art Renaissance des Dorfes, das selbst von seinen Bewunderern als eine zum Sterben verurteilte Lebensform betrachtet wurde, sondern ein Neuschaffen auf der Grundlage ethnographischer Studien.
In Ungarn gehen die Versuche zur Schaffung eines nationalen Stils bis 1790 zurück, als Johann Nepomuk Schnauff eine „ungarische Nationalsäulenordnung“ vorschlug.24 Die Zeit der Veröffentlichung markiert den Anfang des sogenannten Reformzeitalters, der Periode der Suche nach der nationalen Identität. Herders Wort, die ungarische Sprache werde aussterben und die Nation selbst von ihren stärkeren Nachbarn absorbiert, hat jene Intelligenz zutiefst beunruhigt, die dann eine führende Rolle in der nationalen Erneuerung spielte.
„Auch Ornament ist eine Sprache; es ist die Sprache einer bestimmten Äußerung des nationalen Charakters und des Geschmacks, die ihre eigenen Worte hat“, - schrieb 1898 József Huszka,25 der bereits um 1880 begonnen hatte, die Muster des ungarischen „Heimgewerbes“ zu sammeln und zu veröffentlichen, sie mit der Ornamentik orientalischer Völker vergleichend. Es war seine Zielsetzung, eine neue Architektur ins Leben zu rufen, die in ihrer internen Organisation, „ihrem Wesen nach modern europäisch bleibt“, aber daß das neue Fassadenkleid auf den Boulevards von Budapest die langweilige Fassadenvariationen des Historismus ablösen möge.26 Die ungarische Ornamentik wurde als eine verdrängte Sprache betrachtet. Der Künstler der Gödöllöer Künstlerkolonie, Aladár Körösföi Kriesch, betonte es in seinem Aufsatz, daß der „cifraszür“, der reich gestickte Hirtenmantel, den Huszka als „die zehn Gebote des ungarischen Geschmacks“ pries, früher von den Behörden verboten wurde, da sich viele das begehrte und teure Kleidungsstück durch Raub beschafft haben. Der Weg zum Ornament führte also durch Verbrechen; aber im Unterschied zu Loos, hat dies für Körösföi Kriesch zur Ästhetik des Widerstands einer authentischen Volkskultur beigetragen.
Ödön Lechners Kunstgewerbemuseum in Budapest (1891-96) folgt im wesentlichen dem Programm Huszkas. Es war eine der ersten Institutionen auf dem Kontinent, die mit der Koppelung von Ausstellung und praktischem Unterricht die alltägliche Objektkultur fördern wollte. Im Unterschied zu den vergleichbaren Kunstgewerbemuseen der Zeit, die sich in ihrer Architektur von anderen Museumsgebäuden kaum unterschieden, hat Lechner hier eine grenzenlose ornamentale Phantasie mobilisiert, mit in der „hohen“ europäischen Architektur bisher nie verwendeten Formen, Materialien und Farben.
Die jüngere Generation der ungarischen Architekten hat um 1910 Lechners Vorschläge als zu oberflächlich kritisiert. Architekten wie Károly Kós haben es abgelehnt, durch das Studium von Formen den architektonischen Ausdruck erneuern zu wollen. Kós, die führende Figur der ungarischen Nationalromantik, hat betont, daß man als Architekt das Leben des Volkes leben muß: Deshalb will er „seine Träume träumen, so denken, so empfinden können und sich so erinnern, wie dieses Volk. Denn das Gefühl, der Gedanke und die Erinnerung sind in seiner Tätigkeit enthalten […], wenn es Kirchen, Häuser oder Scheunen baut.“27
Im Budapest-Wien-Dialog war das Bauernhaus keine „Erfindung“ der ungarischen Nationalromantik. Joseph August Lux, der etwas später eine Ingenieurästhetik (1910) und die erste Otto Wagner-Monographie (1914) veröffentlichte, hat in seinem Aufsatz von 1902, „Altwiener Häuser und Höfe“ den „heimlichen Zauber“ der einfachen Formen der „ländlichen Vororte“ Wiens heraufbeschworen, „wo das drangvolle Leben zur Ruhe und ruralen Einfachheit abflaut“, und „leise, seltsame Glücksgefühle“ auslösen kann.28 Das Bauernhaus als „organisches Gebilde“ ist das „Volkslied der Architektur“, seine Form ist „älter als der Kunstbegriff“. Die Stillosigkeit des Bauernhauses ist „der einzige und wahre Stil, den die Natur selber diktierte. Darum sehen die Häuser so lebendig aus, wie aus der Erde gewachsen, mit der Scholle und dem Charakter der Landschaft organisch verbunden […]“29 Obwohl Lux in diesem Aufsatz die Physiognomie des Hauses als Beweis der Zugehörigkeit zu einem Volk erwähnt, haben Wiener Architekten aus dem Kreis Wagners schon früher diese Qualitäten in der anonymen Architektur des mediterranen Raumes beobachtet und betont. Hoffmann, Olbrich, Loos, Frank, Prutscher haben das Bauernhaus verschieden interpretiert: Für Hoffmann war es seine freie, phantasievolle Erscheinung; für Olbrich seine malerische, plastische Form; für Loos seine natürliche, unkünstlerische Qualität (wohl auch die von Lux beschriebene Physiognomik); für Frank wohl die Überbleibsel „hoher“ Stil-Rudimente, die am Bauernhaus vor allem wichtig waren. Keiner dieser Architekten betrachtete das Bauernhaus als „reine Quelle“ einer nationalen Formensprache, vielmehr als eine bereits hybride Form, die zur Bereicherung des eigenen Schaffens geeignet war. Hoffmanns spielerische Verwendung mährischer Motive in seinem Landhaus Primavesi in Winkelsdorf (1914) sollte für Architekten wie Károly Kós oder den Slowaken Dusan Jurkovic als unzulässig und frivol erscheinen.
Kós hat die Ergebnisse seiner transsylvanischen Studienreisen unter dem Einfluß des englischen Arts and Crafts-Movement und der skandinavischen, vor allem finnischen Nationalromantik interpretiert.
Transkulturelle Sprachen
Die mit glänzenden keramischen Platten verkleideten Fassaden Lechners und seiner Nachfolger wirkten ungewöhnlich in Budapest. Sie erschienen als individueller Ausdruck und waren nicht als eigene Sprache erkannt, schrieb Lechners früherer Mitarbeiter Marcell Komor 1898: „Es erfordert grossen Muth und eine zähe Thatkraft, um der Richtung, der […] die Architekten bisher folgten, entgegen zu arbeiten.“30 Die Absicht, „die Theilnahme weiter Kreise des Volkes in einem ungewöhnlichen Maasse zu erregen“, war natürlich kein ungarisches Phänomen. Der Historismus, über den Lechner als eine bedrückende städtische Umgebung sprach, war von Wiener und Prager Künstlern ähnlich kritisiert worden. Mit dem Jugendstilornament wurde überall die utopische Hoffnung verbunden, daß die Panzerungen der Zivilisation unter dem organischen Druck der Natur weichen. Die Abspaltung der Krusten historistisch profilierter Fassadenteile von dem ornamentierten Baukörper war eines der Themen von Olbrichs Secessionsgebäude in Wien. Wie Otto Kapfinger und Adolf Krischanitz in ihrer Monographie gezeigt haben, wollte Olbrich mit dem Bau keinen statischen Würfel, sondern ein dynamisches Gebilde unter inneren Spannungen vorstellen.31 Sowohl Louis Sullivans früherer Transzendentalismus, der Ornament als Ausdruck der kreativen Kraft des Keims betrachtete,32 als auch Frank Lloyd Wrights „destruction of the box“ zeigen, daß es hier um ein gemeinsames Projekt der Befreiung geht. Ornament als verdrängte Natur wurde als Projektion allgemein menschlichen Verlangens verstanden.
Die Sprache der Secession war deshalb eine Ablehnung sowohl der überregionalen, aber „of?ziellen“, zivilisatorischen Sprache des Historismus als auch der lokalisierenden Tendenzen des Nationalstils. Sie war ein Versuch, die Formensprache von Bindungen beider Art zu befreien. Fabianis barockhaft üppige Fassadentextur des Hauses „Zum roten Igel“ in Wien oder Plecniks reich ornamentierte frühe Entwürfe zum „Haus Zacherl“ zeigen, wie wichtig diese Vorstufe der Ablösung der Ornamentik von der Tektonik für die „tabula rasa“ der glatten Fassaden war.
Die Fassadenteppiche der Secession verschwanden um 1902. Ihre Stelle wurde von glatten, glänzenden, industriell wirkenden Oberflächen eingenommen. Dieser schnelle Wechsel ist nicht überraschend, wenn man die angedeutete Leichtigkeit und „Entfernbarkeit“ bedenkt. Wenn man jedoch die großen Hoffnungen bezüglich des Ornaments in Erwägung zieht, wirkt die kurze Lebensspanne doch überraschend. Eine mögliche Erklärung ist, daß Ornamentik nach wie vor als verdrängte Natur verstanden wurde, man jedoch den Preis erkannt hatte, der für die volle ästhetische Sättigung des Lebens bezahlt werden sollte, wo künstlerischer Selbstausdruck der Subjektivität des Bewohners keinen Platz ließ.
Die Quelle der neuen, objektiven Ästhetik war nicht die organische Natur, sondern das moderne Leben selbst, seine wachsende Uniformität, seine klaren Hierarchien, seine leicht überblickbaren primären Ordnungen. Wagners moderne Großstadt mit ihrem endlosen Straßenraster schien geeignet, die wohltuende Uniformität zu fördern, und Änderungen in den untergeordneten Einheiten, Fassaden, Details zu ermöglichen. „Time is money“ als Losung der modernen Zeit wurde von Otto Wagner zitiert, und Adolf Loos war noch stärker beeinflußt vom amerikanischen Pragmatismus. „Mir scheint es, als ob die Aufgabe, welche O.W. der modernen Baukunst stellt, in praktischem Sinne in Amerika bereits gelöst sei“ - schrieb bereits 1897 Karl Henrici.33
Die Rolle des Ornaments, des am klarsten historischen, stilgebundenen Elements der Architektur, wurde einerseits von einem physiognomischen Ausdruck übernommen, der autonom, geschichtlich „unbelastet“ erschien, aber desto einprägsamer und einmaliger ist, andererseits durch die erhöhte ikonologische Präsenz von Materialien. An Fassaden wie der der „American Bar“ in Wien (1908) kommt das Superzeichen der amerikanischen Fahne und der Reichtum von Farben, Fakturen, schimmernden und glitzernden Materialien so stark zur Geltung, daß es fast ironisch klingt von Ornamentlosigkeit zu sprechen. Verdrängte Ornamentik kehrt als Musterung, Stürme und Nebel der Marmor- und Onyxoberflächen zurück. Im Innenraum, unter dem gespiegelten, endlosen Raster der Decke ist die Bar als einzelne Zelle des Konglomerats der Großstadt deutlich markiert. Sie ist nicht, wie das Wiener Café, der Raum der Zerstreuung, der leicht fließenden Zeit, sondern die Zelle konzentrierter Unterhaltung, wo die ganze Umgebung bis zu den Nähten der Lederpolster die Wahrheit von „time is money“ demonstriert.
Die bekannten, in ihrer Emotionalität überraschenden Aufsätze von Loos über „Ornament und Verbrechen“ waren Äußerungen einer narzißtischen Persönlichkeit, die ihre Komplexe und Vorurteile mobilisiert, um den tätowierten Anderen in sich selbst zu verdrängen. Die kriminalisierte ornamentale Phantasie kehrt in Loos’ Architektur als Marmorverkleidung und Raumplan wieder; die größten Energien gewann seine Sprache aus der Sublimierung verdrängter ornamentaler Triebe. Die physiognomische Fassadenmaske, das natürliche Ornament der Fassade, und vor allem das Mobilisieren der räumlichen Phantasie im Interieur retten Loos’ Architektur vor dem Schicksal, Vorbild der produktivistischen Architektur der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts zu werden. „Wir wiederholen uns ununterbrochen“, schrieb er, seine Bauten sind jedoch unreproduzierbar, mit der Aura des Individuellen, Ort- und Zeitgebundenen.
Obwohl die Kategorien der „Sprache der Örtlichkeit“ und der „transkulturellen Sprache“ als diametral entgegengesetzt erscheinen, gab es auch Versuche zu Synthesen, wie in der Architektur des ungarischen Wagnerschülers István Medgyaszay. Die Wagnerschule (wo 1902 sein erstaunlicher Warenhausentwurf entstand), später das Studium transsylvanischer Volksarchitektur und letztlich sein Aufenthalt im Atelier von François Hennebique, des französischen Pioniers der Stahlbetonarchitektur, waren wesentliche Quellen seiner Formensprache vor dem Ersten Weltkrieg. Medgyaszays Ziel war die „künstlerische Lösung des Eisenbetonbaues“, wie er es 1908, in seinem Vortrag auf dem 8. Internationalen Architekten-Kongreß in Wien erklärte. Für Medgyaszay war „der nationale Charakter selbst […] kein Zweck, er ergibt sich aber von selbst aus der Aufrichtigkeit des Schaffens“. Aufrichtigkeit wird hier als eine Art Einfühlung in die „speziellen Festigkeitszustände“ des Stahlbetons verstanden, um sie „künstlerisch zu charakterisieren“. Folklore mit ihrem unvermittelten Verhältnis zum Material konnte ihm mit wichtigen Hinweisen dienen.
Mythische Sprachen
Der Antihistorismus des 19. Jahrhunderts hat auch Tendenzen inspiriert, die weniger an kommunikativen Aspekten der Sprache interessiert waren als an ihrer strengen Struktur, ihrer Tektonik. Als Vergleich bietet sich hier Latein, eine Sprache, die in Mitteleuropa noch im 18. Jahrhundert die Funktion einer transkulturalen Sprache der Kommunikation, Regierung, Legislation hatte. Später ging es auf Gebiete der katholischen Religion und bestimmter Wissenschaften zurück, und erhielt zunehmend eine nur für Eingeweihte bestimmte kommunikative Bedeutung. Trotzdem gab es Proteste, als etwa Latein als Sprache der Liturgie von Nationalsprachen abgelöst wurde, da die mythische Funktion der Sprache als wesentlich erkannt wurde.
Die Vertreter von esoterischen ästhetischen Strömungen wie die Anhänger der „Beuroner Kunstschule“ haben die mimetische Kunst- und Architekturauffassung des 19. Jahrhunderts abgelehnt. Ihr Vorschlag war das hieratische Kunstwerk, eine nicht-anthropomorphische Kunst der abstrakten Proportionen, der zeitlosen Architektonik. Joze Plecniks „architectura perennis“ entsprach dieser Idee. Der slowenische Schüler Otto Wagners, der in Kontakt mit Künstlern der Beuroner Malermönche stand, hat in seinem Werk die Sempersche Stiltheorie revidiert. Für Semper war es die Symbolik der Architektursprache, durch die die typologischen Gebilde fähig sind, immer aktuelle Inhalte, Funktionen auszudrücken. Wagner oder Loos haben dabei die Aktualität, den Bedürfnis-Aspekt betont, und die Geschichtlichkeit der Typologie als weniger wichtig betrachtet. Für Plecnik war es umgekehrt: Seine hieratische Architektur betrachtete die Archäologie der Formen als eine hermetische Wissenschaft, die eine direkte Verbindung mit der Alltagswelt der „necessitas“ nicht braucht. Deshalb war Plecniks Architektur kein Neoklassizismus im Sinne einer Sprache der Kontinuität. Klassizismus war als eine Variante des Historismus zu intellektuell, abgetrennt von der Kultur der Hände. Joze Plecniks „architectura perennis“ war ein universales Projekt, das in der Suche nach einer konservativen geistigen Umorientierung sowohl Historismus als auch Secession oder Moderne abgelehnt hat.
Die manchmal bizarre Verzerrung historischer Formen unterscheidet Plecniks Experimentieren von Loos’ Bewertung der Formensprache der Antike als eine Konstante, die zivilisatorische und didaktische Werte verkörpert. Klassische Reminiszenzen waren stark auch in ungarischen Projekten von Béla Lajta, Móric Pogány oder Béla Málnai vertreten. Bezeichnenderweise gingen auch die Bestrebungen dieser Architekten parallel mit der Bereinigung der Fassade von historisierender oder Art Nouveau-Ornamentik und mit der Wahrnehmung der sozialen Rolle des Architekten. Lajta, Pogány, Málnai nahmen an dem großen sozialen Wohn- und Schulbauprogramm von Budapest zwischen 1909 und 1913 teil.
Gestensprachen
Obwohl Plecniks Umbauten in der Prager Burg und die Werke des Prager Architekturkubismus klare Unterschiede zeigen und oft als gegensätzlich interpretiert werden, ist das Motiv der Verzerrung, der Prüfung von Formen nach ihrer Belastbarkeit vergleichbar. Die Fassaden erscheinen nicht geformt, sondern durch eine natürliche Kraft wie Erdbeben oder Blitz verformt. Das Problem, wie räumliche Gestenhaftigkeit mit den Gestaltungsmöglichkeiten eines begrenzten architektonischen Objekts zu vereinen ist, scheint alle Architekten des Architekturkubismus beschäftigt zu haben. Ihre Architekturskizzen konzentrieren sich oft auf ein Fassadendetail als Faltwerk, das leichter fortzusetzen als zu begrenzen ist. Die traditionelle Tektonik verschwindet, tragende und lastende Funktionen sind nicht mehr zu unterscheiden, die Decke greift tief ein in den Bereich der Wände wie in der spätgotischen und barocken Architektur. Möbelstücke oder Bauten erscheinen als Origami-Objekte. Auch in den Innenraumentwürfen von Janák wird der Unterschied zwischen Wandfläche und Decke, horizontalen und vertikalen Ebenen aufgelöst. Architekten wie Pavel Janák wollten die Welt der Objekte nicht zerteilen, wie die Maler des Kubismus, sondern als ein endloses Faltwerk begreifen: „Während das waagerechte und senkrechte Zweiflächensystem eine Form der Ruhe und des Gleichgewichts darstellen, mußten den schräg gebildeten Formen dramatische Ereignisse und ein kompliziertes Zusammenwirken mehrerer Kräfte vorausgehen.“34 Die menschlichen Aktivitäten, die Verwendung von Werkzeugen, die der physischen Bewältigung der Masse dienen, die geschichtlichen Prozesse resultieren nach Janák in schrägen Flächen. Die tafelförmige, glatte „Einfältigkeit“ der Fassaden der Wiener Architekten als das physische Emblem der „tabula rasa“, der reinen, unbeschriebenen Tafel des Neubeginns, war für die Kubisten kein haltbarer Zustand. Die kubistische Fassade sollte ein Ebenbild der ständigen Oszillation des Universums sein.
Die Fassadenhaut des Mietshauses in der Neklanova-Straße von Josef Chochol ist ein kontinuierliches Faltwerk von Energien - die Elemente der Architektur wie Pfeiler, Brüstung, Gesimse, Sockel sind nicht als solche identifizierbar. Ornament, laut Loos verschwendete Energie, erhielt nach der kubistischen Erneuerung der Fassade wieder Bedeutung - nicht als Bild der organischen Natur, sondern strömend durch Zeit und Raum.
Der Versuch, die Topographie der Architekturentwicklung aus den Äußerungen der Fassaden zu umreißen, soll nicht mehr als eine Möglichkeit der versuchsweisen Neuordnung komplexer Entwicklungen sein. Die Betrachtung der Ausdrucksweisen österreichischer Architektur als Teil der Pluralität der Formensprachen der Donaumonarchie ist dabei wesentlich, da die Funktion jeder einzelnen der Sprachen nur aus ihrem Verhältnis zu den anderen verständlich war. Die Situation hat sich nach 1918 allerdings deutlich geändert. Die neuen Staatsgrenzen in Mitteleuropa resultierten in einer stürmischen Reorganisierung von Ländern, Gebieten, Infrastrukturen und Bevölkerungen. Die Folge war, daß Ansprüche zum symbolischen Ausdruck dieser territorialen Neuverteilung in den meisten Nachfolgestaaten der Donaumonarchie zu einer Zeit erhoben wurden, als im Westen der moderne Mythos einer logisch vollkommenen, ortlosen Sprache die Legitimität solcher Interpretationsmöglichkeiten der Umwelt geradezu verneinte.
newroom, So., 1995.10.01