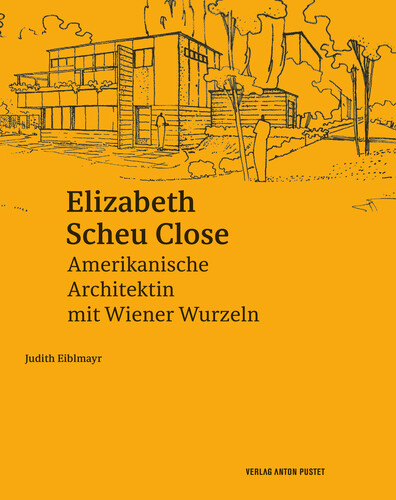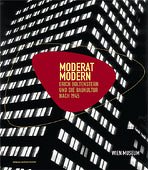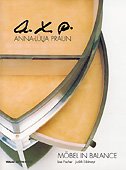Der amerikanische Traum vom Leben in den Vororten ist zerstört
Der American Dream hat sich in vielen Bereichen zum Albtraum entwickelt. Nach der Suburbanisierung in den USA ist Wohnbau nun wieder ein Thema – da die menschenleeren Stadtzentren zu verslumen drohen.
Der American Dream hat sich in vielen Bereichen zum Albtraum entwickelt. Nach der Suburbanisierung in den USA ist Wohnbau nun wieder ein Thema – da die menschenleeren Stadtzentren zu verslumen drohen.
Die USA sind in eine gesellschaftliche Krise geraten, die teilweise als aussichtslos zu bezeichnen ist. Ohne auf die politischen Ungeheuerlichkeiten einzugehen, von welchen seit 21. Jänner 2025 täglich berichtet wird, ist evident, dass die Zerstörung gewachsener Strukturen in den USA vorangetrieben wird. Sei es im Staatsapparat, wo Beamte willkürlich entlassen werden, sei es in Nationalparks, wo nach Rohstoffen gebohrt werden soll. Es mag verwundern, mit welcher Vehemenz das Oval Office gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, doch war die US-amerikanische Geschichte immer wieder von Maßnahmen geprägt, die sich gegen das Gemeinwohl wandten, um kapitalistische Einzelinteressen durchzusetzen.
Ein Beispiel ist die Suburbanisierung der Städte, die von England ausgehend im 19. Jahrhundert in den USA mit Errichtung der Eisenbahn vorangetrieben wurde. Investoren beim Eisenbahnbau kauften rechtzeitig Grundstücke entlang der neuen Schienenstränge an und verwerteten diese, sobald die Zugverbindung zu den Vororten bestand.
Passendes Lebensmodell abseits der Großstadt
Bereits ab 1850 wurden von Developern standardisierte Häuser verkauft: mit Spekulationsgewinn und dem Werbeversprechen eines individuellen Lebensentwurfs. Individualisierung in der Architektur wurde durch ebenfalls standardisierte Dekorelemente an der Fassade erreicht. Systemimmanent war der Suburbia-Bewegung seit 1800, dass das Leben in der Stadt und das Aufwachsen von Kindern in einer Wohnung geächtet wurden und damit den Frauen das Leben im Häuschen abseits der Großstadt als passendes Lebensmodell empfohlen wurde.
In den 1920er-Jahren wurde erneut verstärkt in die Suburbs investiert, obwohl immer weniger US-Bürger sich ein eigenes Haus leisten konnten. Jenen, die bereit waren, sich in einen Kredit zu stürzen, versprach man unverblümt, dass in der Subdivision kein Haus an People of Color verkauft werden würde – rassistische Segregation gehörte zum Geschäft.
Die Gartenstadt setzte sich nicht durch
Zu dieser Zeit gab es allerdings auch eine vom englischen Garden Cities Movement geprägte, parallele Bewegung, die zur Stadterweiterung Gartenstädte mit eigenen Ortszentren propagierte. Um die Kosten für die Hauskäufer zu senken, wurde die Bauweise der Holzhäuser vereinfacht und die Vorfertigung entwickelt. Dass Gartenstadtidee und sozialer Wohnbau, wie er in den 1930er-Jahren durchaus staatlich verfolgt wurde, sich nicht durchsetzen konnten, war einer mächtigen Gegenlobby geschuldet: Banken, Immobilien- und Baubranche fürchteten, dass ihnen durch staatliche Förderungen im Wohnbau der lukrative Eigenheimmarkt wegbrechen könnte.
1937 lieferte der Architekturkritiker Lewis Mumford (1895–1990) einen negativen Befund zum umgreifenden Suburbanisierungsgedanken in den USA und beschwor den sozialen Kern als essenzielles Element jeder wertigen Stadtplanung. Aber genau das Gegenteil wollte das offizielle Amerika, wo selbst Reihenhäuser als Wegbereiter des Sozialismus politisch verunglimpft wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Stadtplanung kein Thema, ganz im Gegenteil: Begleiteffekt der Suburbanisierung war das innerstädtische Demolieren ganzer Stadtteile, das euphemistisch als urban renewal bezeichnet wurde. Es war ein mutwilliges Zerstören gewachsener baulicher und sozialer Strukturen, um Stadtzentren von Wohnbauten frei zu machen und eine Spielwiese für Investoren zu schaffen. Die waren zufrieden, da ihnen mit öffentlichen Mitteln Brachland zur Verwertung hergestellt wurde.
Sozial benachteiligte Gruppen vertrieben
Die Bevölkerung wurde aus den Stadtzentren regelrecht vertrieben: Sozial benachteiligte Gruppen wie große Teile der afroamerikanischen Bevölkerung, die in ihren Wohnvierteln enge Communitys aufgebaut hatten, wurden in neu errichtete Wohnblocks in anderen Stadtteilen umgesiedelt; eine Maßnahme, die schwerwiegende soziale Probleme nach sich zog: „Urban renewal means Negro removal“, formulierte das der amerikanische Schriftsteller James Baldwin im Jahr 1963.
Mit dem Federal Housing Act 1949 wurde für den weißen Mittelstand das Prinzip der Suburbs verordnet, indem man eine staatliche Förderung von Darlehen zum Erwerb eines Hauses in der Subdivision einführte. Politisch gesteuert, wurde der Immobilienwirtschaft sowie der Auto- und Fertigteilhausindustrie der Markt gesichert. Developer schickten sich an, das Land hierfür aufzubereiten. „In den USA ist Immobilienspekulation ein Teil von allem, und sie ist unglaublich mächtig“, schildert die Historikerin Gail Radford in einem Interview. „Jeder Kongressbezirk hat seine Maklerverbände, Bauträger, die in Gruppen organisiert sind, auch auf nationaler Ebene, und Fabrikanten, die an Immobilien beteiligt sind. Das ist stark mit der Politik verwoben und dadurch kaum zu umgehen.“
Weit und breit keine Bahnlinie
Günstige Wohnungen in der Stadt waren abgeschafft worden, und die ideologische Belehrung wie vor 150 Jahren, es wäre unverantwortlich, Kinder in der Stadt großzuziehen, durfte auch nicht fehlen. Gut ausgebildete Frauen, die die Tätigkeiten der im Krieg verpflichteten Männer übernommen hatten, mussten die Arbeitsplätze den männlichen Heimkehrern überlassen. Kindererziehung und Haushaltsführung an den Stadträndern wurden für sie zum staatlich verordneten Lebensmodell. 20 Millionen Frauen, die eben noch einer Berufstätigkeit nachgegangen waren, bekamen einen Entlassungsbrief mit der Empfehlung, sich einen Ernährer zu suchen.
Und so zog die weiße Mittelschicht wohl oder übel ins vorgefertigte Häuschen in der neu errichteten Suburb, wo weit und breit keine Bahnlinie und auch kein Geschäft mehr zu finden war. Begleiteffekt war, dass sie mit einer Hypothek belastet in eine lebenslange wirtschaftliche Verpflichtung gebracht wurden, um die Rückzahlung der Darlehen leisten zu können. Mit zusätzlich aufgenommenen Krediten wurden ein Auto und ein Fernseher angeschafft, über deren Schirme flächendeckend die Botschaft propagiert wurde: „This is the American Dream!“ Was sollte daran falsch sein? Logischerweise folgte 1956 der Federal Highway Act, der die Errichtung des Autobahnnetzes für die gesamten USA beschloss. Bei gleichzeitiger Stilllegung des Schienennetzes bedeutete dies eine weitere systematische Zerstörung funktionierender Infrastruktur und einen massiven Eingriff ins Gemeinwesen der USA: Nicht jeder konnte sich ein Auto leisten.
Seit den 1950er-Jahren wurde die Suburbanisierung konsequent weiterverfolgt; erst seit zehn Jahren ist Wohnbau wieder ein Thema, da die menschenleeren Stadtzentren zu verslumen drohen. Die Häuser in den Suburbs haben sich zu teils formal grotesken „MacMansions“ ausgewachsen, bei denen Garage und Dachgiebel zum architektonisch bestimmenden Element wurden. Ein manieristisches Lebensmodell, das sich die junge Generation kaum mehr leisten kann und dadurch an seine Grenzen stößt. Der American Dream hat sich in vielen Bereichen zum Albtraum entwickelt. Weitere Gewaltakte, wie man sie zurzeit in den USA beobachten kann, werden wohl kein Gegenmittel sein.
Spectrum, Mi., 2025.03.12