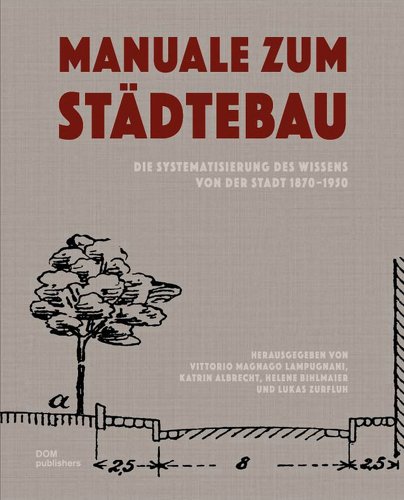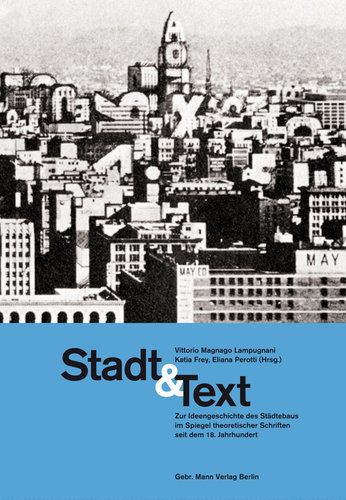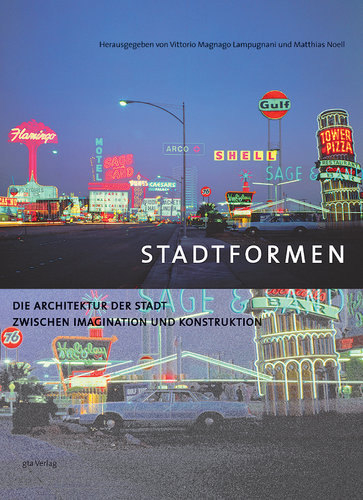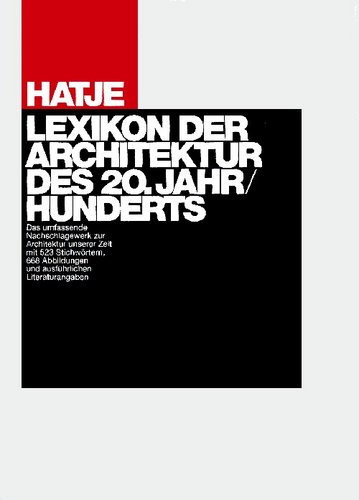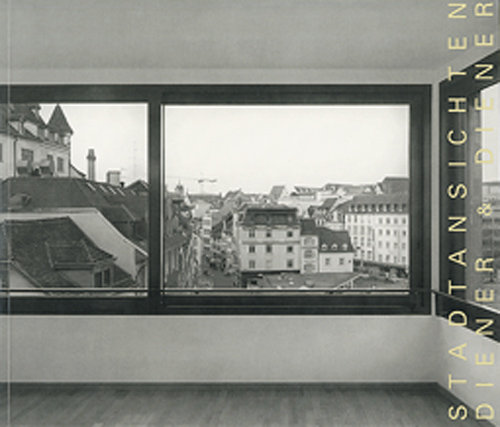Das architektonische Projekt der Moderne ist alles andere als ein klar eingegrenztes Phänomen. Selbst seine plakativste Ausprägung, die Neue Sachlichkeit, ist nicht nur historisch einmalig und ästhetisch exzeptionell, sondern auch inhaltlich widersprüchlich. Will man prüfen, was davon auch im nächsten Jahrhundert trägt, muss man differenziert die Themen betrachten, die der Architektur der Moderne gemeinsam sind.
Das architektonische Projekt der Moderne ist alles andere als ein klar eingegrenztes Phänomen. Selbst seine plakativste Ausprägung, die Neue Sachlichkeit, ist nicht nur historisch einmalig und ästhetisch exzeptionell, sondern auch inhaltlich widersprüchlich. Will man prüfen, was davon auch im nächsten Jahrhundert trägt, muss man differenziert die Themen betrachten, die der Architektur der Moderne gemeinsam sind.
Die Architektur der Moderne hat mit der Chimäre des neuen Menschen zu tun, wie er sich in den Büchern von Friedrich Nietzsche präfiguriert findet und als Traum und Verheissung, als Aufgabe und Ziel in der Kultur des frühen 20. Jahrhunderts immer wieder beschworen wird. Sie hat mit der neuen Gesellschaft zu tun und mit der Herausforderung, eine bisher unvorstellbare Anzahl von Menschen in ebenso unvorstellbar rasch wachsenden Ballungsräumen unterzubringen und zu versorgen. Sie hat mit der sozialen Ideologie zu tun und mit dem Anspruch, die Städte, die Dörfer und die Landstriche unter ihren Bewohnern möglichst gerecht zu verteilen und allen menschenwürdige Bedingungen anzubieten. Sie hat mit der Industrialisierung zu tun und mit zunehmend rationalisierten, standardisierten und technisierten Produktionsverfahren, die eingesetzt werden, um Güter massenweise und mit geringeren Kosten und grösserer Qualität herzustellen. Sie hat mit der Technisierung und dem Fortschritt zu tun, die neuartige Konstruktionen ermöglichen, die ebenso neuartige Leistungen erfüllen, aber auch mit der telematischen Revolution, die völlig neue Bedingungen für Informationstransfer, Kommunikation und damit auch für das menschliche Zusammenleben schafft. Sie hat mit der politischen und technischen Problematik von Naturschutz und Ökologie zu tun, also der Notwendigkeit, mit den Ressourcen der Erde sparsam und sinnvoll umzugehen. Sie hat schliesslich mit dem kulturellen Phänomen der allenthalben eingreifenden Vereinfachung zu tun, die von den neuen gesellschaftlichen und technischen Bedürfnissen nahegelegt und zugleich von der fortschrittlichen Kultur zu einem künstlerischen und sogar ethischen Prinzip erhoben wird.
Themen des 20. Jahrhunderts
Die Architektur der Moderne hat sich also sämtlichen grossen Themen des 20. Jahrhunderts gestellt und versucht, sie zu verarbeiten. Welche dieser Themen sind für das neue Jahrhundert, ja für das neue Jahrtausend von Bedeutung? Auf welche muss sich die Architektur, will sie weiterhin modern, also zu ihrer Zeit gehörig sein, einlassen, und wie? Auf einen Nenner gebracht: Was bleibt übrig vom architektonischen Projekt der Moderne? Die Moderne, ein gescheiterter Versuch? Nicht wenig scheint zunächst Grund dafür zu bieten, das Experiment als gescheitert zu beurteilen und unverzüglich abzubrechen. Der Traum des neuen Menschen ist im systematischen Völkermord zum Albtraum mutiert. Die Massengesellschaft hat allenthalben zur Zerstörung des Territoriums und der Kultur beigetragen, indem sie beides trivialisiert hat. Die soziale Ideologie ist als Vorwand für vermeintlich sozialistische Regimes missbraucht worden. Die Industrialisierung hat nicht nur das Handwerk grösstenteils zerstört, sondern auch weite Teile der Landschaft und vielerorts das Bewusstsein für Qualität. Die Technik hat den Dienst am Menschen aufgegeben und ist zu jenem für den Profit übergegangen, wobei sie die grössten Katastrophen des Jahrtausends mittelbar oder unmittelbar verschuldet hat. Die Ökologie ist vielerorts zu einem hohlen Schlagwort verkommen, zu einem modischen Etikett, mit dem man ein verwöhntes und leicht ermüdetes Publikum zu neuem Konsum alter, lediglich anders aufgemachter und vermarkteter Produkte reizt. Das künstlerische Prinzip der Einfachheit lebt bestenfalls als Stil und schlimmstenfalls als affirmatives Zugeständnis an kommerzielle Anforderungen fort.
Demselben leidlich kritischen Blick, der solcherlei wahrnimmt, kann allerdings nicht verborgen bleiben, dass sämtlichen grossen Phänomenen der Moderne neben negativen Seiten auch produktive und positive eignen. Sie haben dazu beigetragen, dem Jahrhundert, das gerade zur Neige geht, seinen Glanz zu verleihen, und können auch dem Beginn des neuen Jahrtausends Hoffnung einflössen. Die Massengesellschaft etwa ist mitnichten nur ein milliardenköpfiges Ungeheuer, das nur darauf wartet, jegliche ausserordentliche künstlerische Leistung genüsslich und lautlos zu verschlingen; sie ist vor allem eine potentielle Öffentlichkeit, die sowohl sinnvolle Politik als auch gute Architektur zu tragen vermag. Sie kann die Basis für jenen differenzierten Konsens darstellen, den die eine wie die andere braucht, um zu einem Instrument der Selbstbestimmung und der Selbsterkenntnis zu werden. Im übrigen geht es in Europa schon seit Jahrzehnten nicht mehr darum, Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, um jeden Preis eine Wohnung zu geben, und noch weniger ist es das Gebot der Zeit, die Städte zu erweitern oder gar neu aufzubauen; es sei denn, wir zerstören sie mutwillig, wie es gerade mit Sarajewo und Belgrad geschehen ist. Umverteilung, Ausgleich, Stabilisierung und Eingrenzung stehen in den abendländischen Städten an. Diese Aufgaben verlangen nicht nach der grossen Kelle, sondern nach feiner, einfühlsamer, konzeptionell abgestützter Arbeit.
Die soziale Ideologie, die heute in der euphorischen Neuentdeckung des sogenannt freien Marktes, der leichtsinnigen Privatisierungseuphorie und des bedrohlichen Deregulierungswahns gern als passé erklärt wird, ist nicht nur das Lieblingsschlagwort skrupelloser Regimes, sondern unverändert Grundprinzip für eine stabile und würdige Welt: eine Welt, in der die Menschen friedlich, gleichberechtigt und möglichst glücklich zusammenleben können. Daraus kann und muss Architektur ihre Inspiration, ja ihre Substanz schöpfen. Vor allem im städtischen Kontext muss das Prinzip der Gleichheit oder zumindest jenes der Analogie vorrangig herrschen: Wo keine substantiellen Unterschiede existieren, sollen sie auch nicht vorgegaukelt werden. Im Hausbau sprach sich Heinrich Tessenow bereits 1916 für die Uniform in der gewerblichen Arbeit und der Architektur aus. Etwa ein Jahrzehnt später ging Hans Schmidt noch einen Schritt weiter und forderte sich und seine Kollegen auf, sich unendlich zu wiederholen: Ein Gebäude solle wie das andere aussehen. Nicht der Wunsch nach Rationalisierung, sondern jener nach sozialer Gleichheit und (scheinbar paradoxerweise) individueller Freiheit stand vorrangig hinter diesem Postulat. Um der Radikalität willen geriet es schematisch; in seiner Quintessenz wies es jedoch den Weg aus einer Personifizierungs- und Verniedlichungshysterie, die bis heute anhält.
Die Industrialisierung ist ebensowenig ein kultur- und lebenfressendes Ungeheuer wie die Massengesellschaft. Seit geraumer Zeit schon sind die grossen Unternehmen Orte, wo nicht nur Waren und Profit, sondern auch Kultur produziert wird. Für die Architektur können also Konzerne nicht nur Auftraggeber, sondern auch Verbündete sein. Speziell im Bauprozess ist Industrialisierung mittlerweile eine selbstverständliche Bedingung, aber nicht immer und überall. Als Mittel, billiger und besser zu produzieren, kann und muss sie bei Bauelementen eingesetzt werden, die sich wiederholen: Stützen und Trägern, Fenstern und Türen, Heizkörpern und Lampen. Das geschieht übrigens ansatzweise seit der römischen Antike, im grossen Massstab seit dem 19. Jahrhundert. Was erst seit wenigen Jahrzehnten stattfindet, ist die massive Überflutung des Baumarkts mit schlechten Industrieprodukten: überdimensionierten Tragelementen mit daumendicken Toleranzen, die nach der grobschlächtig erfolgten Montage mit der bewährten Silikonspritze zugeschmiert werden; plump proportionierten Kunststoffenstern; aufdringlichen Heizkörpern, Lichtschaltern und Sockelleisten, von mehr oder weniger namhaften Designern eiligst im Flugzeug skizziert und von cleveren Herstellern billigst produziert. Solcherlei Barbarei ist allerdings nicht schicksalhaft mit industrieller Produktion verknüpft. Diese hat im Gegenteil einen Standard erreicht, der sie in die Lage versetzt, eine Vielzahl guter Produkte zu schaffen.
Eng damit zusammen hängt die Entwicklung der Technik. Ein Grossteil der Moderne des 20. Jahrhunderts verband mit ihr die kühnsten Hoffnungen auf Selbstbefreiung des Menschen und leicht verfügbares Glück. Diese Hoffnungen können wir heute angesichts der unzähligen Katastrophen, die eine nachlässig und falsch eingesetzte Technik zu verantworten hat, nicht mehr teilen. Und doch wäre es voreilig, sich deswegen dem technischen Fortschritt tout court zu verschliessen. Die Fenster von heute leisten mehr als die Fenster von gestern; wenn sie hässlicher sind, liegt es nicht an ihrem technischen Standard, sondern an der Unfähigkeit, diesem Standard eine ansprechende Form zu geben. Das Haus von heute ist nicht zuletzt dank zahlreichen Apparaten komfortabler als das von gestern; wenn wir über die Faszination ihrer vermeintlichen «Intelligenz» die ureigensten Qualitäten von Architektur wie Raum und Oberfläche, Öffnung und Wand vernachlässigen, wenn wir das Haus mit Gadgets auch dort überfrachten, wo sie unnötig und gar hinderlich sind, heisst es nur, dass wir noch nicht gelernt haben, mit eben diesen Apparaten sinnvoll umzugehen. Sinnvoll werden wir aber erst dann mit ihnen umgehen, wenn wir sie so einsetzen, dass sie nicht nur uns, sondern auch unsere Häuser entlasten und zu diskreten, grösstenteils unsichtbaren Helfern werden.
Das Prinzip Nachhaltigkeit
Weitaus gründlicher noch als die Hoffnung auf einen glückbringenden technischen Fortschritt ist jene zerschmettert, über unendliche materielle Ressourcen zu verfügen. Ein Teil der traditionalistisch orientierten Moderne ahnte bereits, dass Landschaft, Natur und Rohstoffe kostbar seien und geschont werden müssten. Ihre Skrupel wurden jedoch sofort von der Fortschrittsgläubigkeit beiseite gefegt. Mit dieser Leichtfertigkeit ist es endgültig vorbei. Wenn wir die Erde, auf der (und von der) wir leben, möglichst sinnvoll unter uns verteilen wollen, ohne ihren Reichtum zu verschleudern und ihre Unterschiede einzuebnen, muss die zur Verfügung stehende Technik so eingesetzt werden, dass sie das bedrohte ökologische Gleichgewicht nicht noch mehr erschüttert. Und wir müssen unsere Wünsche und Bedürfnisse darauf einstellen, möglichst wenig zu verbrauchen und nur das wirklich Notwendige zu produzieren - auch in der Architektur. Zu den wichtigsten Ressourcen, über die wir verfügen, gehört die Landschaft. Wir können nicht immer mehr neues Bauland an den Rändern unserer Städte ausweisen, um mit locker gestreuten Einfamilienhäusern einer Natur nachzuziehen, die wir damit unwiederbringlich zerstören, und Peripherien zu erzeugen, die weder urban noch ländlich sind. Wir müssen zusammenrücken. Wir müssen die Städte, die wir bereits haben, erhalten, arrondieren und verdichten; was sie, wenn wir intelligent verdichten, nur urbaner und kraftvoller macht.
Auch auf dem Land sollte gezielt, konzentriert und nur bei wirklichem Bedarf gebaut, renoviert, umgenutzt und revitalisiert werden. Wenn renoviert, wenn neu gebaut werden muss, sollte das Ergebnis dauerhaft sein. Von jeher ist Architektur mit ihrem Anspruch, feste, schützende und identifikationsstiftende Orte zu schaffen, das menschliche Instrument der Nachhaltigkeit schlechthin. Eine Baukunst, die ihre ökologische Verpflichtung ernst nimmt, muss eine langfristige Investition darstellen. Es ist eine untragbare Verschwendung, Gebäude zu bauen und gleich wieder abzureissen. Und eine Baukunst, die ihre gesellschaftliche Verpflichtung ernst nimmt, muss jenseits der modischen Geste, jenseits der spektakulären Allüre auch ästhetisch halten und damit zu einem Ort werden können, in dem Menschen sich heimisch fühlen. Hinzu kommt die Verpflichtung, den zukünftigen Generationen etwas zu hinterlassen. Wir leben in Städten und Landschaften, die in Jahrtausenden kultiviert und gebaut wurden, wir benutzen sie, erfreuen uns an ihnen, besichtigen sie und geniessen sie gar wie Kunstwerke: Wir profitieren von der Arbeit und dem Erfindungsgeist von Menschen, die vor uns gelebt haben. Wir müssen gleichermassen etwas weitergeben, das Bestand hat und weiterverwendet werden kann. Durchaus auch etwas, was den Nachkommen das Leben verschönern möge.
Das Instrument, das die kulturelle Nachhaltigkeit von Architektur sicherstellt, ist ihre eigene Geschichte. Als Gedächtnis der Disziplin gewährleistet sie auch jenseits der sinnlichen Erfahrung die Dauerhaftigkeit der Bilder im kollektiven Gedächtnis. Der Mythos der Moderne als ahistorisches Phänomen ist von der Postmoderne forciert worden, die auf diese Weise die eigene Daseinsberechtigung behauptet hat: als Kompensation eines Defizits. Zwar duldete Walter Gropius keine Baugeschichtslehre in seinem Curriculum an der Graduate School of Design in Harvard, weil er befürchtete, die schönen Beispiele aus der Vergangenheit würden die Studenten in ihrer Verpflichtung zur Gegenwart korrumpieren. Aber Le Corbusiers beredtes Manifest der baulichen Moderne, «Vers une architecture», schöpft aus den Lehren der Vergangenheit mindestens genauso wie aus jenen der Maschinenästhetik.
Die Forderung nach Nachhaltigkeit im Bauen steht in krassem Widerspruch zum leichtfertigen Refrain der Futuristen, jede Generation solle sich ihr Haus und ihre Stadt bauen. In der Tat müssen wir von der modernistischen Chimäre der tabula rasa genauso Abschied nehmen wie von dem Trugbild des Bruchs mit der Vergangenheit. Die historische Stadt und die historische Landschaft existieren in Europa: Es kann nicht darum gehen, sie mutwillig zu zerstören, sondern nur darum, sich an ihnen zu messen. Das gilt auch für die Stadt des 19. Jahrhunderts, die nicht länger als Feindbild und Hintergrundsfolie für die reinen Kristalle eines Bruno Taut oder eines Ludwig Mies van der Rohe herhalten muss, sondern ganz im Gegenteil zu einem Modell gerät, verbesserungsfähig zwar, aber auch höchst instruktiv.
Die Forderung nach Nachhaltigkeit im Bauen steht auch im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Mechanismen, die gegenwärtig unsere Welt regieren. Heute wird in der Regel nicht gebaut, wenn man über das entsprechende Geld verfügt, sondern sobald man Zugriff zu einem Kredit hat. Daraus ergibt sich immer häufiger ein Termindruck, der keine sorgfältige Planung erlaubt, und ein Kostendruck, der keine solide Ausführung zulässt. Die Gebäude werden möglichst schnell, billig und spektakulär hochgezogen und müssen, wenn sie steuerlich abgeschrieben sind, sofort Platz machen, damit das Grundstück noch gewinnbringender verwertet werden kann. All dies hat jedoch nicht mit der Moderne etwas zu tun, sondern mit der Bauspekulation im Hochkapitalismus. Die Architektur kann sich der Bauspekulation zwar nicht versagen, kann aber sehr wohl Prozessen Widerstand leisten, die im Gegensatz stehen zu der Vorstellung einer Welt, die wir erhalten und pflegen müssen.
Für all dies bietet sich die Ästhetik der Einfachheit geradezu an. Sie entspricht der Massengesellschaft, weil sie gewissermassen als kleinster gemeinsamer Nenner die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen miteinander verbindet. Sie entspricht der sozialistischen Ideologie, denn die Reduktion auf die Essenz spielt auf Gleichstellung und Gleichbehandlung an. Sie entspricht der Industrialisierung, weil Reduziertes leichter normierbar, standardisierbar und in grossen Serien herstellbar ist. Sie entspricht dem ökologischen Anspruch, weil in der Einfachheit jegliche Verschwendung aufgehoben und die Dauerhaftigkeit durch die Klassizität gewährleistet ist.
1909 schrieb Paul Klee in seinem Tagebuch: «Wenn bei meinen Sachen manchmal ein primitiver Eindruck entsteht, so erklärt sich diese ‹Primitivität› aus meiner Disziplin, auf wenige Stufen zu reduzieren. Sie ist nur Sparsamkeit, also letzte professionelle Erkenntnis. Also das Gegenteil von wirklicher Primitivität.» Auch in der Architektur ist die bewusst konstruierte Einfachheit nicht das Ergebnis von Nachlässigkeit oder Trägheit, sondern poetisches Verfahren. Und Mittel, die architektonische zu einer wirksamen, weil allgemein verständlichen Sprache zu machen.
Ein «Klassiker» und ein neuer Mensch
Bleibt noch von den eingangs aufgelisteten Grundthemen des 20. Jahrhunderts jenes des neuen Menschen. Es ist deutlich geworden: Nicht um eine enthusiastische Fortschreibung des Projekts der Moderne geht es und auch nicht um dessen krude Ablehnung. Das Projekt der Moderne ist ein Klassiker, wie auch das Attribut in der landläufigen Bezeichnung «klassische Moderne» verkündet. Als solcher kann und muss es immer wieder neu gedeutet werden, wobei das Überzeitliche vom Zeitbedingten abgelöst und für die Zukunft produktiv gemacht zu werden braucht.
Subjekt und zugleich Objekt dieser Neudeutung ist aber die schemenhafte, zuweilen bedrohliche, durchaus aber auch hoffnungsfrohe Gestalt des neuen Menschen. Er scheint aus einer anderen, weit zurückliegenden Zeit zu kommen und ist dabei vermutlich ein Pionier einer neuen Generation, die gegen die Belanglosigkeit, in welche die unendliche Wahlfreiheit des (späten) 20. Jahrhunderts geführt hat, in freiwilliger Selbstbeschränkung auftritt. Deren Vertreter schliessen sich nicht allen erreichbaren medialen Kanälen an und auch nicht jeder modischen Ideologie. Im Gegenteil: Sie verhalten sich eigensinnig und denken unabhängig und differenziert.
Zugleich reduzieren sie bewusst die Komplexität ihres Lebens, verringern ihre Wahlmöglichkeiten, versuchen die eigenen Ich-Aussagen und persönliche Freiheiten neu in Konventionen zu giessen. Wie schrecklich, wird jetzt mancher ausrufen: Es sind Konservative. Vielleicht sind es Konservative. Vielleicht aber sind sie in einer Welt, in der der Individualismus zur gesellschaftlichen Konvention geraten ist, die eigentlichen Individualisten und Nonkonformisten. Und damit auch die eigentlichen Neuerer, auf die das neue Jahrtausend seine Hoffnungen bauen muss - nicht nur für die Architektur.
Neue Zürcher Zeitung, Fr., 1999.12.03
![]()