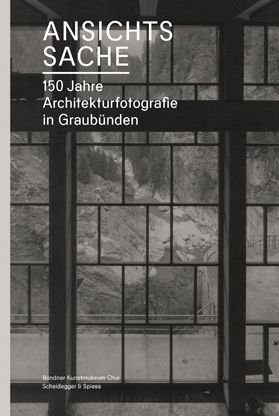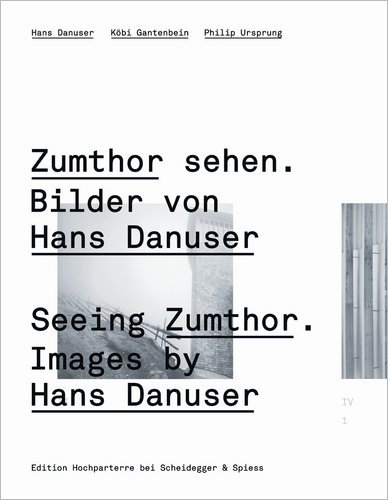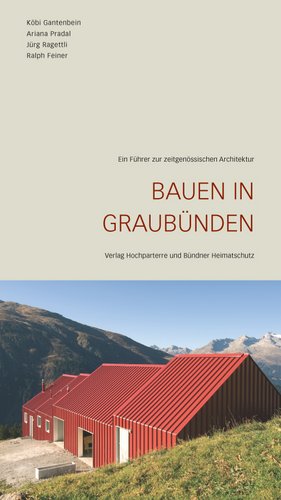Der Sonne verschrieben
Wer durch die Kataloge, Mitteilungen und Stellungnahmen des Solarpreises Schweiz blättert, stellt fest: Die Magie der Zahl prägt diesen Preis. Die ihn...
Wer durch die Kataloge, Mitteilungen und Stellungnahmen des Solarpreises Schweiz blättert, stellt fest: Die Magie der Zahl prägt diesen Preis. Die ihn...
Wer durch die Kataloge, Mitteilungen und Stellungnahmen des Solarpreises Schweiz blättert, stellt fest: Die Magie der Zahl prägt diesen Preis. Die ihn tragende Solaragentur Schweiz und ihr Chef, der Umweltpolitiker Gallus Cadonau, erhoben ihn zur Baukultur. Unerbittlich werden Volt und Watt, Kilowattstunden und CO 2-Ausstoss aufgereiht. Das schafft Verbindlichkeit, starke Argumente vor Gericht und Seriosität in der Debatte. Doch Zahlen vernebeln auch, denn das Leben und das Bauen sind bunter, als Ziffern versprechen. Fiel in den ersten Jahren das Auge des Solarpreis auf die am und ums Haus installierte Leistung, kamen bald Kennzahlen dazu, die angeben, ob und wie ein Haus abgedichtet ist. Doch während die technischen Zahlen — als Trumpfkarten freudvoll ausgespielt — komplexer werden, ist der Aufwand zurückhaltend, der betrieben wird, um die Sonnenenergie ins Haus zu bringen.
Der Solarpreis sollte beherzt auch mit kaufmännischen Zahlen fechten. Erst wenn die Immobilienfirmen wissen, was Bau und Betrieb kosten und ihre Renditen mit der Sonnen Energie kalkulieren können, werden auch Siedlungen neben den schmucken Plus-Energie-Einfamilienhäusern stehen. Doch die Kosten der dicken Dächer und der komplexen Fassaden, die keine Wärme mehr hinein- und hinauslassen, können auch kritisch befragt werden: Wenn es stimmt, dass es viel mehr Sonnenenergie in der Schweiz gibt, als wir brauchen — und erst noch gratis —, wäre es dann nicht angebracht, sie künftig zu verwenden und Sonnenfangmaschinen und Erdspeicher zu bauen anstatt teure Dächer und komplexe Fassaden?
Die Integration des Bauteils
Metron-Gebäude in Brugg (Metron Architekten), Bundesamt für Statistik in Neuenburg (Bauart), Forum Chriesbach in Dübendorf (Bob Gysin & Partner), Mövenpick Marché in Kempthal (Beat Kämpfen), Eulachhof Winterthur (Dietrich Schwarz) — schauen wir in das Archiv der zeitgenössischen Schweizer Architektur, so finden wir einige, die ambitioniere Architektur mit Energievernunft verbinden und damit auf der Bühne des Solarpreises gestanden sind. Dazu kommen architektonisch aparte Sanierungen wie die Magnusstrasse in Zürich (Viridén & Partner), das Haus Burri in Uetikon am See (Beat Kämpfen) oder ein Jugendstilhaus in Arlesheim (Daniel Wyss).
Doch der zweite wichtige Beitrag des Solarpreises zu Baukultur und Architektur ist nicht die Auflistung , sondern der Kampf um den Ort der Sonnen-Installationen. Von Anfang an setzten Cadonau und seine Leute sich für die «Integration» der Paneele in Haus und Fassade ein. Für Windanlagen, die nun als Kleinkraftwerke die Landschaften zu bedrohen beginnen, hat sich der Preis nicht stark gemacht, als Förderer frei stehender Sonnenmaschinen wurde er nicht laut — gut so. Als Organisator einer langjährigen baukulturellen Debatte versammelte Cadonau über Jahre Denkmalpfleger, Heimatschützer, Baubehörden, Energiefachleute und -beamte, sodass schliesslich 2005 die Publikation «Integration Solaranlagen» sieben Richtlinien vorschlug, wie Sonnenanlagen in bestehende Gebäude eingefügt und wie neue Sonnenhäuser gebaut werden sollen. Zusammengefasst: Dem Solarhaus soll man seine Technik nicht ansehen. Keine Experimente und formale Erfindungen, kaum Spielraum für entwerferischen Furor. Folgerichtig — und das ist die architekturpolitisch wichtige Tat — ist es den Förderern gelungen, im Raumplanungsgesetz den Artikel 18a einfügen zu lassen, der bis auf wenige Ausnahmen eine «sorgfältig» ins Haus integrierte Solaranlage zu einem Recht macht. Baubeamte und Denkmalpfleger — skeptisch wegen der Häufung matt glänzender Flächen — sitzen seither am kurzen Hebel. Auch ein altes Haus muss unter Umständen seine Würde hergeben, wenn es gilt, die Energiewende herbeizubauen. Der baukünstlerischen Entfaltung setzt die «sorgfältige Integration» einen engen Spielraum. Das ist gut, wenn wir an all die von Designdruck Geplagten denken. Das ist schlecht, wenn wir an die denken, die Baukunst machen und mit neuer Technik neue Erfindung und Form wollen. Und das ist gut, wenn wir dran denken, dass die Energiewende vor allem mit Sanierungen, nicht allein mit Neubauten gewonnen werden wird.
Der politische Raum
Für ihre Ziele ziehen Cadonau und die Seinen seit zwanzig Jahren alle Register der Politik von lustvoller Polemik in Leserbriefspalten, Rechtshändeln bis vor Bundesgericht, Volksabstimmungen, Präsenz in und vor Parlamenten und klugen Essays in Broschüren. Zum politischen Raum gehören auch geschickte Koalitionen mit der wachsenden Sonnenbranche — Hans Ruedi Schweizer von Schweizer Metallbau in Hedingen ist Pionier und als Unternehmer von Anfang an Solarpreis-Mitträger. Zur Politik gehört der Prominentenboulevard.
Schon für die erste Aufführung des Preises lotste man Bundesrat Adolf Ogi nach Brienz-Brinzouls in den Kanton Graubünden und mit ihm Parlamentarier aller Couleur, Spitzenfunktionäre der Gewerkschaften und Arbeitgeber, allen versichernd, sie täten etwas Gutes, wo doch die Energiepolitik anfangs der Neunzigerjahre vollkommen blockiert war. Seither ist jede Preisverleihung ein grosser Bahnhof mit Bundesrat. Und um auch in der Szene der Architekten an Aufmerksamkeit zu gewinnen, patroniert neu Lord Foster mit seinem Namen den Preis für die Kategorie der Häuser, die mehr Energie herstellen, als sie brauchen. Der Lord ist eine Galionsfigur und ein Könner des energievernünftigen Bauens im grossen Massstab. Doch auch herausragende Architekten predigen Wasser und trinken Wein. Zur Preisfeier wird er wohl mit seinem Privatjet herbeidüsen und wir werden ihn fragen, wie es möglich sei, mit einem Schloss am Genfersee und gut gedämmten Behausungen im Engadin und anderswo auf eine Wohnfläche zu kommen, die mit der persönlichen Nachhaltigkeit verträglich ist? Sagen wir vierzig Quadratmeter pro Person?
Und nun?
Gallus Cadonau fasst den Wandel des Solarpreises in einem Brief an mich so zusammen: «Zuerst, 1991, haben wir jene Familie ausgezeichnet, die am meisten Sonnenkollektoren pro Kopf vorweisen konnte. Daraufhin meinte Jurymitglied Pierre Fornallaz, dass diese Familie mit besseren Fenstern und nur halb so vielen Kollektoren auf dem Dach energetisch besser fahren würde. Und so rückte je länger je mehr zu den erneuerbaren Energien die Energieeffizienz in den Fokus.» Stetig und vif hat der Preis auf Wandel reagiert, neulich als er die Plus-Energie-Bauten als Richtschnur des Bauens aufs Podest hob. Mit 100 000 Franken ist das eine der bestdotierten Auszeichnungen in der Architekturszene.
Blättern wir die Solarpreis-Kataloge durch, fällt ein weiterer Wandel auf. Die ersten Ausgaben feiern Gemeinden und Gemeinschaften, die sich der Sonne verschreiben und städtebauliche Ambitionen haben. In den Neuzigerjahren wird der weite Blick präziser — und also enger. Blieb die politische Perspektive immer bezogen auf die grosse Bühnen der Energiepolitik, definierte der Preis seine Kategorien nun näher am Haus und dem Sonnengerät. Das «Solarpreis-Gericht» setzte Gartenzaun und Grundstück als Grenze fest. Einen Widerspenstigen, der vor dem «Schweizer Solarpreisgericht» Beschwerde gegen ein ausgezeichnetes Zweifamilienhaus führte, weil ein solches die Zersiedelung und damit Energieverschleiss fördere und also nicht gelobt werden dürfe, stellte Jurist Cadonau nach allen Regeln der Juristenkunst samt Verweis auf RPG, ZGB und Bundesverfassung in den Senkel. Diese Ge schichte möge anregen, den Blickwinkel zu öffnen. Denn es gilt auch in städtebaulichen Erwägungen zu gewichten, welchen Beitrag eine haustechnische Musterleistung zu einer guten Siedlung, Stadt, Landschaft und zu nachhaltigen Lebensweisen beiträgt. Die Solarpreis-Ausgabe 2010 lobt die Gemeinde Hessigkofen für die politische, finanzielle und kulturelle Förderung von Sonnen- und erneuerbarer Energie von der Versorgung von Wohnhäusern über Strassenleuchten bis hin zum E-BikeSharing. Und sie zeichnet die Monte Rosa-Hütte des SAC aus, zweifellos eine Verdichtung von Designwillen, technischem Können und grosser Ausstrahlung. Doch kann dieses Edelstück mehr als andere SAC Hütten seit eh und je können? Gewiss, sie gibt viel mehr Gästen viel mehr Komfort, sie bietet mehr WC, mehr Platz pro Kopf, die Schlafräume sind hier oben geheizt statt kalt und sogar warm duschen ist Realität. Doch fördern das hohe Können, der Aufwand, der nicht aus den Übernachtungserlösen wird bezahlt werden können, und exzellente technische Zahlen das richtige Leben? Oder fördert das alles nicht vorab unsere Freizeitgesellschaft, die munter und fröhlich ständig mehr Ressourcen verbraucht? «Glacier paradise», das Restaurant der Zermatt Berg b ahnen auf dem kleinen Matterhorn, 3883 Meter über Meer, erhält eine Auszeichnung. Sonnenkollektoren und integrierte Fotovoltaikanlagen liefern die gesamte Energie. Schnitt Südfassade: Die Solarzellen werden von der kalten Bergluft hinter lüftet und gekühlt. Die so erwärmte Luft wird für die Lüftung gebraucht.
hochparterre, Mi., 2010.09.01
verknüpfte Zeitschriften
hochparterre 2010-09