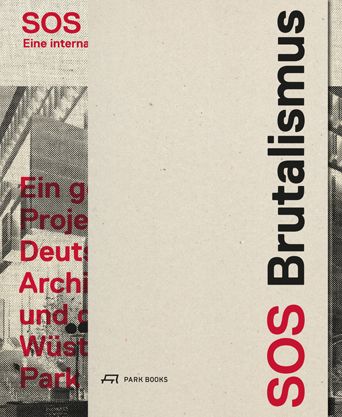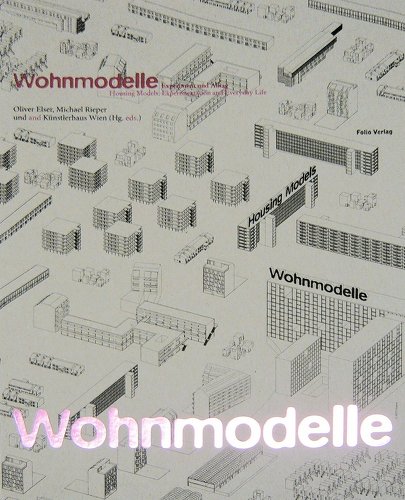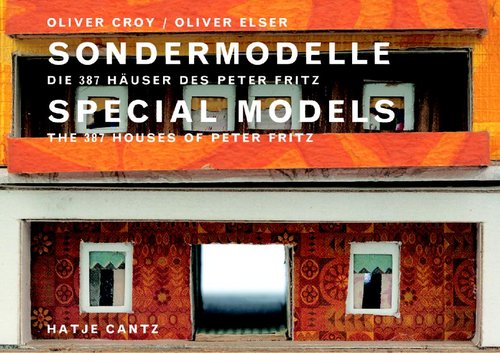»Was ist Architektur?« fragen Oliver Elser und Sebastian Hackenschmidt und finden eine Antwort im Protest
Auf einem Podest liegt ein ungewöhnlich anmutendes Objekt, zusammengezimmert aus Holz, das entfernt an einen Ausguck auf einem Schiffsmast erinnert; daneben...
Auf einem Podest liegt ein ungewöhnlich anmutendes Objekt, zusammengezimmert aus Holz, das entfernt an einen Ausguck auf einem Schiffsmast erinnert; daneben...
Auf einem Podest liegt ein ungewöhnlich anmutendes Objekt, zusammengezimmert aus Holz, das entfernt an einen Ausguck auf einem Schiffsmast erinnert; daneben hängen, in einem Gewirr von Seilen ein Paar Bretter, die, zu einem Weg verbunden, über den Köpfen schweben. Sie waren Teil einer Hängebrücke, die Baumhäuser im Hambacher Forst verband und ihre Bewohner:innen in einem analogen Kommunikationsnetzwerk miteinander in Austausch brachte. Jenes Camp, mit dem gegen die Ausweitung des Braunkohleabbaus im Rheinland protestiert wurde. Das Objekt ist die Spitze eines Monopods – ein Hochsitz auf einem einzelnen Mast, mit Seilen am Boden abgespannt; eine Verzögerungsarchitektur, die sich nicht einfach aus dem Weg räumen lässt, will man nicht riskieren, dass die oben Sitzende in die Tiefen stürzt. Es stammt aus dem Fechenheimer Wald in Frankfurt, wo Monopods – und Tripods, ihre dreibeinigen Verwandten – gegen den Ausbau der Autobahn eingesetzt wurden. Die beiden sind nur zwei der Artefakte, Bilder, Videos und Modelle von Architekturen, die die Ausstellung ›Protest / Architektur – Barrikaden, Camps, Sekundenkleber‹ versammelt, die derzeit im Museum für Angewandte Kunst in Wien zu sehen ist.
In 13 Fallstudien untersucht ein kuratorisches Team um Oliver Elser und Sebastian Hackenschmidt in einer Zusammenarbeit des DAM (Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt a. M.) mit dem Wiener MAK räumliche Artikulationsformen von Protesten. Dazu zählen aktuelle lokale Beispiele wie die Proteste von LobauBleibt gegen die Fertigstellung des Autobahnrings um Wien durch das unter Schutz stehende Augebiet, bekannte Beispiele wie die zum ›Arabischen Frühling‹ zählenden, wiederkehrenden Massenproteste am Tahrir-Platz, jene des ›Umbrella Movements‹ in Hongkong oder die Anti-AKW-Proteste der ›Republik Freies Wendland‹ in Gorleben; aber auch medial wenig behandelte Widerstandsbewegungen, wie die ›Farmer-Protests‹ gegen die Liberalisierung des Agrarwesens Indiens 2020. Ein Jahr lang wurden vor Delhi Autobahnen blockiert. Die Camps boten allen, unabhängig von Religion, Kaste, Klasse oder Geschlecht eine öffentliche Infrastruktur; oder MTST, das ›Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto‹ (Bewegung der Arbeiter:innen ohne Dach), das unter dem Titel ›Povo Sem Medo‹ (Volk ohne Angst) mit der Besetzung brachliegender Flächen in São Paolo gegen Immobilienspekulation eintritt und bezahlbaren Wohnraum fordert.
Was die Ausstellung mit diesen ausgiebig recherchierten Beispielen erzählt, ist nichts weniger als die Globalgeschichte einer Architektur, die sich nicht an einem Stil, einer Haltung oder Material ausmachen lässt, sondern im Protest Architektur in ihrer vielleicht vergänglichsten Form vorfindet: in der geplanten Zusammenkunft von Menschen, mit dem Ziel, Dinge zu ermöglichen oder sie zu verhindern und dem, was sie räumlich fasst. Ergänzt werden diese Fallstudien um eine Chronologie von Protesten zwischen 1830 und 2022, sowie um eine allgemeine Einführung. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, der die ›Protestarchitektur, Barikaden, Camps, raumgreifende Taktiken 1830–2023‹, so der Titel, mit dem Anspruch, ein Nachschlagewerk in Sachen Widerstandsarchitektur zu liefern, lexikalisch behandelt.
Nicht oft wagen sich institutionelle Ausstellungsräume in Konfliktzonen des politisierten Alltagslebens vor, und stellen dabei die eigenen Gewissheiten – und damit die Deutungshoheit, was unter Architektur zu verstehen ist – so grundsätzlich in Frage. Die Produktion von Räumen kann keinesfalls einer einzelnen Profession obliegen, so ließe sich der demokratische Gestus der Ausstellung lesen. Mehr noch: Wenn sie etwa auf einem Podest jenes Werkzeug und Material versammelt, aus denen diese Strukturen des Widerstandes geschaffen wurden, dann ließe sich das geradezu als Ermutigung lesen, selbst Hand anzulegen, sie birgt in ihrem Zugang einen durchaus ermächtigenden Charakter. Stellenweise stolpert die Ausstellung dabei allerdings über den eigenen Anspruch: Im Wunsch, die Proteste möglichst zugänglich zu machen, greift man zu einer Strategie, die sich wohl als eine Vermittlung der Einfühlung bezeichnen ließe. Neben den eingangs erwähnten Artefakten und dem am Original gehaltenen Bildmaterial sind es szenische Modelle der Protestarchitekturen, die ihre Wirklichkeiten möglichst detailgetreu wiedergeben sollen. Diese ausgeschmückte Miniaturisierung der Proteste ohne ihre Übersetzung mag zwar Stimmung vermitteln, sie droht aber, tendenziell in ihre Entpolitisierung zu führen. »Vergangenes historisch aktualisieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist«, kritisierte Walter Benjamin einst den Historiker von Ranke. Aufgabe der Geschichtsschreibung (oder hier der Kuratierung) wäre, sich Erinnerungen zu bemächtigen, Geschichte gegen den Strich zu bürsten, und eine Vielzahl von – möglicherweise widersprüchlichen – Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Beiträge, die einen Abstraktionsschritt dokumentarisch vornehmen und Proteste künstlerisch aufarbeiten, wie etwa Oliver Resslers Arbeit zur Stadtstraße, bleiben in der Zusammenstellung die Ausnahme.
Für eine Ausstellung, die sich unzweifelhaft den Protesten der Vielen widmet, bleibt ›Protest/Architektur‹ daher ungewöhnlich einstimmig, was durch eine Ausstellungsarchitektur und eine Grafik, die noch die Bildbeschreibung ins Bild setzt, bewusst in Szene gesetzt wird. Der demokratische Anspruch, verständlich zu möglichst vielen zu sprechen, findet sich damit bald in einem Dilemma wieder: Was auf der einen Seite innere Kohärenz und Niederschwelligkeit in der Vermittlung schafft, wirft auf der anderen Seite neue Fragen auf, etwa dort, wo der Sturm auf das US-Kapitol in Washington am 6. Jänner 2021 durch waffentragende rechtsextreme Milizen, deren räumliches Vorgehen Beihilfe, zumindest aber Duldung durch Sicherheitspersonal und einzelne Regierende erfahren hat, ohne weitere Kommentare als Protest – und nicht etwa als Putschversuch dargestellt wird. Dabei hält die Ausstellung ihr eigenes Ringen mit den Widersprüchen zwischen Zugänglichkeit und widersprüchlicher Vielstimmigkeit, zwischen Ästhetisierung und Dokumentation, zwischen Musealisierung und Aktivierung keinesfalls zurück und macht das durchaus kenntlich. Inwieweit sich dieses Spannungsverhältnis produktiv wenden ließe, wird sich erst im Austausch, den die Ausstellung mit dem Feld, in das sie interveniert, eingeht, weisen: kurzfristig im Begleitprogramm, im Austausch mit den Initiativen vor Ort, langfristig in den Köpfen, in denen sie Erinnerungen an früher mit den Möglichkeiten der Zukunft neu arrangiert. Auf jeden Fall sollte es mehr Ausstellungen und Formate geben, die diese Wagnisse eingehen.
Trotzdem – oder vielleicht gerade weil sich vor dem Thema des Protests so viele Fragen und Herausforderungen um das Verhältnis von Politik und ihrer künstlerischen, kulturellen oder auch architektonischen Thematisierung im Ausstellungskontext und ihrer notwendigen Vermittlung stellen, muss die Ausstellung als einer der wertvollsten Beiträge der letzten Jahre auf der Suche nach einem zeitgenössischen Architekturverständnis verstanden werden, zeigt sie doch Architektur als eine zutiefst gesellschaftliche Artikulationsform, die durchaus auch momenthaft auftreten kann. ›Architecture without architects‹ betitelte Bernard Rudofsky 1964 eine Ausstellung im MoMa, die in 200 Fotografien vernakuläre und indigene Bautraditionen zeigte und so mit dem tradierten, engen Architekturverständis der Zeit brach. ›Alles ist Architektur‹ schrieb Hans Hollein nur wenige Jahre später, begleitet von einer 30-seitigen Sammlung von Collagen und Bildern, die übrigens auch Protestformen versammelte. In einer Zeit, in der die für Hollein nichts als reaktionäre Konzeption, alle Architektur habe sich einzig am Gebauten auszurichten, wieder bedrohlich um sich greift, kann man nicht genug daran erinnern, dass eben alles Architektur werden kann. Heute reicht dafür etwa ein wenig Superkleber auf der Autobahn.
Ausstellung
Protest/Architektur. Barrikaden, Camps, Sekundenkleber
Eine Ausstellung des DAM – Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main, und des MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien
Projektleitung, Kurator DAM: Oliver Elser; Kurator MAK: Sebastian Hackenschmidt
MAK Wien, 14.02.2024–25.08.2024
Katalog
Oliver Elser, Anna-Maria Mayerhofer, Sebastian Hackenschmidt, Jennifer Dyck, Lilli Hollein, Peter Cachola Schmal (Hgg.):
Protestarchitektur. Barrikaden, Camps, raumgreifende Taktiken 1830–2023
Zürich: Park Books, 2023
528 Seiten, 19,60 EUR
dérive, Do., 2024.04.18
verknüpfte Zeitschriften
dérive 95, Sampler