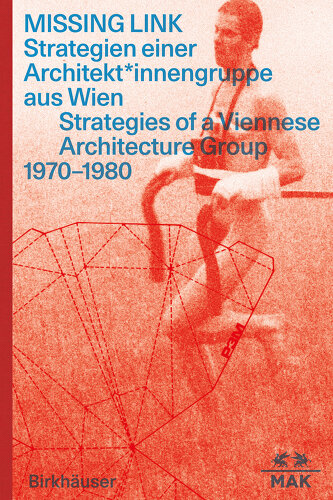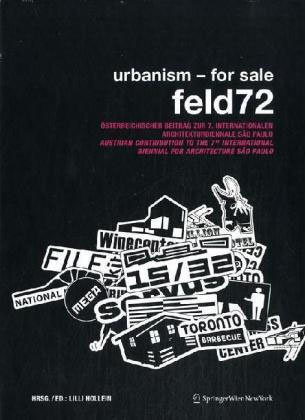Das Prinzip der Addition
Steigender Platzbedarf trifft auf schrumpfende Budgets. Besonders dort, wo der laufende Betrieb nicht unterbrochen werden kann, sind Zubauten zum Bestand oftmals die einzige Lösung. Neben der Effizienz trägt dies mitunter auch zu einem ansehnlicheren Ensemble bei.
Steigender Platzbedarf trifft auf schrumpfende Budgets. Besonders dort, wo der laufende Betrieb nicht unterbrochen werden kann, sind Zubauten zum Bestand oftmals die einzige Lösung. Neben der Effizienz trägt dies mitunter auch zu einem ansehnlicheren Ensemble bei.
Expansionslust kennt man aus den eigenen vier Wänden. Nach Jahren wird alles zu klein. Bestünde die Möglichkeit, die Wohnung nach Bedarf über die Fassade hinaus zu erweitern, würden wohl allerorten kleine Erker, ganze Zimmer, Terrassen oder Abstellflächen wie Schubladen aus dem Haus ragen. Wie einige schöne Architektur-Beispiele beweisen, hat so mancher Hausbesitzer diesen Traum in bemerkenswerter Weise wahr gemacht.
Was im privaten Bereich eine mehr oder weniger luxuriöse Option ist, ist für öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser und Schulen oft der einzig gangbare Weg, um Platz zu schaffen und das Gebäude den neuesten Anforderungen anzupassen, ohne dabei den laufenden Betrieb unterbrechen zu müssen.
Dass mediokren Gebäuden mit einem Zubau zu nie gekanntem Glanz verholfen werden kann, zeigt etwa das neue Landeskrankenhaus Knittelfeld. Das Team fasch&fuchs konnte - gemeinsam mit Projektpartner Lukas Schumacher - den Wettbewerb um die dringend anstehende Erweiterung für sich entscheiden.
2002 wurden die alten Nebengebäude abgerissen, ein Jahr später wurde bereits mit dem Zubau begonnen. Seit knapp einem Jahr sind Großküche, Speisesaal und die vier neuen Bettenstationen nun fertig gestellt. Das Resultat sind Räume, die neben ihrer Effizienz vor allem durch eine besonders geschickte Lichtführung beeindrucken.
Fassade kippt weg
Die Entwürfe von Hemma Fasch und Jakob Fuchs vereinen sichtlich Freude am Entwurf mit Pragmatik und Intelligenz. Im Falle des LKH Knittelfeld bedeutet das: Um das Grundstück optimal zu nutzen, wurde der neue Baukörper nordseitig an das bestehende Gebäude aus der Jahrhundertwende angedockt. Jakob Fuchs erklärt, warum der Neubau „so knapp zubi“ steht: „Die nahe Lage ermöglichte eine effiziente, kurze Wegführung zwischen den Bauteilen und beließ gleichzeitig ein Maximum an Parkfläche und Baumbestand“. Dem Lichtproblem, das sich durch das Nahverhältnis der beiden Bauten ergeben hatte, wurde mit einer geschickten Geste begegnet. Die Fassade des Neubaus kippt - immerhin unter einem beträchtlichen Winkel von 18 Grad - vom Bestand weg.
Fuchs streicht auch den zwischen den Baukörpern entstehenden Wirtschaftshof hervor, der als Lieferzone eine wesentliche logistische Funktion erfüllt. Die erdgeschoßige Großküche ist nicht nur selbstversorgend, sondern beliefert auch die Krankenhäuser der Nachbarstädte. Eine Herausforderung war der Abbruch und völlige Neubau des Altbau-Stiegenhaus bei vollem Betrieb - auch das war Teil des Konzeptes.
Das bereits mehrfach gekürte Werk (Nominierung Mies- van-der-Rohe-Preis 2006, Dominico Preis 2006, Geramb-Preis für gutes Bauen) mit einer Bausumme von 35 Millionen Euro (Bruttogeschoßfläche von 9000 Quadratmetern) harrt mittlerweile einer weiteren Bauphase - im nächsten Bauabschnitt stehen Sanierung und Umbau des Bestands an. Die Krankenhaus-Expertise des Büros fließt währenddessen schon ins nächste Projekt ein. Mit dem LKH Gmunden darf man auf einen weiteren Lichtblick hoffen.
Überbrückungshilfe
Eine andere Lösung - nämlich Aufbau statt Zubau - wandten die Architekten Oliver Kaufmann und Max Wanas bei der Erweiterung der HTL Braunau am Inn an. Den Auftrag brachte ein EU-weiter Wettbewerb. Auch sie hatten das Ansinnen, helle und offene Räume zu schaffen. Das eben fertig gestellte Resultat schlug mit Errichtungs- und Umbaukosten von 17,8 Millionen Euro zu Buche. Geschickt platzierten sie den zweigeschoßigen Labortrakt anstelle einer alten Werkhalle, die zehn neu geschaffenen Klassen hingegen schweben als Brückenbauwerk über den Altbau hinweg. Neue Dachterrassen und Atrien bringen Freiheit in den Schulalltag.
Ob man nun abgräbt, andockt, aufstockt oder aufständert - während des laufenden Betriebes die Flächen zu erweitern, stellt nur selten die kostengünstigste Variante dar. In vielen Fällen ist sie allerdings die einzig mögliche. Architektur-Wettbewerbe zeigen ungeahnte Möglichkeiten auf, zwischen Abriss, Neubau und Erweiterung die jeweils beste Lösung zu erwägen. Der Wermutstropfen: Immer seltener lassen die Wettbewerbsausschreibungen solch großen Ermessensspielraum frei.
Der Standard, Sa., 2006.10.07