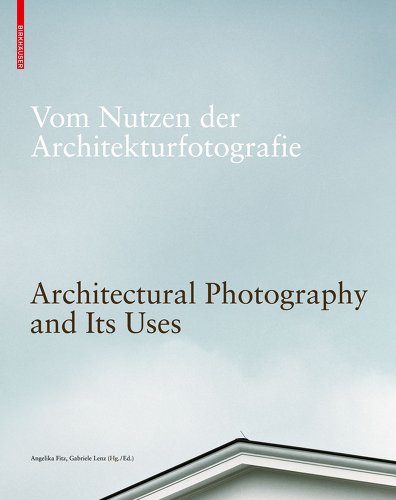Zwischen Eyecatcher-Zwang und überraschenden Blickwinkeln, Kunstform und PR, Komplizenschaft und Kritik: Das Verhältnis von Architekturfotografie und Architektur ist so untrennbar wie komplex. Eine Buchpublikation bringt jetzt Klarheit.
Die Fotografie ist heute keine einsame Profession mehr. Was sich einst mit ikonischen Einzelstücken behauptete, muss sich heute gegen die weltweite Online-Bilderflut stemmen. 2003 taten sich einige österreichische Fotografen zusammen und gründeten die Interessengemeinschaft IG Architekturfotografie. Was aus wirtschaftlicher Notwendigkeit entstand, ist gleichzeitig ein Abbild einer selbstbewussten, auf hohem Niveau operierenden Szene. In der jetzt erscheinenden Buchpublikation Vom Nutzen der Architekturfotografie wird das eigene Tun mit reichhaltigen Bildbeweisen untersucht.
Im Round-Table-Gespräch mit dem Standard erklären die Fotografen Pez Hejduk, Hertha Hurnaus und Stefan Oláh und die Buchmacherinnen Angelika Fitz und Gabriele Lenz, warum wir Architekturfotografie brauchen, in welchem Verhältnis sie zur Architektur steht und ob Menschen und Tiere nun ins Bild gehören oder nicht.
Standard: Bücher mit Architekturfotografien sind üblicherweise auf pure Ästhetik setzende Coffee-Table-Books. Auch dieses ist voller Bilder, kommt aber eher daher wie eine Handreichung. Was für eine Absicht steckt dahinter?
Fitz: Ohne Architekturfotografie gibt es keine Architekturgeschichte. Denn es geht ja um viel mehr, als nur ein Gebäude abzubilden. Die Fotografie zeigt, was mit der Architektur passiert, unter welchen Bedingungen sie entsteht. Sie ist kein passives Medium, sondern ein aktiver Beitrag zur Architekturgeschichte. Der Begriff des „Nutzens“ hält das Buch zusammen: Wie wird die abgebildete Architektur gebraucht, und wie werden die Bilder selbst genutzt. Unser Anspruch war also nicht weniger, als ein Standardwerk zur Architekturfotografie zu machen. Denn erstaunlicherweise gibt es so etwas noch nicht.
Lenz: Die Verbindung zwischen Fotografie, Architektur und Buch ist am Bauhaus entstanden, mit László Moholy-Nagy. Damals war es nicht üblich, Fotografien in Büchern zu zeigen, weil das als etwas rein Journalistisches galt. Später hat sich Le Corbusier – ein großer Selbstvermarkter – intensiv mit der Inszenierung durch Fotografie beschäftigt.
Oláh: Es war uns auch als IG Architekturfotografie wichtig, etwas Mutiges zu machen und nicht eine Werkschau, in der jeder seine fünf besten Fotos beisteuert.
Hejduk: Es sollte auch kein Best-of der Architektur sein. Dann wäre es wirklich ein Couchtisch-Buch geworden. Es geht explizit um das ungeklärte Verhältnis zwischen Fotografie und Architektur.
Hurnaus: Dadurch lassen sich wiederum die Grenzen ausloten, an denen Architektur anfängt. Deshalb ist im Buch die ganze Bandbreite von anonymer Architektur bis zu Bauten von Herzog & de Meuron enthalten.
Standard: Vor zwölf Jahren wurde die IG Architekturfotografie gegründet. Was war der Impuls dafür?
Hejduk: Es ging vor allem um Rechtsfragen – leider, denn man kann sich seine Zeit auch schöner vertreiben. Es war damals so, dass Publikationshonorare bei Verlagen zusehends abgeschafft wurden und das Internet mit seiner Gratismentalität immer stärker wurde. Es gab sehr viele Unklarheiten. Heute hat sich die Sachlage beruhigt, was gut ist, denn wir wollen ein Miteinander.
Oláh: Das Positive ist: Weil es heute niemanden mehr gibt, der auf unserem Niveau arbeitet und zugleich seine Bilder und die Rechte herschenkt, etabliert sich auch ein Bewusstsein für Qualität.
Standard: Die Aufklärungskampagne hat gewirkt. Die Architekten beneiden heute die Fotografen um ihre Durchsetzungskraft.
Fitz: Und genau weil die Fotografen das Bewusstsein für Nutzungsrechte geschärft haben, war es wichtig, jetzt den nächsten Schritt zu setzen: die Architekturfotografie als kulturelle Praxis zu betonen. Das ist „Nutzen“ auf einer anderen Ebene.
Hejduk: Auf der einen Seite wollen die Architekten so viel wie möglich visuell präsent sein. Auf der anderen Seite sind wir ein Luxussegment. Man kann auch bauen, ohne es fotografisch zu dokumentieren.
Standard: Trotzdem werben Architekten vor allem mit Bildern – und das, dank Internet, mehr als je zuvor.
Hejduk: Schon. Aber wie viele Architekturbüros wirklich professionell fotografieren lassen, das steht in keiner Relation.
Fitz: Ich finde es erstaunlich, wenn Architekten sich die Chance auf den dritten Blick entgehen lassen. Auch wenn es Auftragsfotografie ist, ist es nie Propaganda, sondern eine neue Sichtweise. Die Architekturfotografie war schon immer Komplizin und Kritikerin, und meistens ist sie im selben Foto beides.
Standard: Um auf den Buchtitel zurückzukommen: Was ist der Nutzen der Architekturfotografie?
Hejduk: Ganz einfach: Ich liebe diesen Beruf. Eigentlich fotografiere ich immer für mich selbst. Aber wir bewahren in unseren Archiven auch Zeitdokumente auf. Ein Archiv zu führen ist viel Arbeit, das füllt Terabytes und Aktenschränke voll mit analogem Material. Wenn man dann zehn Jahre später hineinschaut, hat man einen anderen Blick und entdeckt Sachen wieder neu.
Oláh: Für mich zählt der Wille zum Suchen und Entdecken. Das Spüren ist neben dem Sehen das Wichtigste – die Frage, wie gern man sich in einem Raum aufhält. Den gesellschaftlichen Mehrwert bekommen Bilder oft erst, wenn die Gebäude, die sie darstellen, nicht mehr existieren. Darüber denkt man aber bei der Arbeit nicht nach.
Fitz: Für mich als Nutzerin liegt der Wert darin, dass ich auf den Fotos etwas sehe, das ich nicht wahrnehme, wenn ich selbst hingehe.
Standard: Was macht man, wenn man ein Gebäude fotografieren soll, das man einfach schlecht findet?
Hurnaus: Den persönlichen Geschmack kann man zuerst einmal zurücknehmen. Man filtert durch spezifische Ausschnitte eine Essenz heraus und zeigt dadurch Aspekte, die im ersten Gesamteindruck gar nicht wahrgenommen werden.
Oláh: Das Fotografieren ist ein visuelles Aufräumen in der Unordnung der Welt.
Standard: Es ist ein altbekanntes Klischee, dass Architekten keine Menschen in ihren Bildern haben wollen. Trifft das noch zu?
Hurnaus: Das war früher tatsächlich so. Die jüngere Architektengeneration will aber stärker belebte Bilder. Als Fotografin ist es eine intuitive Entscheidung. Wenn der Mensch sich zu sehr in den Vordergrund drängt und man als Erstes darauf schaut, was der anhat, finde ich das schwierig. Aber grundsätzlich können Menschen im Bild den Maßstab der Architektur verdeutlichen.
Oláh: Das hat auch mit der Technik zu tun. Mit den Kameras, die wir vor 20 Jahren hatten, war es viel schwieriger, einen Menschen scharf ins Bild zu bekommen.
Fitz: Wir zeigen im Buch auch Beispiele, in denen neue Räume so fotografiert werden, dass sie nicht steril ausschauen, sondern dass man ihr Potenzial erkennt, das Warten auf den Ansturm des Lebens. Auch brandneue Gebäude können von Nutzung erzählen.
Standard: Manche Architekten blenden gerne die Umgebung ihrer Gebäude aus. Als Fotograf kann man den Kontext wieder hineinholen.
Hurnaus: Es ist eine Frage des Zeitaufwands: Je länger man sich mit einem Gebäude auseinandersetzen kann, umso mehr nimmt man auch das Umfeld wahr, und so entstehen umfangreichere und interessantere Dokumentationen.
Hejduk: Es gibt Auftraggeber, die das Umfeld nicht gerne im Bild haben. Da wird schon mal verlangt, dass ein Bushaltehäuschen rausretuschiert wird.
Oláh: Das hängt stark davon ab, wer der Auftraggeber ist. Es kann sein, dass die Kuratoren glücklich sind, weil sie den künstlerischen Wert des Bildes sehen, und die Marketingabteilung ist entsetzt, weil im Bild ein Traktor herumsteht, der die Perfektion stört.
Hurnaus: Ein Bildmotiv ist immer eine Art Bühne, auf der alles Mögliche stattfinden kann.
Hejduk: Und alle warten immer darauf, dass Hühner, Schafe und Katzen ins Bild laufen!
Hurnaus: Und dass endlich die Sonne kommt. Oder dass sie endlich wieder weggeht.
Der Standard, Fr., 2015.10.30
[ „Vom Nutzen der Architekturfotografie“, Hrsg. v. Angelika Fitz und Gabriele Lenz, € 49,95 / 288 Seiten, 250 Farbabbildungen, Birkhäuser-Verlag, Basel, 2015 ]