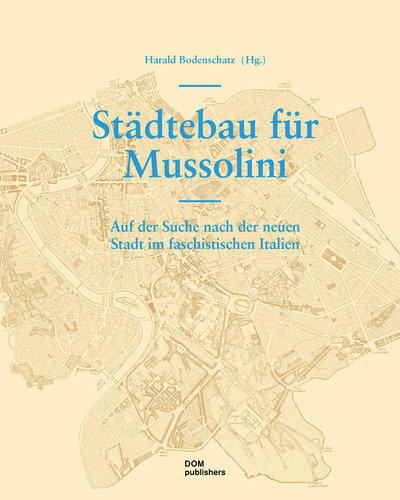(SUBTITLE) Harald Bodenschatz' monumentale Studie über die neue Stadt im faschistischen Italien
Im städtebaulichen Erneuerungswahn der späten 1930er Jahre wurde Sassello, das malerische Armeleuteviertel von Lugano, abgerissen, um ungesunde Zustände zu beheben, wie es hiess. An seiner Stelle errichtete der in Rom und Mailand ausgebildete Bruno Bossi – basierend auf einem Wettbewerbsprojekt von 1933 – an der engen Via Nassa eine kleine Platzanlage, die mit ihren Palazzi aus Travertin an italienische Vorbilder der Zeit erinnern.
Im städtebaulichen Erneuerungswahn der späten 1930er Jahre wurde Sassello, das malerische Armeleuteviertel von Lugano, abgerissen, um ungesunde Zustände zu beheben, wie es hiess. An seiner Stelle errichtete der in Rom und Mailand ausgebildete Bruno Bossi – basierend auf einem Wettbewerbsprojekt von 1933 – an der engen Via Nassa eine kleine Platzanlage, die mit ihren Palazzi aus Travertin an italienische Vorbilder der Zeit erinnern. Der Städtebau im faschistischen Nachbarland, der ohne Rücksicht auf Verlust brachiale Interventionen favorisierte, wurde damals europaweit beachtet und bald kritisch, bald begeistert kommentiert. So kann man Bossis Eingriff als helvetisch temperierte Antwort auf die erste grosse Altstadtoperation in Italien lesen: die Freisprengung der monumentalen Piazza della Vittoria durch Marcello Piacentini, den späteren Staatsarchitekten, im Herzen Brescias (1928 bis 1932), bei der sich erstmals die städtebauliche «Effizienz» der faschistischen Diktatur manifestierte. Das klassisch vornehme, heute von vielen geschätzte Ensemble «brachte die veränderten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse des faschistischen Regimes zum Ausdruck» und «bot schliesslich eine grandiose Bühne für die neuen, vom Regime profitierenden Mittelschichten», wie Harald Bodenschatz festhält.
Tradition und Moderne
In seiner beeindruckenden Studie über den «Städtebau für Mussolini» analysiert der Berliner Sozialwissenschafter und Stadtplaner Bodenschatz, assistiert von Daniela Spiegel, Uwe Altrock, Lorenz Kirchner und Ursula von Petz, die Veränderungen Brescias in einem prägnanten Aufsatz, der einen in den Kern der gegenwärtigen Diskussion des italienischen Urbanismus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts katapultiert. Das Team stellt dabei fest, dass das Bauwesen unter dem Duce bis anhin weniger kritisch aufgearbeitet wurde als jenes unter den Nationalsozialisten. Die faschistische Verstrickung vieler italienischer Architekten – von Giovanni Muzio bis Gio Ponti – liess sich schon kurz nach dem Krieg mit dem Hinweis auf die Verlockungen des bauwütigen Regimes entschuldigen. Dieses verwirklichte nicht nur Prachtstrasse und Plätze, die der faschistischen Selbstdarstellung dienten, sondern auch Wohnsiedlungen und neue Städte im modernen, rationalistischen Vokabular.
Bodenschatz und seine Mitarbeiter müssen weit ausholen, denn aufgrund der sprachlichen Barriere war der Städtebau der Duce-Zeit im deutschsprachigen Raum bisher nur ein Randthema, auch wenn Aram Mattioli und Gerald Steinacher mit ihrer Publikation «Für den Faschismus bauen» (Orell Füssli, Zürich 2009) bereits fundierte Vorarbeit geleistet haben. In Italien stellt Bodenschatz nicht ohne kritischen Unterton eine über die Jahre gewachsene Akzeptanz, ja Bewunderung von Architektur und Städtebau unter Mussolini fest. In der Tat werden nicht mehr nur Genies wie Giuseppe Terragni und mit ihm die lombardischen Rationalisten gefeiert, sondern auch deren Römer Kollegen, wie jüngst etwa die grosse Luigi-Moretti-Ausstellung in Rom und Mendrisio gezeigt hat. Das Publikum kümmert sich um ihre politische Vergangenheit ebenso wenig wie um die Tatsache, dass Roms Stadtbild durch die Abrisspolitik der Faschisten massiv verändert wurde. Mit neuen Verkehrsachsen legte man den Blick von der Engelsburg auf den Petersdom oder vom Palazzo Venezia (dem Sitz des Duce) auf das Kapitol frei. Die zum Richtmass erhobene alte Grösse wurde allenthalben inszeniert, wie die Freilegung des Augustus-Mausoleums, des Marcellus-Theaters oder der Ruinen am Largo Argentina beweist.
Im Zentrum von Bodenschatz' Opus steht denn auch die forcierte Umgestaltung Roms, mit der schon im späten 19. Jahrhundert begonnen worden war. Trotz Unstimmigkeiten und wechselnden Generalbebauungsplänen wurden neben den Eingriffen ins historische Gefüge, von denen die Schneise der Via dell'Impero (mit dem gigantischen, unrealisiert gebliebenen Palazzo del Littorio) quer durch die Kaiserforen der dramatischste war, auch neue Quartiere geschaffen. Aufsehen erregten die Gartenvorstadt Garbatella, das herrschaftliche Quartier um die Piazza Verbano, die Universitätsstadt, die Filmstadt Cinecittà, die Sportstadt «Foro Mussolini», das Lido-di-Roma-Viertel und – als planerischer und architektonischer Höhepunkt – die zwischen Neuklassizismus und Rationalismus oszillierende Weltausstellungsstadt EUR.
Schon das Material über die Verwandlung Roms zum Schaufenster des Faschismus hätte eine opulente Publikation ergeben. Doch Bodenschatz zielt aufs Ganze und behandelt anschliessend mit ähnlicher Akribie den Städtebau in Italien und in den Kolonien. Viel Aufmerksamkeit widmet er der Urbarmachung und Besiedlung der Pontinischen Sümpfe, wo trotz der von Mussolini angestrebten «Ruralisierung Italiens» Neustädte mit klangvollen Namen wie Aprilia, Littoria oder Sabaudia, in denen moderne Architektur und traditionelle Urbanistik zusammenfanden, verwirklicht wurden. Weitere reich ausgestattete Kapitel gelten den übrigen Stadtgründungen vom istrischen Arsia bis Mussolinia di Sicilia, aber auch Grossstädten wie Mailand, Turin und Neapel. Diese wurden hierarchisch umgebaut, wobei die historischen Zentren vermehrt der Verwaltung und dem Konsum dienten. In den anschliessenden Quartieren wohnten die neuen Mittelschichten und die Arbeiter, während «weit draussen in der Stadtregion die unerwünschten sozialen Schichten untergebracht» wurden.
Besondere Beachtung findet der «ethnische Städtebau» in Bozen, wo Piacentini der Südtiroler Altstadt westlich der Talfer eine italienische Neustadt mit Triumphbogen, Corso und Gerichtsplatz entgegensetzte, die heute – bei allem Wissen um die geschichtliche, politische und soziale Problematik – von vielen als Bereicherung empfunden wird. Um die Durchsetzung der Italianità ging es auch in den Kolonien: In Libyen wurde das grossartige altrömische Erbe restauriert, Rhodos erhielt eine repräsentative Hafenpromenade, Tirana und Addis Abeba Generalbebauungspläne, Mogadiscio neue Quartiere, und in Eritrea wurde das Dorf Asmara zu einer modernen Stadt mit 100 000 mehrheitlich italienischen Einwohnern ausgebaut.
Städtebauliches Erbe
Abschliessend vergleicht Bodenschatz den faschistischen Städtebau mit jenem anderer Diktaturen und stellt fest, dass man in Italien nicht auf modernistisch-westeuropäische Modelle setzte, sondern auf eine «verdichtete, urbane Bauweise», mit der «einer Suburbanisierung der Mittelschichten wirkungsvoll begegnet» wurde. Die im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsprogrammen vorangetriebene Modernisierung brachte dem Land aber auch neue Bahnhöfe und Autobahnen, Universitäts- und Sportanlagen, Krankenhäuser und nicht zuletzt innovative Ferienkolonien, deren verspielt-bildhafte Formen in den postmodernen 1980er Jahren begeistert wiederentdeckt wurden. Auf eine abschliessende Wertung verzichtet Bodenschatz. Hingegen wird das überreiche Text- und Bildmaterial im 58-seitigen Anhang durch Mussolinis Äusserungen zu verschiedenen architektonischen und städtebaulichen Aspekten ergänzt. Dieses Material kann bei der Beantwortung der Frage nach dem Unterschied zwischen demokratischem und diktatorischem Städtebau helfen. Bodenschatz selbst hält fest, dass «Garbatella, EUR oder Sabaudia Produkte des faschistischen Regimes und zugleich attraktive Teile der italienischen Stadtlandschaft von heute» sind, die als Erinnerungs- und Lebensraum «hinsichtlich ihrer Gebrauchsqualität für heute und morgen diskutiert werden» müssen. Nur so «können wir mit den Produkten der Diktatur angemessen argumentativ und praktisch umgehen».
Neue Zürcher Zeitung, Di., 2012.05.15
Städtebau für Mussolini. Hrsg. Harald Bodenschatz. DOM Publishers, Berlin 2012. 519 S., Fr. 129.–.