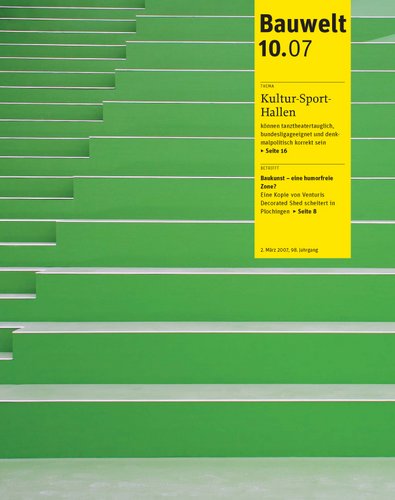Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Interview mit Julius Shulman | Jochen Paul
02 „Schindlers Häuser“ Film von Heinz Emigholz | Doris Kleilein
04 Moderne in den Tropen im NAi | Knut Birkholz
04 Ingenieurkunstgalerie in Berlin | Frank Peter Jäger
BETRIFFT
08 Humorfreie Baukunst? | Christian Marquardt
WETTBEWERBE
10 Erweiterung der Stadtbibliothek in Stockholm
14 Entscheidungen
15 Auslobungen
THEMA
16 Sporthalle in Berlin-Prenzlauer Berg
20 Sporthalle in Unterhaching
24 Sports- and Culture Center Holmbladsgade
28 Schulhaus und Turnhalle Martinsberg
32 Dreifachsporthalle in Ingolstadt
36 Pocketsporthalle in Beausoleil
REZENSIONEN
39 Holz. Große Tragwerke | Karl J. Habermann
39 Natur in der urbanisierten Landschaft | Annette Taubert
40 Landscape Architecture in Mutation | Anne Kockelkorn
40 Fieldwork. Landschaftsarchitektur in Europa | Annette Taubert
40 Allain Provost | Annette Taubert
RUBRIKEN
05 wer wo was wann
38 Kalender
42 Anzeigen
48 Die letzte Seite
Titel: Sport- und Kulturzentrum Holmbladsgade, Kopenhagen
Foto: Torben Eskerod, Kopenhagen
Redakteur Thementeil: Felix Zwoch