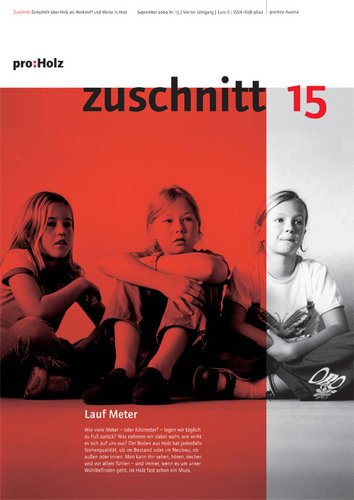Editorial
Fußböden sind überall, sind alle Oberflächen, auf denen wir uns zu Fuß bewegen, alle Untergründe, die wir betreten. Die Wörter „Oberflächen“ und „Untergründe“ umfassen die ganze Bedeutung des Bodens, indem sie ein und dasselbe Phänomen aus entgegengesetzten Blickwinkeln benennen: die Schnittstelle zwischen oben und unten, zwischen Mensch und Erde, zwischen Flächigkeit und Tiefe. Fußböden sind mehr als eine notwendige Deckschicht, sie sind die Oberflächen, zu denen wir am meisten Kontakt haben, die alle unsere Sinne ansprechen. Wir sehen sie, hören sie, fühlen sie, riechen sie, besonders wenn sie aus Holz sind. Kein anderes Material beinhaltet dieselbe Vielfalt wie dieses, keines ist so gut dazu geeignet, Wohlbefinden hervorzurufen. Zur individuellen Optik, zum angenehmen Geruch, zur weichen, warmen Haptik, zum vertrauten Klang kommen Vorteile, die uns kaum bewusst sind, die wir aber trotzdem spüren: Holzböden sind wärmedämmend, hygienisch, elastisch, antistatisch, schadstoffabsorbierend, robust und schaffen eine gute Raumakustik.
Fußböden aus Holz. Wir haben uns beschränkt und manche Aspekte nicht oder nur am Rande behandelt. Wichtig erschien uns aber, das Thema aus phäno-menologischer Sicht zu betrachten und anhand von Beispielen zu zeigen, unter wie vielen Aspekten Holzfußböden eingesetzt und wahrgenommen werden können: Wolfgang Feyferlik erzählt über seine Erfahrungen mit den Böden, die er im Geistlichen Haus in Mariazell einbauen ließ. Unter dem Aspekt des Riechens beschreibt Renate Breuß die Böden der Volksschule in Doren von cukrowicz.nachbaur. Zuletzt legt Gabriele Reiterer einen Schwerpunkt auf das Hören und berichtet vom Klangforum in Wien von lichtblau.wagner. Zwei Anwendungen im Außenbereich leiten vom Objekt zum Typologie und Produktteil über. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei den Firmen Bawart, Kaindl Flooring, Mitteramskogler, Stia, Weitzer Parkett und WIHO, die uns für Gespräche zur Verfügung standen.
Böden bereinigen, wie Wolfgang Pauser schreibt, das problematische Verhältnis zwischen Mensch und Erde. Holzfußböden umso mehr, als sie zwischen Natur und Kultur vermitteln. Wir stimmen dem zu und sind überzeugt, dass Fußböden aus Holz nicht nur vielseitig und schön sind, sondern auch Emotionen in uns ansprechen, die über das Praktisch-Ästhetische hinausgehen.
Zum Abschluss sei noch ein Satz von Peter Zumthor zitiert, der vieles relativiert und zugleich vieles erklärt, das uns am Herzen liegt:
„Der Sinn, den es im Stofflichen zu stiften gilt, liegt jenseits kompositorischer Regeln, und auch die Fühlbarkeit, der Geruch und der akustische Ausdruck der Materialien sind lediglich Elemente der Sprache, in der wir sprechen müssen.“
Aus: Peter Zumthor, Architektur denken, Birkhäuser Verlag, Basel–Boston–Berlin 1999. (Eva Guttmann)