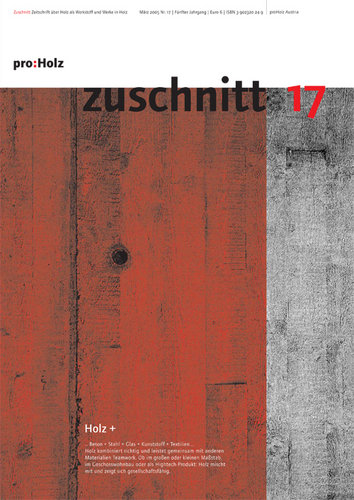Editorial
Wer baut mischt. Kein Gebäude mit annähernd konventioneller Nutzung kann errichtet werden, ohne dass verschiedene Materialien neben- und miteinander zum Einsatz kommen. Notwendige Eigenschaften wie Tragfähigkeit, Dichtheit, Transparenz etc. erfordern die Verwendung von dafür geeigneten Baustoffen. Darüber hinaus verfügen alle Materialien über spezifische Merkmale und es ist eine Frage der Perspektive, ob diese in einem bestimmten Zussammenhang für wünschenswert erachtet werden oder nicht.
Man kann sich für oder gegen Holz entscheiden, weil es schwingt, man kann sich für oder gegen Glas entscheiden, weil es transparent ist, man kann sich für oder gegen Beton entscheiden, weil er Wärme und Kälte speichert, man kann jenseits materialdogmatischer Präferenzen entwerfen. Das Zusammenspiel von Materialien, die verteilten Rollen, die unterschiedliche Baustoffe übernehmen, lassen im Idealfall Bauwerke entstehen, die um vieles selbstverständlicher, harmonischer und »authentischer« sind als solche, bei denen unter Aufbietung aller technischen Möglichkeiten auf »Materialreinheit« hingearbeitet wurde.
Die vier Projektbeispiele, die in diesem Heft vorgestellt werden, decken völlig unterschiedliche Themen ab, gemeinsam ist ihnen der materialgerechte Zugang:
* Mit dem Neubau des Sportstadions in St. Lambrecht von Gerhard Mitterberger zeigen wir ein formal, technisch und bauphysikalisch sehr reduziertes Bauwerk, das durch die Eleganz und Exaktheit des Materialeinsatzes besticht.
* Beim Altenheim in Landeck sanieren gharakhanzadeh sandbichler architekten eine bauphysikalisch mangelhafte Struktur aus den 1970er Jahren mit Hilfe von Holzmodulen, die in die tragende Betonstruktur des Bestandes eingeschoben werden.
* Die Niedrigenergie-Fertigteilhäuser aus der Reihe »Standard Solar« von Driendl*Steixner bzw. Gerhard Steixner basieren funktional und formal von »Standard Solar I« aus dem Jahr 1987 bis zum »art for art«-Haus, das 2004 fertig gestellt wurde, auf dem Einsatz unterschiedlicher Baustoffe und der Erarbeitung von Details, in denen jedes Material punktgenau verwendet wird.
* Schließlich stellen wir den Um- und Zubau der ID-Werkstatt in Traun von Raimund Dickinger vor, wo eine scharfe Trennung von Holz, Beton und Glas vorgenommen wird und zwar sowohl in konstruktiver als auch in sinnlicher Hinsicht.
Eine Übersicht über Holz und Holzwerkstoffe, deren Eigenschaften durch Hinzufügen anderer Materialien spezifiziert werden, vervollständigt den Themenschwerpunkt dieses Heftes, das mit der Beschreibung eines Produkts (beinahe) endet, welches exemplarisch ist für effizientesten Materialeinsatz auf Lowtech-Basis: der Steinschleuder als Bild für die intelligente Kombination und Anwendung verschiedener Bestandteile gemäß ihren Eigenschaften und gegen engstirnigen Materialfetischismus. Denn Holz ist zwar einzigartig, aber durchaus gesellschaftsfähig. (Eva Guttmann)
Inhalt
Zum Thema
Editorial | Eva Guttmann
Essay - Mischung, Mischbau, Mischkulanz ..? | Friedrich Achleitner
Projekte
Eindeutige Teile – Sportstadion St. Lambrecht | Eva Guttmann
Gedämmte Baukosten – Altenheim Landeck | Nora Vorderwinkler
Mischen possible Standard Solar I – IV ff | Eva Guttmann
Sinnlichkeit mit System – ID-Werkstatt Traun | Romana Ring
Weitere Informationen zu diesem Thema auf den proHolz Seiten:
Forschung
Leicht und massiv: Kombinationsmöglichkeiten im Geschossbau | Martin Teibinger
Holz +
* Holz + Glas: Verklebung zum statischen Verbund
* Holz + Beton: Forschung und Perspektiven
* Holz + hochfeste Fasern: Leistungssteigerung durch Bewehrung
* Holz + Textil: Formholzprofile und textile Verstärkungen
* Holz + Kunststoff: Wood-Plastic-Composite
Holzrealien
Holz, Gummi, Draht und Steine | Willi Hengstler
Holz(an)stoß
Hybrid House: Caracas, West Bank, West Palm Beach | Stefan Tasch
Sportstadion St. Lambrecht
(SUBTITLE) Gespräch mit Gerhard Mitterberger
Guttmann
Das neue Sportstadion in St. Lambrecht besticht durch die Direktheit des Materialeinsatzes. Die Selbstverständlichkeit, mit der Beton, Stahl und Holz nebeneinander stehen und die Klarheit ihrer konstruktiven Entflechtung sind bemerkenswert. Vor welchem Hintergrund ist dieses Projekt so entstanden?
Mitterberger
Es war der Wunsch der Bauherren, für das Stadion in hohem Maße Holz zu verwenden. Diese Vorgabe war ganz in meinem Sinn, weil das Material charakteristisch für die Gegend ist. Wir haben uns dann für klh-Platten entschieden, um einen regionalen Betrieb einzubinden, außerdem war es mir ein Anliegen, die Holzplattenbauweise auszureizen. In einem Bauwerk, das – zumindest teilweise – nicht gedämmt werden muss, weil im Winter kein Betrieb ist, kann man dann wirklich mit 6cm starken Holzplatten eine Außenwand herstellen. Das finde ich interessant, weil man zeigen kann, wie dünn die Platten wirklich sind und wie leicht man sie verarbeiten kann. Man muss sie nur wirklich als Platten behandeln. Davon ausgehend wurden Beton und Stahl, einer technisch-konstruktiven Logik folgend, verwendet, aber auch jeweils im Zusammenhang mit ihren atmosphärischen Eigenschaften.
Guttmann
Wie schaut diese Logik beim Stadion in St. Lambrecht aus?
Mitterberger
Das Erdgeschoss steckt in der Erde und muss beheizbar sein, seine Decke ist begehbar und teilweise im Freien. Daher bestehen diese Teile aus Beton. Die Aufbauten für den Spielbetrieb – Kassa, WCs, Ausschank etc. sind aus klh-Elementen. Diese übernehmen die Rolle des Raumabschlusses, des Witterungsschutzes und des statischen Haupttragwerks: Zwei der Trennwände, die im rechten Winkel zur langen Rückwand stehen, wurden mit der Betondecke verschraubt und fungieren als aussteifende Querschotten. Stahl kommt dort zum Einsatz, wo die Konstruktion das noch erfordert hat bzw. optisch leicht sein sollte, so etwa als Tragwerk für das Dach. Leimbinder hätten doppelt so hoch sein müssen und den Zuschauerbereich viel zu sehr gedrückt.
Guttmann
Das sind dann schon die atmosphärischen Eigenschaften…
Mitterberger
Ja, da geht es um die Wahrnehmung. Eine Sportanlage soll für mich immer eine Art »Würstelbudenatmosphäre« haben, ich arbeite da bewusst auf einem materialtechnischen Lowlevel. Ich mag es, wenn beim Ausschank eine Klappe aufgemacht wird, ich mich dazu stellen kann, und das war es dann. Der rohe Beton, die Holzelemente mit ihrer Sichtoberfläche, die Stahlträger, alles unverkleidet, können das. Es hängt natürlich stark mit der Bauaufgabe zusammen, aber solche Oberflächen vertragen es, dass einmal jemand dagegen tritt, ohne dass etwas passiert, oder dass in der Kabine mit dem Ball herum geschossen wird, ohne dass eine weiß verputzte Wand gleich entsetzlich ausschaut.
Guttmann
Was in St. Lambrecht auffällt, ist die Art und Weise, wie die Materialien aufeinander stoßen, aneinander gefügt sind, ohne sich zu durchdringen. Welcher Anspruch steht da dahinter?
Mitterberger
Da ist einerseits der Anspruch, Übergänge wirklich auf das Notwendige zu reduzieren. Dort etwa, wo die Stahlkonstruktion, die das Dach trägt, an die Holzwand stößt, ist nur ein kleiner Flansch angeschweißt und ins Holz versenkt und das reicht. Andererseits gibt es auch ganz praktische Gründe: Wir wollten zum Beispiel unbedingt vermeiden, dass das Holz der Einbauten die Betondecke des Erdgeschosses berührt, weil die ja nass ist, wenn sie nach dem Spiel abgespritzt wird. Es gibt zwar ein Gefälle Richtung Spielfeld, aber wenn das Holz im Beton steckt und feucht wird, dann kann das Haupttragwerk einen unkontrollierbaren Schaden erleiden. Zugleich muss die ganze Horizontalkraft über zwei Schotten in die Betondecke abgeleitet werden. Daraus ist diese fast unsichtbare Lösung entstanden, die Querwände über Zugstäbe und Schubanker mit der Betondecke zu verspannen und damit den Abstand zwischen Holz und Beton halten zu können.
Guttmann
War es Absicht, nicht zu zeigen, wie Kräfte abgeleitet werden?
Mitterberger
Nein, überhaupt nicht. Deshalb mag ich auch diese Bauaufgaben so gern, bei denen man direkt arbeiten kann, wie eben Sportanlagen, deren Beanspruchungsgrad ein höherer ist. Wenn man etwas anschrauben muss, dann wird es eben angeschraubt und man muss überhaupt nicht so tun, als gäbe es keine Schrauben. Wichtig dagegen ist, dass die Schrauben richtig sitzen. Was ich grundsätzlich nicht mag, ist die Überinszenierung von Dingen. Eine Kraft gehört abgeleitet, was soll man sonst damit machen? Ich baue aber kein Haus, um zu zeigen, wie toll ich Kräfte ableiten kann, ein Haus hat für mich wirklich einen anderen Sinn.
Guttmann
Auch der Teil des Daches, der mit Kunststoff gedeckt ist, liegt einfach auf dem Holzdach auf...
Mitterberger
Ja, das ist ebenfalls ein völlig eindeutiges Element: Über den Holzboxen ist das Holzdach, der Übergang zur Rückwand ist ganz klar. Die Holzkonstruktion übernimmt damit die komplette horizontale Aussteifung der gesamten Dachfläche; Stahlkonstruktion und Polycarbonat sind daran angehängt. Vorne, über der Tribüne, und dort, wo sich die Zuschauer aufhalten, ist das Dach leicht, transparent und auch wieder aus einem billigen Industrieprodukt, einem »unveredelten« Material. Es liegt am Holz auf, das Wasser rinnt nach hinten ab. Hier gibt es also Holz, Polycarbonat und Stahl mit einer jeweils deutlich ablesbaren, konsequent getrennten Aufgabe, der optimal gerecht geworden wird.
Guttmann
Große Teile der Anlage sind im Freien – hat das diesen unmittelbaren Umgang mit den Materialien erleichtert?
Mitterberger
Ja schon, weil man die Dinge zeigen kann, wie sie sind. Eine Wand ist eine Wand, eine dünne Platte und nicht ein Produkt, das aus vielen Schichten besteht. Wo ich Glas brauche, klebe ich es hinein und der U-Wert ist uninteressant. Das hat mich an die Betonbauten aus den 30er Jahren erinnert, als 7 oder 8cm dünne Betonwände hergestellt wurden. Heute geht so etwas nicht mehr. Trotzdem war das »Raumklima« schon ein Thema, und da hat das Holz große Vorteile: Erstens sind die Massivholzplatten schalltechnisch günstig – da kann noch so laut herumgeschrieen werden, die unbehandelten Holzoberflächen absorbieren den Schall sehr gut. Zweitens bieten sie ausreichend Wärmeschutz weil sie nicht kalt abstrahlen. Die Behaglichkeit des Holzes spürt man sogar im Freien.
Guttmann
Die Holzplatten, die nicht durch das auskragende Dach geschützt sind, haben eine Lärchenholzstülpschalung erhalten. Das hat mit dem Ort zu tun?
Mitterberger
Genau. Mit der Lärchenholzschalung an der langen Rückwand und am Kopfgebäude kommt eine gewisse regionale Sprache ins Spiel. Mir war wichtig zu zeigen, das ist ein Holzgebäude, das sollte man von weitem sehen. In St. Lambrecht, zwischen den riesigen Wäldern, den Schluchten und Bergen, ist Holz das richtige Material und es ist zwar skurril, aber gerade dort, wo Holz so eine große Rolle spielt, muss man die ländliche Baukultur wieder ins richtige Licht rücken. Beim Sportstadion Bad Waltersdorf zum Beispiel, das völlig anders liegt, übernimmt Polycarbonat die Rolle des Witterungsschutzes für die Holzteile, hier osb-Platten. Da gibt es als Nachbarn eine Tennishalle mit Blechhaut, daneben fährt die Bahn vorbei, alles ist ganz eben, steppenhaft, gelb. Dort passt die Farbe der osb-Platten genau und damit das auch sichtbar bleibt, wurde das ganze Gebäude mit einer Kunststoffhaut überzogen. Der Reiz liegt in der Kombination billiger, industrieller Produkte, die genau ihre jeweilige Aufgabe erfüllen und in ihrem Zusammenspiel viel mehr können, nämlich auf den Ort eingehen. Der Kunststoff verleiht den Holzplatten einen Glanz, den man aus der Ferne überhaupt nicht deuten kann. Die Sonne spiegelt sich darin, die Haut korrespondiert ganz stark mit der Umgebung. Und auch das ist für mich Materialgerechtigkeit: den richtigen Baustoff am richtigen Ort einzusetzen. Da geht es um viel mehr als nur um Witterungsschutz. Auf der Tribüne ist das Holz dann wieder da. Trotz der Plastiksessel und der Blechverkleidung rundherum. Da brauche ich es wieder, damit eine angenehme Atmosphäre herrscht. Und das Atmosphärische, das ist ja eine der riesigen Stärken von Holz – das muss man auch sagen, logischerweise.zuschnitt, Di., 2005.03.15
15. März 2005 Eva Guttmann
verknüpfte Bauwerke
Fußballstadion
Gedämmte Baukosten
Bauphysikalische Mängel hatten die Sanierung des Altersheimes Landeck, ein Terrassenbau aus dem Jahr 1976, unumgänglich gemacht. Aufwändige Reparaturarbeiten und schwere Energiedefizite führten zu hohen Betriebs- und Erhaltungskosten, die alljährlich das Gemeindebudget belasteten. Das Isolieren der Ostfassade und eine Gesamterneuerung der Heizungsanlage konnten als Erste-Hilfe-Maßnahme die Ausgaben während der vergangenen Jahre zwar senken, langfristig zufrieden stellende Bedingungen waren damit jedoch nicht geschaffen. Bautechnische Schwächen wies vor allem die Westfassade auf: Neben einer mangelhaften Isolierung beinhaltete diese auch ein desolates, in die Betonbauteile integriertes Entwässerungssystem. Da das Heim auch in funktioneller Hinsicht nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach, reagierten die Verantwortlichen: Sanierung und Umstrukturierung des Bestandes in ein zeitgemäßes Pflegeheim für Senioren wurden Gegenstand eines Architekturwettbewerbs, aus dem gharakhanzadeh sandbichler architekten als Sieger hervorgingen.
Nach der Wettbewerbsentscheidung gaben die Bauherren ihr Einverständnis, das Siegerprojekt in eine laufende Forschungsarbeit der Architekten zu sogenannten »Synergie aktivierenden Modulen (s.a.m.)« aufzunehmen. Die Studie zielte auf die Optimierung modularer Holzsysteme ab, die bei einer größtmöglichen Breite an sanierungsbedürftigen Bauten zum Einsatz kommen sollten. »Ziel unserer Forschung war es, durch die Revitalisierung mit ,s.a.m.‘ Betriebs- und Erhaltungskosten zu senken, und gleichzeitig die Nutzbarkeit der Objekte subjektiv und objektiv zu verbessern«, erklärt Bruno Sandbichler. Da die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle bei den Sanierungskonzepten einnimmt, kommt der vermehrte Einsatz von Holz den Ansprüchen der Architekten bei der Systementwicklung sehr entgegen: »Aufgrund seiner idealen Werte in bauphysikalischer und konstruktiver Hinsicht ziehen wir Holz als erstes Material in Betracht.« Nach den Kriterien der s.a.m.-Studie unterzogen die Architekten das Altersheim Landeck einer umfassenden Bestandsanalyse. Neben den bereits bekannten bautechnischen Mängeln zeigten sich dabei noch weitere veränderungsbedürftige Aspekte betreffend die soziale Situation der Bewohner und die im Heim gebotene Wohnqualität. Ausgehend von diesen Erkenntnissen erarbeiteten die Wiener Planer ein umfassendes Verbesserungskonzept für das Altenheim, das in seinem Umfang weit über die im Wettbewerb geforderte Aufgabe hinausging. Dank hoher Effizienz in konstruktiver Hinsicht und Materialwahl entsprachen die Kosten des erweiterten Entwurfs dem vorgegebenen Budgetrahmen.
Um die geforderte Größe der Bewohnerzimmer zu erlangen, wurden raumerweiternde Elemente aus vorgefertigten Holzmodulen in die vorhandene Betonstruktur eingepasst. Die Dimensionen dieser boxenartigen Module entsprechen dem vorgegebenen Konstruktionsraster, der Beton übernimmt weiterhin die tragende Funktion, während das Holz für die bauphysikalische Aufwertung des Gebäudes zuständig ist. »Die Montage von selbsttragenden Leichtbauelementen ohne vorherige Errichtung einer Primärkonstruktion spart Zeit und Kosten und optimiert den ökologischen Materialeinsatz«, so die Architekten. Die Übernahme des Rastermaßes führte zu einer gestalterischen Neuinterpretation der vorhandenen Fassade, erhöhte aber vor allem die Kosteneffizienz des Entwurfs. Außerdem erlaubte das Modulsystem durch seine Flexibilität, die Zimmer in ihrer Größe zu vereinheitlichen. Mit dem Einbau der Raumzellen mussten charakteristische Elemente des ursprünglichen Terrassenbaus der Erweiterung der Zimmer weichen: »Da es nicht möglich war, die Zimmer nach innen zu vergrößern, bestand die einzige Möglichkeit darin, sie nach außen zu erweitern. Daher beschlossen wir, die Balkone zu eliminieren, die von vielen pflegebedürftigen Bewohnern ohnehin nicht selbständig benutzt werden konnten. Dafür wurden im Erdgeschoss leicht erreichbare Aufenthaltsbereiche mit direktem Zugang zum Park geschaffen«, erklärt Feria Gharakhanzadeh die planerische Überlegung.
Die Raumzellen selbst waren ursprünglich als »Holzkisten« konzipiert. Ein Gutachten des Bauphysikers brachte jedoch die geplante Zellenbauweise zu Fall: Zur schalltechnischen Verbesserung der Zimmertrennwand wurden die seitlichen Holzelemente durch zweischalige Leichtwände ersetzt. Nur ungern verwarfen die Architekten ihre dreidimensionale »Kistenidee« zugunsten eines modularen Systems aus Wand-, Decken- und Dachelementen, doch die deutlich niedrigeren Bau- und Transportkosten der neuen Lösung bekräftigten diese Entscheidung. Zur Auftragsvergabe wurden Firmen gesucht, die in der Lage waren, die vorgefertigten Elemente schon im Werk weitestgehend auszustatten. Wand- und Dachelemente sollten inklusive Dämmung, Fenster und Türen, Dachabdeckung, Entwässerungselementen, Fassadenverkleidung und aller Anschlussdetails »aus einer Hand« gefertigt werden.
Um sämtliche konstruktiven Fragen mit den ausführenden Firmen zu klären, gaben die Architekten die Anfertigung eines Prototyps für das Raummodul im Maßstab 1:1 in Auftrag. Schließlich kam es in der Werkstatt der beauftragten Firma sogar zum Probelauf eines Montagezyklus, der die Optimierung des Bauablaufs ermöglichte. Darauf basierend erstellte die Bauleitung ein Zeitschema und berechnete genau, wie lange jeder Arbeitsschritt dauerte. Die gewonnenen Erfahrungen und Messungen führten zu einer zeitlich genauestens abgestimmten Abfolge sämtlicher Gewerke. Jeweils drei übereinander liegende Wohneinheiten wurden zugleich umgebaut. Die Arbeitsschritte – Abriss, Rohbau, Ausbau, Montage bis zur Endreinigung – waren so präzise kalkuliert, dass der Umbau dieser Einheiten in nur drei Tagen abgeschlossen werden konnte.
Schrittweise wanderte der Bautrupp in nur zehn Wochen über die gesamte Fassade, während im Gebäudeinneren der Pflegebetrieb fast ungehindert fortgesetzt werden konnte. Da sich die schnelle und kostengünstige Holzleichtbauweise fast ausschließlich auf Trockenbauarbeiten beschränkte, konnten sämtliche Sanierungs- und Umbauarbeiten in einem einzigen Bauabschnitt vollzogen werden. In gestalterischer Hinsicht entspricht der Bau im Wesentlichen dem Wettbewerbsentwurf. Eine Änderung erfolgte lediglich hinsichtlich der Fassadengestaltung. In Übereinstimmung mit den Bauherren und den ausführenden Firmen entschieden sich die Architekten gegen die ursprünglich geplante Holzfassade und für eine Fassade aus Kupferblech. Das war ideal, weil damit Dach, Fassade und Entwässerung aus einem Material gemacht werden konnten. Den Architekten gefiel auch die charakteristische Patina, die sich auf der Kupferoberfläche bildet. Die Verkleidungspaneele wurden vorpatiniert und beleben nun abwechselnd mit den Markisen, deren Farbgestaltung der Künstler Peter Sandbichler entworfen hat, die Fassade... zuschnitt, Di., 2005.03.15
15. März 2005 Nora G. Vorderwinkler
verknüpfte Bauwerke
Umbau Altenheim Landeck
Sinnlichkeit mit System
(SUBTITLE) Gespräch mit Raimund Dickinger
Ring
Herr Dickinger, bevor wir auf das zentrale Thema unseres Gesprächs – nämlich das Material Holz in Verbindung mit anderen Baustoffen – zu sprechen kommen, erklären Sie bitte die Grundzüge des Entwurfs.
Dickinger
Das wichtigste Anliegen bei diesem Entwurf war zunächst die Korrektur des Zugangs. Vor der Erweiterung des Bürotrakts um den neuen Eingangsbereich, der durch den Erwerb des Nachbargrundstückes an der ehemaligen Rückseite möglich wurde, hat kein Mensch die Firma gefunden. Und wenn doch, hat man erst einmal an den Produktionshallen der Tischlerei entlang über enge Stiegen und verwinkelte Gänge irren müssen, um ein Gespräch zum Beispiel über die Gestaltung eines Restaurants führen zu können. Dieser Zustand war für eine Firma, die sich mit Innenausstattungen befasst, untragbar!
Ring
Kam also der Wunsch nach dem Baumaterial Holz vom Bauherrn? Die Verbindung zum Holz verarbeitenden Betrieb einerseits und zum Raumausstatter auf der anderen Seite wäre ja logisch.
Dickinger
Nein, gar nicht. Der Bauherr hat mir da völlig freie Hand gelassen. Es war meine Entscheidung und diese ist hauptsächlich aus konstruktiven und bauphysikalischen Gründen gefallen. Es war allerdings schon ein Vorteil, dass die angeschlossene Tischlerei so viel selbst ausführen konnte.
Ring
Was waren denn die konstruktiven Voraussetzungen?
Dickinger
Der Bestand konnte aus statischen Gründen durch den Zubau nicht belastet werden. Ich habe deshalb zwei in der Seitenansicht hammerförmige Betonscheiben parallel zueinander angeordnet, die die Decke über dem Erdgeschoss und das Dach des Zubaus tragen und ihm seine signifikante Form geben. Der Rest des Tragwerks ist aus Holz. Nicht zuletzt, weil ich damit das Gewicht reduzieren konnte. Es hätte aber durchaus auch Stahl sein können.
Ring
Die hölzerne Akustikdecke und der Boden aus dem gleichen Material sind ja sehr sorgfältig gearbeitet. Besonders Details wie der Übergang des an dieser Stelle hochgezogenen Bodens zu der Ausnehmung in der Sichtbetonscheibe sind bewundernswürdig exakt ausgeführt.
Dickinger
Ja, da waren die Handwerker schon gefordert. Auch die Fuge zwischen Außen und Innen, der Sichtbeton innen und die hinterlüftete Blechfassade außen, nur durch die Glasscheibe getrennt, war nicht so einfach herzustellen! Das Detail zwischen Betonscheibe und hochgezogenem Boden hat auch einen konstruktiven Hintergrund: Die Holzdecke über dem Erdgeschoss ist an der Lattung der Blechfassade aufgehängt. Mit ein paar Stahlstäben verstärkt, aber sonst lupenrein aus Holz konstruiert. Und das spürt man auch, weil die Decke schwingt. Dieses Fühlen eines Materials, einer Konstruktion, das Schwingen eines Bodens, von dem man weiß, er befindet sich in einem auskragenden Baukörper, das war wichtig für mich und ein entscheidender Faktor bei der Materialwahl. Dazu kommt noch ein wesentlicher Punkt, warum ich gerne mit Holz arbeite: Zimmerleute sind das Konstruieren gewöhnt, das gehört einfach zu ihrem Denken dazu. So wie mir, als gelerntem Steinmetz, die Ausformung eines Details ein Anliegen ist, in das ich auch bereit bin, Arbeit zu investieren. Ein Baumeister hat heute 100 Subfirmen. Ein Zimmerer baut noch. Das ist das Sympathische am Holz für mich, nicht das »Heimelige«.
Ring
Sie haben das Holz aber in diesem Fall durch Beton ergänzt, oder eigentlich am Beton aufgehängt. Warum Beton?
Dickinger
Zunächst als Speichermasse, zum Ausgleich des Raumklimas. Die Bauherrschaft hat unangenehme Erfahrungen mit einem schlecht gedämmten Dachstuhl gesammelt. Der Beton selbst wurde dann ganz bewusst nicht als Hightech-Sichtbeton ausgeführt, sondern so, wie man ihn da sieht: mit den Zuschlägen und Kiesnestern, und dann lediglich sandgestrahlt. Alles andere hätte nur hohen Energie- und Geldaufwand bedeutet und wäre dann trotzdem unbefriedigend ausgefallen!
Ring
Sie haben ja Erfahrung mit der Kombination verschiedener Baustoffe in einem Objekt. Mit welchem Bau haben sie diesen Weg begonnen?
Dickinger
Schon mit der Revitalisierung eines jahrhundertealten Bauernhauses, dem Ofnergut im steirischen Triebendorf. Da musste einfach mit verschiedensten Materialien gearbeitet werden, weil der Bestand das verlangte. Die jüngste Bauetappe stammte aus dem Jahr 1722 und Holz beispielsweise war in den verschiedensten Ausformungen, von einfachen Rundlingen bis zu schön bearbeiteten Trämen da. Und als dann die Orgelbauwerkstätte Vonbank in den Umrissen des ehemaligen Stalles zu planen war, habe ich die alten Prinzipien des Bauens dieser Region eben wieder angewendet: einen massiven Sockel, wo es nass ist und wo der Hang schiebt, darauf eine Konstruktion aus Stahlbeton als einfaches und kostengünstiges Tragwerk und dazwischen die vorgefertigten Wandelemente aus Holzbaustoffen, um eine kurze Bauzeit zu ermöglichen. Seit dieser Zeit ist Holz für mich als Baustoff immer präsent geblieben.
Ring
Auch beim Bau des Weingutes Weninger im Burgenland.
Dickinger
Ja, auch dort, zum Beispiel als Verkleidung der Hallenwand, die in ihrer Rundung die gedankliche Verbindung zum Keller herstellt. Das Holz bewährt sich übrigens gegenüber dem Rotwein tadellos. Oder die Holzdecke über dem Fasskeller. Die schwingt und klingt hohl und sie hat eine Ausnehmung, damit man den Keller von oben auch sieht und riecht. Denn darum geht es mir bei allen meinen Bauten: um das sinnliche Erlebnis.zuschnitt, Di., 2005.03.15
15. März 2005 Romana Ring
verknüpfte Bauwerke
ID-Werkstatt