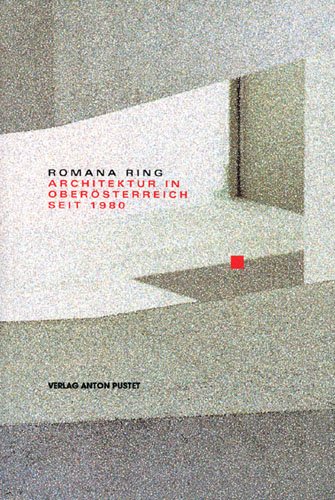Linzer Hang zur Zeitreise
Fußläufig vom Stadtzentrum liegt der Campus der Hochschule der Diözese Linz mit dem erneuerten Studentenheim – Wiesen ringsum erinnern an die bäuerlich geprägte Vergangenheit des Stadtrandes. Heute würde man solche Flächen wohl nicht mehr umwidmen und versiegeln. Oder?
Fußläufig vom Stadtzentrum liegt der Campus der Hochschule der Diözese Linz mit dem erneuerten Studentenheim – Wiesen ringsum erinnern an die bäuerlich geprägte Vergangenheit des Stadtrandes. Heute würde man solche Flächen wohl nicht mehr umwidmen und versiegeln. Oder?
Ein Spaziergang über den Campus der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz führt von der Kapuzinerstraße abzweigend den Salesianumweg hinauf. Vorbei an dem 1970 bis 1975 nach den Plänen von Franz Riepl und Othmar Sackmauer errichteten Hauptgebäude gelangt man zu zwei schlichten Häusern aus den 1960er-Jahren, die ein zur Jahrhundertwende errichtetes, heute als Praxismittelschule genutztes Gebäude flankieren. Der talseitige der beiden vom langjährigen Baureferenten der Diözese Linz, Gottfried Nobl senior, baugleich errichteten Trakte dient heute dem Hochschulbetrieb. Der Hangbau wird noch als Studentenheim genutzt. Der Linzer Architekt Klaus Leitner hat ihn generalsaniert und lädt uns mit dieser Sanierung auf eine Zeitreise ein.
Diese Reise erlaubt uns nicht nur, die weite Strecke zu ermessen, die unsere Baukultur in den vergangenen 60 Jahren zurückgelegt hat. Sie regt auch an, über die Zukunft des Bauens nachzudenken. Denn ein erheblicher Anteil des weltweiten CO2-Ausstoßes ist bei nach wie vor steigender Tendenz auf Gebäude zurückzuführen. Trotzdem oder gerade deshalb lautet das Gebot der Stunde nicht: „Viele schöne neue Passivhäuser bauen“, sondern: „Reparieren, was an Substanz noch reparabel ist.“ Dazu gehört mehr als die bauphysikalische Ertüchtigung eines Hauses und das Nachrüsten mit zeitgemäßer haustechnischer Ausstattung. Ebenso wichtig und wesentlich schwieriger ist es, die Vorzüge einer längst abgeschriebenen Anlage zu erkennen und sie für unsere Augen wieder sichtbar zu machen. Das von Klaus Leitner vorgefundene Bauwerk mochte zwar mit der Ökonomie seines Grundrisses und seiner Kubatur punkten. Doch die von leicht zurückgesetzten Fensterbändern gegliederten Fassaden zeigten ebenso wie sein aus Sichtbeton und Sichtziegelmauerwerk komponiertes Stiegenhaus, dass bei aller Sparsamkeit gestalterische Überlegungen nicht bedeutungslos waren. Das ist viel mehr, als die meisten „Zweckbauten“ unserer Tage von sich behaupten können.
Architektursprache nicht gebeugt
Klaus Leitner verzichtete folglich darauf, die Architektursprache des Hauses nach derzeitigen Vorstellungen zu beugen, und achtete darauf, heutige Anliegen in dieser Sprache korrekt auszudrücken. Den beiden Längsfassaden blieb ihre horizontale Bänderung trotz der Wärmedämmung erhalten. Und der Haupteingang an der Ostseite führt, wie eh und je von einem vermutlich Rudolf Kolbitsch zuzuschreibenden Beton-Glas-Bild flankiert, in das zwar brandschutztechnisch ertüchtigte und barrierefrei umgeformte, in seinem Charakter jedoch unveränderte Stiegenhaus. Auch den organisatorischen Aufbau des Studentenheims übernahm Klaus Leitner, wie er ihn vorfand: Ein Nord-Süd-orientierter, ausreichend breiter, an seinen Enden belichteter Gang erschließt zwei Reihen von Zimmern. Doch teilen sich dort, wo früher drei Zimmer Platz fanden, zwei Räume eine Nasszelle, die sie in die Mitte nehmen. Nächtliche Wanderungen der BewohnerInnen in die gemeinschaftlich genutzten Waschräume und WC-Anlagen gehören somit der Vergangenheit an. Diese zweifellos als Verbesserung einzustufende Änderung untermauert zwar die Behauptung, dass früher noch jeder technologische Fortschritt nicht zur Verringerung des Energieverbrauchs, sondern zur Erhöhung unseres Lebensstandards geführt hat; doch zieht man im konkreten Fall in Betracht, dass die bisher in jedem Stockwerk untergebrachten Wohnungen für Betreuungspersonal Gemeinschaftsräumen gewichen sind, erkennt man: Die Begriffe von Komfort haben sich in 60 Jahren zwar verschoben, der Verbrauch räumlicher Ressourcen je Bewohner ist jedoch nicht überbordend gewachsen. Die „Betreuung“ des Studentenheimes ruht nun auf einer funktionstüchtigen Schließanlage.
Einbaumöbel vom Tischler
Ein weiteres Verdienst der Sanierung liegt darin, mit den Ansprüchen an die Ausstattung des Heimes auf dem Boden einer Grundeinstellung geblieben zu sein, die der Intelligenz deutlich mehr Gewicht beimisst als dem Materialeinsatz. Zimmer und Nasszellen sind klein, jedoch ordentlich belüftet und belichtet und in ihrem Zuschnitt genau auf ihre Nutzung abgestimmt. Die von Klaus Leitner entwickelten Einbaumöbel, darunter ein Hochbett, das zusätzlichen Stauraum mit einem optimierten Blick aus dem Fenster verbindet, bringen seine Haltung auf den Punkt: Das Ausgangsmaterial, mitteldichte Holzfaserplatten, ist nicht teuer, Planung und Fertigung der Möbel durch den Tischler generieren jedoch einen hohen Wert.
Auch den Ausstattungselementen wurde gebührender Wert beigemessen, sodass alles Brauchbare erhalten blieb: die großen Terrazzoplatten in den Gängen etwa oder die Türzargen der Zimmer. Ihre gut gemeinten, aber nicht praktikablen Oberlichten wurden mit Holzfaserplatten verschlossen. Von der gleichen ruhigen Hand bei genauem Blick auf die von Licht und Ordnung begründeten Qualitäten eines Raumes erzählen die Bereiche an den Stirnseiten der Obergeschoße. Koch-, Ess- und Lesezonen sind um je einen mittig angeordneten, von einer Holzsitzbank umfangenen Stauraum gruppiert, in dem den BewohnerInnen ein Spind zugeteilt ist. Nach Süden orientierte Loggien ergänzen die Gemeinschaftsräume um attraktive Freibereiche.
Im Erdgeschoß liegen in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges die Verwaltungsräume, ein Seminarraum und ein Café. Nur für Letzteres hat Klaus Leitner die Kubatur des Bestandes geringfügig vergrößert. Es greift mit einem durch seine abgesetzte Holzdecke als Erweiterungsbau erkennbaren Volumen um die Breite einer Tischreihe in den Außenraum. Nach Süden und Westen großzügig geöffnet und von einer Terrasse umgeben, unterstreicht das Café die besondere Lagegunst des Studentenheims. In fußläufiger Reichweite des Linzer Zentrums liegt der Campus an den nach Westen hin ansteigenden Hang des Freinbergs geschmiegt. Hier halten von Hecken und kleinen Baumgruppen gesäumte Wiesen die Erinnerung an die bäuerlich geprägte Vergangenheit des westlichen Linzer Stadtrandes lebendig. Heute würde man Flächen wie diese wohl nicht mehr als Bauland widmen und versiegeln. Nicht wahr?
Spectrum, Sa., 2021.05.15