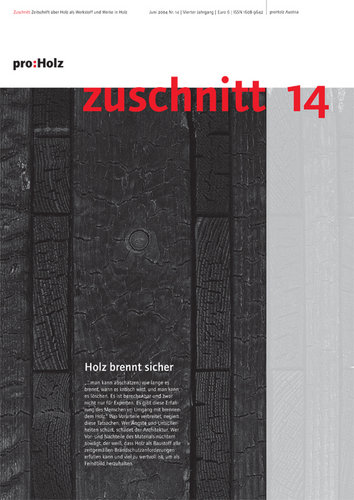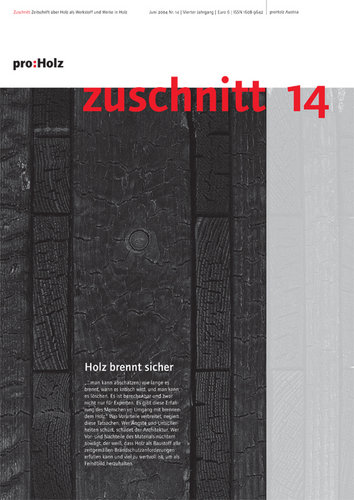Editorial
Holz brennt sicher. Eine Aussage, deren Ambivalenz und Brisanz uns bewusst sind. Denn sicher brennt Holz, aber: Holz brennt auch sicher – das heißt, wir wissen, wie es brennt und wie man damit umgeht. Versagen von verbautem Holz im Brandfall ist genau berechenbar – ein Vorteil, den nicht jedes Material für sich verbuchen kann, und so sind Aussagen von Feuerwehrleuten verständlich, die den Einsatz in einem Holzgebäude anderen vorziehen, da sie gelernt haben zu erkennen, wie lange sie sich darin aufhalten dürfen, ohne selbst gefährdet zu werden.
Trotzdem ist das Thema besetzt von Ängsten und Vorurteilen, die in ihrem Ursprung berechtigt sein mögen, mit der Realität zeitgemäßer Architektur am Stand der Technik jedoch nichts mehr zu tun haben.
Tatsache ist, dass – baustoffunabhängig – materialgerechtes und verantwortungsvolles Planen der Schlüssel zu Sicherheit im Bauwesen und Brandschutzmaßnahmen (vom Rauchmelder bis zum funktionierenden Hydranten) in jedem Fall sinnvoll sind. Gehen Sie mit uns auf eine Internetreise durch die Brandstatistiken dieser Welt. Begleiten Sie renommierte deutsche und österreichische Wissenschaftler zu Realbrandversuchen nach Thüringen. Hören Sie, was Experten aus der Praxis zum Thema zu sagen haben. Lernen Sie brandschutztechnisch vorbildliche Architektur kennen und erkennen Sie, dass Holz ein Baustoff ist, dem man vertrauen kann. (Eva Guttmann)
Inhalt
Zum Thema
Editorial | Eva Guttmann
Gastkommentar – Hü oder hott oder Holz | Roland Jörg
FAT/m (Fatalities per million) | Wolfgang Pöschl
Anwendung
Kantonales Brandschutz-Pilotprojekt – Wohnbau Hegianwandweg Zürich | Roderick Hönig
F30 + intelligente Äquivalenzmaßnahmen – Hauptschule für Klaus, Fraxern und Weiler | Robert Fabach
Brandwiderstand als Kriterium für die Materialwahl - Veranstaltungszentrum Höss-Halle Hinterstoder | Romana Ring
Gespräch
Sicher kann etwas sicher brennen…
Diskussion zum Thema zwischen Georg Driendl, Gerhard Leibetseder, Johann Riebenbauer, Klaus Peter Schober und Roland Gruber.
Service
Ansprechpartner, Institute und Institutionen zum Thema Brandschutz
- Österreichische Brandverhütungsstellen
- Prüfanstalten, Institute und Institutionen
- Änderungen in der österreichischen Brandschutznormung
Weitere Informationen zu diesem Thema auf den proHolz Seiten:
Forschung
Wie brennt was? | Ingolf Kotthoff
Feuerprobe – Naturbrandversuche an Holzfassaden in Merkers | Ingolf Kotthoff
Feuerprobe – Chronologie eines Brandes
Holz brennt – und bleibt leistungsfähig | Jochen Fornather
Schutzziele aus der Sicht der Feuerwehr | Otto Widetschek
Forst und Säge
Kontrollierte Metamorphose – vom Holz zur Kohle | Martin Höbarth
Holzrealien
Das Zündholz – sicher immer dabei | Elke Krasny
Holz(an)stoß
Joseph Beuys Tür mit Reiherschädel und Hasenohren, 1954 – 1956 | Stefan Tasch
Kantonales Brandschutz-Pilotprojekt
Zürich ist nicht bekannt für seine Holzbauten. Das wollen die Behören ändern und haben deshalb die Siedlung Hegianwandweg zum Pilotprojekt erklärt und damit die erste vier- bzw. fünfgeschossige Holzbausiedlung auf Stadtgebiet ermöglicht. Gelungen ist das Projekt dank eines frühzeitigen und intensiven Planerpingpongs zwischen Holzbauingenieuren, Architekten, Haustechnikplanern und Behörden.
Hegianwandweg klingt nach herausgeputzen Vorgärten, braun geteerten Gartenzäunen, putzigen Reiheneinfamilienhäuser und strammen Pflanzgartenkommissionen. Und so ist es auch am Hegianwandweg in Zürich. Doch seit der Fertigstellung der Genossenschaftssiedlung von EM2N Architekten nicht mehr nur. Ein frischer Wind weht durchs Quartier. Nur elf Tramminuten vom weltberühmten Paradeplatz entfernt, haben die Architekten Mathias Müller und Daniel Niggli fünf Mehrfamilienhäuser aus Holz gebaut. Die Siedlung ist ein Pilotprojekt der Kantonalen Feuerpolizei Zürich, denn bis anhin gab es im Kanton keinen Holzbau in diesen Dimensionen.
Feuerpolizei als Partner
Schon früh banden die beiden Holzbauingenieure Pirmin Jung aus Rain sowie der Brandschutzspezialist Reinhard Wiederkehr aus Beinwil am See die Behörden ein und überzeugten Jürg O. Neeracher, den Leiter der Kantonalen Feuerpolizei Zürich, vom Projekt. Die Siedlung bot sich als Prüfstein für die damals geplante Überarbeitung der Brandschutzvorschriften geradezu an. Neeracher wurde der Dritte im Bunde und erklärte das Bauvorhaben zum kantonalen Brandschutz-Pilotprojekt. Wiederkehrs Brandschutz-Konzept wurde durch die Kantonale Feuerpolizei bewilligt.
Massivbau oder Mischbauweise
Beim Holzbausystem standen Massivbau und Mischbauweise, also Holzkonstruktion mit aussteifenden Betonkernen, zur Wahl. Die Architekten planten mit den Spezialisten je ein Haus im jeweiligen System bis ins Detail. Das Ergebnis: Die Mischbauweise überzeugt gegenüber der Massivbauweise vor allem durch eine bessere Ökobilanz, einen tieferen Wärmedurchgangskoeffizienten, kleinere Lasten und größere Flexibilität in der Grundrissgestaltung. Außerdem sprachen kurze Bau- und Austrocknungszeiten dafür. Dagegen standen die höheren Kosten: Sie überstiegen den Massivbau um rund 3,8 Prozent, doch für die Bauherrschaft überwogen die Vorteile des Mischbaus.
Brettstapel und Rahmenbau
Für die Deckenkonstruktion verglichen sie Brettstapel, Holzbetonverbund, Hohlkasten sowie einfache Balkenlage miteinander. Die Brettstapeldecke überzeugte am meisten, weil damit am vielseitigsten und kostengünstigsten auf die gestellten Anforderungen reagiert werden konnte. In Kombination mit dem Trockenanhydritunterlagsboden und der abgehängten Gipskartonverkleidung verhält sie sich trittschalltechnisch optimal. Mit den daraus hervorstoßenden Balken konnten die weit auskragenden Balkone einfach realisiert werden. Das Wandsystem ist ein speziell angepasster Rahmenbau. Er ist problemlos mit der Brettstapeldecke kombinierbar und nutzt die Ressourcen effizient: Wo Lasten anfallen, sind die Pfosten massiv und verlaufen über alle Geschosse hindurch, wo nur wenig Kräfte in den Boden abgeleitet werden, sind die Wände gedämmt und mit Gipsfaserplatten beplankt. Die einzelnen Elemente können ohne Spezialmaschinen hergestellt und einfach montiert werden.
Logistik im Mischbau
Zuerst wurde die Tiefgarage in den Hang gebaut. Aus der flachen Betonschachtel wuchsen bald fünf Betonkerne. Darin liegen Entree, Liftschacht und Treppenhaus sowie die Bäder. Baumeister vor Ort überprüften regelmäßig Plan und Realität der Baustelle, um Abweichungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Wand- und Bodenelemente wurden im Winter in Gehdistanz zur Baustelle vorgefertigt. Im darauf folgenden Frühling haben Lastwagen alle Elemente auf die Baustelle transportiert. Die Transportwege blieben kurz und damit die Ökobilanz positiv. Die Montage dauerte pro Haus nur rund zwei Wochen.
Ständerkonstruktion mit Vorsatzschale
Die Wandelemente sind bis zu 14 Meter lang und drei Meter hoch. Sie bestehen im Kern aus einer 18 Zentimeter breiten Ständerkonstruktion, die beidseitig mit Gipsfaserplatten verkleidet ist. Auf der Baustelle haben die Arbeiter die Elementstöße statisch verbunden und luftdicht abgeklebt. Dann wurden die Sanitär- und Elektroleitungen verlegt. Erst zum Schluss haben die Gipser die Wandinnenseiten mit einer zweiten Mineralfaserschicht und einer Gipsvorsatzschale verkleidet. Mit dieser Zusatzschale konnten die Fachingenieure auf die Planung der Elektroleitungen verzichten und die Installateure wie gewohnt arbeiten.
Brettstapel-Deckenbalken
Nicht hohl wie die Wandelemente, sondern durch und durch massiv sind die Deckenplatten: Sie bestehen im Kern aus einem 20 Zentimeter starken Fichtenholz-Brettstapel. Darauf liegt ein feucht eingebrachter Trockenanhydritunterlagsboden. Mit dieser Konstruktion wird das beste Verhältnis betreffend Masse, Querlastverteilung und Kosten erreicht.
Das gewählte System muss auch bezüglich Schallschutz den Vergleich mit einem herkömmlichen nicht scheuen. Zuletzt wurden die Zimmertrennwände eingezogen: Es sind dünne Leichtbauwände zwischen Decke und Boden. Weil alle Lasten entweder über die Außenwände oder den Betonkern abgetragen werden, können sie frei im Raum verteilt werden.
Brandschutzkonzept Hegianwandweg
* Fluchttreppenhäuser in nichtbrennbarer F 60-Bauweise
* Garage und Untergeschosse in nichtbrennbarer F 60-Bauweise
* Tragende und brandabschnittsbildende Bauteile (pro Wohnung) in Holzbauweise mit 60 Minuten Feuerwiderstand
* Nichttragende Außenwandverkleidung in Holzbauweise F30bb (F30 brennbar)
* Außenwandverkleidung grundsätzlich nichtbrennbar; im Bereich der Balkone Holz möglich, wenn Balkonuntersicht nichtbrennbar verkleidet
* Optimale Zufahrt für die Feuerwehr
* Ausreichende Löschversorgung und optimale Hydrantenstandorte
* Blitzschutzanlage für jedes Gebäude
* Haustechnikanlagen gemäß Brandschutzvorschriften
Neue Brandschutzvorschriften in der Schweiz
Bei der Bauteilklassierung wird dieses Jahr die europäische Klassierung nach den Kriterien Tragfähigkeit (R), Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I) auch in der Schweiz eingeführt. Holz-Außenwandverkleidungen sind deshalb neu auch bei mehr als dreigeschossigen Bauten (ohne Hochhäuser) mit entsprechenden Maßnahmen (z.B. Begrenzung der Holzflächen, Sprinklervollschutz, Maßnahmen im Hinterlüftungsbereich, Schürzen usw.) möglich. Daraus ergeben sich zwei Standardkonzepte für Holzbau in der Schweiz:
1. Brandschutz mit vorwiegend baulichen Maßnahmen
Für tragende und/oder brandabschnittsbildende Bauteile für Wohn-, Büro- und Schulbauten gilt:
* Eingeschossige Gebäude: R0/EI30 Holzbau
* Gebäude bis 3 Geschosse: R30/EI30 Holzbau
* Gebäude bis 4 Geschosse: R60/EI60 Holzbau
* Gebäude bis 6 Geschosse: R60/EI60 Holzbau mit nichtbrennbarer EI30 Verkleidung
* Gebäude über 6 Geschosse: nicht brennbare Bauweise, dh. kein Holzbau
2. Brandschutz mit vorwiegend technischen Maßnahmen
Wird in einem Gebäude in Holzbauweise eine Sprinkleranlage installiert, kann der oben festgehaltene Feuerwiderstand für tragende und / oder brandabschnittsbildende Holzbauteile auf bis zu 30 Minuten reduziert werden.zuschnitt, Di., 2004.06.15
15. Juni 2004 Roderick Hönig
verknüpfte Bauwerke
Wohnbau Hegianwandweg
F30 + intelligente Äquivalenzmaßnahmen
Die Hauptschule der drei Vorarlberger Gemeinden Klaus, Fraxern und Weiler war Mitte der 1970er Jahre nach einem pädagogischen Konzept errichtet worden, das großzügige Gemeinschaftsflächen vorsah. Die für heutige Verhältnisse nur gering gedämmte Betonkonstruktion wurde elektrisch beheizt. 25 Jahre später waren diese Konzepte ein Sanierungsfall und der Grundrisszuschnitt für den aktuellen Raumbedarf denkbar ungünstig. Eine Studie ergab Sanierungskosten in der Größenordnung von sieben Millionen Euro, weshalb sich die Gemeinde zum Verkauf der Schule zwecks Umnutzung in einen Gewerbepark und den Neubau eines Gebäudes für 350 Schüler entschloss. Der vorhandene Turnsaal soll weiter genutzt und im Rahmen einer zweiten Baustufe saniert werden. Aus dem zweistufigen Wettbewerb gingen im Frühjahr 2001 »Dietrich|Untertrifaller« als Sieger hervor.
Ein parallel zur Straße liegender Verbindungstrakt zum bestehenden Turnsaal schirmt den Straßenlärm ab und birgt eine zweigeschossige Aula und eine Bibliothek im Obergeschoss. Dahinter liegt ein zweihüftiger Klassentrakt, an dem zum Hof die Stammklassen, zur Westseite die Verwaltung und Sonderunterrichtsräume angeordnet sind. Die räumlichgestalterische Besonderheit bildet ein dreigeschossiger Luftraum in der mittigen Erschließungszone, der ausreichend natürliches Licht durch ein breites Oberlichtband bis ins abgesenkte Sockelgeschoss bringt. Einzelne Brücken führen in die Klassenräume. In der Mitte ist eine Nebenraumzone angeordnet, in die auch das zweite Fluchtstiegenhaus integriert ist. Die lärmintensiven Werkräume wurden im halb versenkten Sockelgeschoss untergebracht. Der bereits eingeleitete Verkauf des Altbaus ließ lediglich eine Bauzeit von 14 Monaten zu. Trotz dieses engen Zeitrahmens wurde eine konventionelle Herangehensweise vermieden und die Aufgabe zur Umsetzung eines Musterbeispiels ökologisch nachhaltigen Bauens in Kombination mit hohen gestalterischen und räumlichen Ansprüchen genutzt.
Alle drei Konzepte – Konstruktion, Haustechnik und Raumgestaltung – lösen in Verbindung mit mehrgeschossigem Schulbau bei Kostenrechnern bzw. Sicherheitsexperten für gewöhnlich heftiges Stirnrunzeln aus. Weil sie von den damit verbundenen Qualitäten überzeugt waren, gelang es dem Büro Dietrich | Untertrifaller jedoch, aus vermeintlich kostenaufwändigen »Sonderwünschen« eine Gesamtlösung zu entwickeln, in der diese Qualitäten ein logisches Ganzes ergeben.
Angesichts des engen Zeitrahmens, einer strengen Kostenvorgabe und der geringen Belastbarkeit des Untergrunds wurde ein Holzbau mit vorgefertigten Elementen konzipiert. Durch sein geringeres Gewicht konnte eine aufwändige Pilotierung vermieden werden. Die Bedenken des Bauherrn bezüglich der akustischen Eigenschaften von Holzkonstruktionen wurden anhand von vergleichbaren Projekten (z.B. die Erweiterung des Klosters Mehrerau in Bregenz von Kaufmann und Lenz) ausgeräumt. Die bauphysikalischen Vorteile des Holzbaus ließen in der Planungsphase einen Passivhausstandard in greifbare Nähe rücken. Mit geringem finanziellen Mehraufwand konnte der zu erwartende Heizwärmebedarf unter die magische Grenze von 15 kWh⁄ m2 Geschossfläche und Jahr gedrückt werden. Mittels einer kontrollierten Be- und Entlüftung samt Wärmerückgewinnung und Vorkonditionierung in einem dreilagigen Erdregister wird nun beheizt und gekühlt. Der kontinuierliche Luftwechsel sorgt ununterbrochen für optimale Sauerstoffkonzentration und Lufthygiene. Die Brennwertgastherme zur Nachheizung wird in der zweiten Baustufe durch eine für Bestand und Neubau gemeinsam nutzbare Biomasseheizung (Hackschnitzel) ersetzt werden.
Ein wesentlicher Beitrag zur Realisierung des Gebäudes lag in der Erstellung eines Brandschutzkonzepts durch das Linzer ibs (Institut für Brandschutz und Sicherheitsforschung). Sowohl der Holzbau an sich als auch der durch den Luftraum zusammengefasste Brandabschnitt mit 4.200 m² waren in den einschlägigen Vorschriften nicht vorgesehen (F 90 für tragende Bauteile bzw. max. 1.600 m² pro Brandabschnitt laut Vorarlberger Schulbauverordnung und Vorarlberger Baugesetz). Es gibt die Möglichkeit – und es wird sie vermutlich auch in der zukünftig österreichweit harmonisierten Bautechnikverordnung neben diesen kategorischen Vorgaben geben –, durch ein Gutachten die Erreichung der vorgeschriebenen Schutzziele nachzuweisen. In Abstimmung mit der zuständigen Brandverhütungsstelle Vorarlberg wurde die daraus entstandene Endfassung schließlich im Genehmigungsbescheid vorgeschrieben. Leider gibt es behördlicherseits vor allem seit den juristischen Nachbeben der Brandkatastrophe von Kaprun eine unterschiedliche Bereitschaft, sich auf diese effektive, aber anspruchsvolle Alternative zum wortgetreuen Gesetzesvollzug einzulassen.
Ausgangspunkt für das IBS war eine umfassende Betrachtung des Brandschutzes, wodurch die erforderlichen Schutzziele wie Personenschutz, Nachbarschaftsschutz, Schutz der Einsatzkräfte etc. auf anderem Weg erreicht wurden. Die Orientierung an einem speziell auf das Bauwerk bezogenen Brandszenario erlaubte eine kosteneffizientere Sicherheit durch die Kombination aus passivem Brandwiderstand der Bauteile und aktiven, intelligenten Maßnahmen in der Sicherheitstechnik. In Summe entstand sogar ein höherer Sicherheitsstandard, als er mit einem Massivbau in F90-Bauweise zu erreichen gewesen wäre.
Bei derartigen Gutachten werden immer wieder Brandschutzkonzepte und vergleichbare Richtlinien aus der Schweiz und Deutschland herangezogen, die unterschiedliche Betrachtungsweisen verdeutlichen.
Brandschutzkonzept in Holz
Generell wurden eine brandhemmende Ausführung (F 30 statt F90) und entsprechende Äquivalenzmaßnahmen vorgesehen: Eine Brandmeldeanlage, eine automatische Sprinkleranlage (Vollschutz) und eine Brandrauchentlüftung, die im öffenbaren Oberlichtband umgesetzt wurde.
Das Schutzkonzept basiert im konkreten Fall auf einer ehestmöglichen Früherkennung eines Brandereignisses, verbunden mit einer internen Alarmorganisation (Räumung des Gebäudes – Personenschutz) und auf der Begrenzung eines möglichen Brandereignisses durch die automatische Sprinkleranlage.
Um Missbrauch oder technischen Fehlern (Fehlalarmierungen der Feuerwehr) vorzubeugen, wurde eine Interventionsschaltung an der automatischen Brandmeldeanlage vorgesehen. Ein Alarm aus einem automatischen Brandmelder löst zwar interne Alarmeinrichtungen aus, gibt aber einer geschulten Person zwei Minuten Zeit, den Alarmgrund zu überprüfen. Bei Vorliegen von Fehl- bzw. Täuschungsalarmen erfolgt eine Alarmrückstellung, ansonsten die Weiterleitung zur Feuerwehr. Durch die automatische Sprinkleranlage wird ein mögliches Brandereignis begrenzt bzw. eingedämmt. Die beiden Stiegenhäuser und der Querriegel zur Straße wurden als eigenständige Brandabschnitte ausgeführt, die Fluchtstiegenhäuser und die Wandkonstruktion im UG in Stahlbeton gefertigt. Alle anderen tragenden Bauteile sind brandhemmend (F 30) ausgeführt. Sofern aus Holz, wurden sie mit zusätzlicher Sicherheit dimensioniert und bleiben auch nach einem kalkulierten Abbrand von 18 mm tragfähig (Deckenuntersichten aus Brettschichtholz und Leimholzstützen). Die Holzstützen im Innenbereich sind durch eine GKF-Verkleidung abgeschirmt. Aus gestalterischen Gründen wurden im Gangbereich schlanke Stahlstützen eingesetzt, die mit einem aufschäumenden Brandschutzanstrich versehen wurden. Dieses Beispiel zeigt, dass eine spezifische Konzeption von Brandschutz nicht zur kostenintensiven Nachbesserung von Materialien geraten muss, sondern unter der Voraussetzung einer frühzeitigen Einbindung von Spezialisten aus Brandschutz, Haustechnik und Statik durch eine gesamtheitliche Betrachtungsweise Synergien und Qualitäten erst zur Entfaltung bringt.zuschnitt, Di., 2004.06.15
15. Juni 2004 Robert Fabach
verknüpfte Bauwerke
Hauptschule Klaus – Weiler – Fraxern
Brandwiderstand als Kriterium für die Materialwahl
Ein Kriterium für die Wahl des Konstruktionsmaterials Holz könnte allerdings überraschend wirken: der seitens der Behörde geforderte Brandwiderstand der tragenden Teile von F30 war mit Holz anstelle des Stahls ganz problemlos zu erzielen. Dies, obwohl dem Holz als unleugbar brennbarem Material ein gewisser Nimbus anhaftet, der bis vor kurzem noch seinen Niederschlag beispielsweise in den Bauordnungen gefunden hat. Doch das Aufgehen ganzer – aus Holz gebauter – Städte in Flammen gehört einer weit zurückliegenden Vergangenheit an und Bauweise sowie damit einhergehend auch Bauordnungen sind mittlerweile so weit modernisiert, dass sie mehrgeschossigen konstruktiven Holzbauten nicht mehr entgegen stehen. Tatsächlich ist ein Holzbau im Vergleich zu einem aus unbrennbarem Material errichteten Gebäude für die Sicherheit der Nutzer kein Nachteil. Was in den ersten dreißig Minuten brennt, ist hier wie dort die Einrichtung. Die Tragfähigkeit einer Holzkonstruktion im Brandfall über einen festgelegten Zeitraum sicher zu stellen, ist lediglich eine Frage der Bemessung des Tragwerks.
Jenes der Höss-Halle ist relativ komplex. Die Offenheit des Erdgeschosses bedingt, dass in dieser Ebene keine Wandscheiben zur Ableitung der Horizontalkräfte zur Verfügung stehen. Die vergleichsweise schmalen, von großzügigen Glasflächen flankierten Teile, wurden daher als Holzelemente ausgebildet, die in der massiven Decke des Untergeschosses eingespannt und in die geschlossenen Wandscheiben des Obergeschosses eingebunden sind. In der Ebene der Decke über dem Erdgeschoss und des Daches übernehmen horizontale OSB-Scheiben die Queraussteifung. Ein kombiniertes räumliches Tragwerk aus Brettschichtholzträgern, Stützen und an den auskragenden Brettschichtholzträgern hängenden Wandscheiben nimmt die hohen Schneelasten sowie die Nutzlasten eines Veranstaltungsgebäudes auf und ermöglicht die Auskragungen des Obergeschosses. So wurden fünf Meter hohe und bis zu siebzehn Meter lange Wandelemente vorgefertigt, um die auskragende Ostecke statisch zu ermöglichen. Ein Kabelbrand in der Heizung der Dachabläufe hat übrigens am Tag vor der Eröffnung noch zu einem Zwischenfall geführt. Ein Gemeindeangestellter fuhr jedoch kurzer Hand mit dem Bagger in den Saal und konnte den Brandherd so mit der auf die Schaufel des Fahrzeugs gestellten Leiter erreichen und löschen.
Eine wesentliche Frage im Zusammenhang des Brandschutzes ist natürlich jene nach der raschen Räumung des Gebäudes im Brandfall. Der positive Beitrag, den bereits der Entwurf der Höss-Halle hier leistet, ist das Fluchtwegkonzept und die damit verbundene Konzeption der Anlage als offene Kommunikationsplattform und als gebauter Weg in einem Umfeld, das sich bisher hauptsächlich auf die lineare Struktur der Dorfstraße beschränkt hatte. Die Höss-Halle erweitert den Raum gegenüber der Kirche zu einem Platz, der zu einem Teil von der erwähnten Auskragung des Obergeschosses beschirmt wird und das weitgehend in Glas aufgelöste Erdgeschoss der Halle einbezieht. Dies gelingt mit dem Auslegen einer breiten Brücke, die den flankierenden Geländeabfall überspannt. Das massive Untergeschoss der Halle – es birgt die Infrastruktur des Hauses, zu der auch eine großzügig angelegte Küche gehört – macht sich diese Geländekante zunutze, indem die Lagerräume direkt von der unteren Ebene beliefert werden können. Diese Ebene ist vorwiegend den Parkplätzen vorbehalten. Sie wird aber auch von älteren, dem Vereinsleben Hinterstoders gewidmeten Gebäuden gesäumt, sodass die Nutzung des unteren Platzes für Veranstaltungen denkbar ist.
Eine behindertengerechte Rampe verbindet, vor dem Eingang in das Foyer der Halle ihren Ausgang nehmend, den oberen mit dem unteren Platz. Von dort führt auch – ebenso wie die Rampe in das klare Volumen des mit Holz verkleideten Körpers eingeschnitten – eine Stiege den Besucher in den ersten Stock. Am Ende des Aufgangs, vor dem eigentlichen Eintritt in das Obergeschoss, das den Veranstaltungssaal um eine auch separat gut funktionierende Galerie erweitert, ist ein Fenster angeordnet. Der praktische Nutzen des getrennten Zugangs in das Obergeschoss, der auch die Fluchtstiege stellt, wird auf diese Weise um die nicht weniger wertvolle Komponente des gerahmten Blicks in die Landschaft bereichert. Hier wie auch im Bereich der dem Kirchenplatz zugewandten Terrasse wird der Stellenwert sichtbar gemacht, den das Zusammenspiel von Gebäude, Ort und Landschaft für eine Fremdenverkehrsgemeinde wie Hinterstoder unweigerlich hat. Die großzügige Verschränkung von Gebäude und Außenraum wiederum macht sich in einem Haus der kurzen und vor allem logisch geführten Wege durch den geringen Aufwand bezahlt, den die Sicherheit seiner Nutzer erfordert.zuschnitt, Mo., 2004.03.15
15. März 2004 Romana Ring
verknüpfte Bauwerke
Höss-Halle