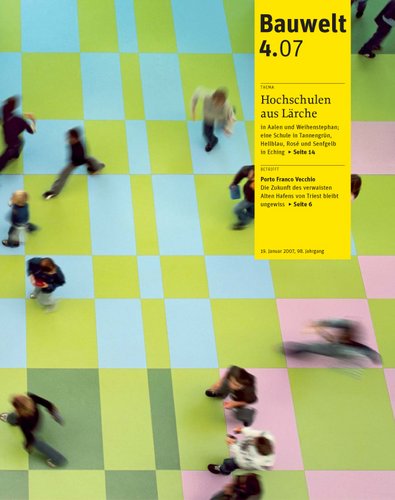Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Besuch bei einem realisierten Europan-Projekt in La Louvière | Anne Kockelkorn
03 Ausstellung „Keine Wunder!“ in Bremen | Jan Friedrich
04 Eero-Saarinen-Retrospektive in Oslo | Ulf Meyer
04 Kurt Junghanns (1908–2006) | Simone Hain
BETRIFFT
06 Porto Franco Vecchio | Maria von Hartmann
WETTBEWERBE
10 Hotelneubau auf dem Bremer Bredenplatz | Eberhard Syring
12 Entscheidungen
13 Auslobungen
THEMA
14 Hochschule für Technik und Wirtschaft in Aalen | Max Stemshorn
22 Lehrgebäude in Weihenstephan | Sebastian Redecke
28 Staatliche Realschule in Eching | Jochen Paul
REZENSIONEN
35 Zappel, Philipp! Kindermöbel. Eine Designgeschichte | Anne Boissel
RUBRIKEN
05 wer wo was wann
05 Leserbriefe
34 Kalender
36 Anzeigen