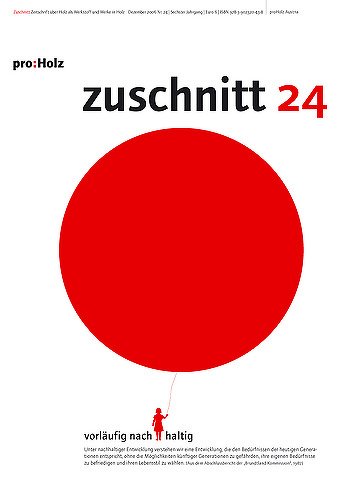Editorial
Wir werden Holz noch essen
Wir dachten, wir hätten eine wirklich gute Geschichte. Einen Bestseller oder vielmehr ein Kommunikationsgeschenk der Natur: (Bauen mit) Holz ist nachhaltig. Bei dieser Botschaft klinkten sich unsere Marketinggehirne ein und die Argumente fielen im Sekundentakt, nachwachsender Rohstoff, Klimaschutz durch CO2-Speicherfunktionen, kein Abfall, wenig graue Energie, kurze Bauzeit und so weiter. Andere Baustoffe hätten für Herstellung und Recycling einen riesigen Energieverbrauch und würden die Umwelt belasten, während Holz von alleine wachse und dabei noch CO2 binde. Stimmt. Was war nachhaltiger als Holz?!
Dann kam der Supergau. In Form eines Zuschnitt-Editorialboards im Beisein von anerkannten Nachhaltigkeitsexperten.
Wie bitte? Was sei denn am Holz schon so nachhaltig, wenn Holzprodukte über tausende Kilometer für den Hausbau von Österreich nach Japan und Amerika geschickt oder vorgefertigte Elemente für Riesenhütten per Hubschrauber auf Berge geflogen werden? Nachhaltige Lösungen seien einfach, kostengünstig, dezentral und vielfältig. „Wir werden Holz noch essen“, war ein Expertenzitat, das auf die vielfältige Anwendung von Holz zum Beispiel als Zucker- und Kohlehydratspeicher der Zukunft anspielte. Das saß – damit war zwar nicht Holz, aber vorerst das Thema Nachhaltigkeit gegessen.
Unsicherheit machte sich breit. Waren wir der brancheninternen Holzpropaganda selbst auf den Leim gegangen? Wo und wann kam uns diese gute Geschichte abhanden, gab es sie jemals wirklich? Wir gingen auf die Suche nach der Ehrenrettung für „Holz und Nachhaltigkeit“ und fanden sie im Kleinen. In Geschichten über Menschen, die Dinge im kleinen Kreislauf produzieren, im Wald, in der Industrie und in der Gestaltung am Bau. Kleine Beiträge für das große Ganze – vorläufig nachhaltig.
Wenn wir bei Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit dieser Ausgabe zu einem gesellschaftlichen Modebegriff Ärger verursachen, dann hoffen wir zumindest, dass dieser nicht nachhaltig währt.
Georg Binder
Inhalt
Zum Thema
Editorial
Georg Binder
Nachhaltigkeit oder die Entdeckung des Selbstverständlichen
Wolfgang Pöschl
Essay – Die vielen Gesichter der N.
Michael Freund
Themenschwerpunkt
Der Schlüssel Wald
Sektionschef Gerhard Mannsberger im Interview
Bedächtige Naturen – Gespräch mit Norbert Putzgruber von den Österreichischen Bundesforsten, Waldbesitzer Johannes Schwarzenberg und Waldbauer Herbert Hofer
Walter Zschokke
100% Kreislaufdenken
Gespräch mit Hans Binder
Langzeitbindung – Wiederverwendung, Weiterverwendung, Recycling, thermische Nutzung
Adolf Merl
An alles gedacht – Gemeindezentrum Ludesch als Praxistest für nachhaltiges und ökologisches Bauen
Eva Guttmann
Von Bestand – Umbau einer Tenne in Lans | Karin Triendl
Friede den Hütten
Benedikt Loderer
Ecodesign
Maria Huber, Wolfgang Wimmer
Dritter Frühling – Lux Guyers Saffa-Haus
Charles von Büren
An alles gedacht
Gemeindezentrum Ludesch als Praxistest für nachhaltiges und ökologisches Bauen
In Ludesch, einer kleinen Vorarlberger Gemeinde nahe Bludenz, hat der Umweltgedanke Tradition: 1992 wurde der Verzicht auf PVC beschlossen, 1994 trat man dem Internationalen Klimabündnis bei, 1995 wurde eine Energiebilanz über Bauzustand und Energieverbrauch der Ludescher Gebäude erstellt, auf deren Grundlage 1997 ein Fördermodell für energiesparende Maßnahmen in Kraft trat. 1998 wurde Ludesch Mitglied im e5-Programm des Landes Vorarlberg, einer an Qualitätsmanagementsysteme in der Wirtschaft angelehnten Initiative zur Qualifizierung und Auszeichnung von energieeffizienten Gemeinden. Der Bedarf nach einem neuen Gemeinde- und Kommunikationszentrum wurde erstmals 1995 formuliert, 1998 kam es zur Bildung einer Arbeitsgruppe, 2000 wurde das Architekturbüro Hermann Kaufmann mit der Planung beauftragt. Ziele der Gemeinde waren die Schaffung eines baukulturell hochwertigen Ortszentrums mit verschiedenen Nutzungen, die Errichtung eines ökologischen Vorzeigeprojekts im Rahmen eines vertretbaren finanziellen Aufwands und die Beteiligung der Bürger am Entstehungsprozess.
Haus der Zukunft
Auf Ansuchen der Gemeinde wurde das Projekt in die Programmlinie „Haus der Zukunft“ im Rahmen des Impulsprogramms „Nachhaltig Wirtschaften“, das 1999 als Forschungs- und Technologieprogramm vom Bundesministerium für Verkehr, Innovationen und Technologie gestartet wurde, aufgenommen. Damit sollen, aufbauend auf der solaren Niedrigenergiebauweise und dem Passivhaus-Konzept eine bessere Energieeffizienz, verstärkter Einsatz erneuerbarer Energieträger, nachwachsender und ökologischer Rohstoffe sowie eine stärkere Berücksichtigung von Nutzungsaspekten und Nutzerakzeptanz bei konventionellen Bauweisen gegenüber vergleichbaren Kosten erreicht werden. Das Programm schreibt den Nachweis und die genaue Dokumentation all dieser Aspekte vor, um konkrete Informationen für innovatives Bauen weitergeben zu können.
Städtebauliches Konzept
Aufgrund der Kleinteiligkeit und Heterogenität des in letzter Zeit stark gewachsenen Straßendorfs war die Neuinterpretation der ortsräumlichen Situation wesentlich. Der zweigeschossige Neubau bildet nun eine dreiseitige Klammer, die nach Nordwesten offen ist und als Abschluss der Dorfstraße gelesen werden kann. So entsteht ein klar gefasster Außenraum, dessen hohes Kommunikationspotenzial durch Geschäfte, Amts- und Vereinslokale sowie eine gläserne Überdachung noch verstärkt wird. Jeder der drei Gebäudeflügel ist eine eigenständig organisierte Funktionseinheit, im Keller sind alle miteinander verbunden.
Planung und Konstruktion
Die höchstmögliche Vermeidung von Schadstoffen durch Energieoptimierung und umweltbewusste Materialwahl sollte die ökologische Nachhaltigkeit des Gemeindezentrums gewährleisten. Erreicht wurde die Energieoptimierung durch Minimierung der grauen Energie mittels entsprechender Materialwahl, Minimierung der Betriebsenergie mittels optimierter Gebäudehülle und Passivhaustechnologie sowie den Einsatz nachwachsender Energieträger und Umweltenergie.
Bezüglich der Materialwahl wurden folgende Kriterien berücksichtigt:
* Regionale Wertschöpfung, weitgehende Verwendung von heimischem Holz
* Konstruktiver Holzschutz, keine Holzanstriche
* Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Schafwolle)
* Verzicht auf PVC, auf Lösungsmittel, auf HFKW (Halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe) und auf formaldehydhaltige Werkstoffe.
Als Planungsinstrumente standen der „Ökoleitfaden Bau“ als Teil des ÖkoBeschaffungsService Vorarlberg (öbs) und der „ibo-Passivhaus-Bauteilkatalog“, der sowohl eine bauökologische als auch eine baubiologische Optimierung erlaubt, zur Verfügung.
Konkret wurde ein Holzbau aus Weißtanne auf einem Stahlbetonkellergeschoss umgesetzt. Das benötigte Konstruktions- und Fassadenholz konnte über die örtliche Agrargemeinschaft an Ort und Stelle bezogen werden, im Innenausbau kam Holz aus dem Schwarzwald (80%) und den Vogesen (20%) zum Einsatz, wobei durch unterschiedliche Bearbeitungsmethoden, die von sägerau über gebürstet bis zu gehobelt reichen, eine vielfältige gestalterische Differenziertheit erreicht wurde. Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs lassen sich auch an der Gestaltung ablesen: So werden etwa maßhaltige Bauteile wie Fenster und Türen durch Vordächer in der Deckenebene und die Fassaden durch eine transluzente Platzüberdachung geschützt.
Die Holzkonstruktionen wurden von zwei heimischen Firmen in der Halle vorgefertigt und dann an Ort und Stelle zusammengebaut. Die Außenwanddämmung besteht aus Altpapierschnitzeln, in die Zwischenwände und -decken wurde Schafwolle eingelegt. Zur Montage wurden Betonanker, Schrauben und Klebebänder verwendet, um Leimverbindungen möglichst zu vermeiden. Hohe Aufmerksamkeit wurde außerdem auf die Dichtheit der Konstruktion sowie den Verzicht auf gesundheitsschädliche Stoffe, die sich negativ auf das Raumklima auswirken könnten, gelegt. Eine Folge dieser Bemühungen ist die Entwicklung PVC-freier Fugenbänder, die der Hersteller inzwischen in seinem Standardsortiment anbietet.
Die gesamte Materialwahl und -verwendung unterlag strengen, kontinuierlichen Kontrollen, ein Datenblatt für jedes der 214 eingesetzten Produkte gibt genau Bescheid über deren Zusammensetzung.
Passivhaus und Biomasse
Wesentlich für die Erfüllung der Ansprüche an ökologisches und nachhaltiges Bauen war die Errichtung des Gemeindezentrums als Passivhaus, wodurch sein Wärmebedarf unter 15 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter und Jahr liegt. Erreicht wurde dieser hervorragende Wert durch Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung, besonders gute Dämmung, hohe Dichtheit der Konstruktion sowie eine Lüftungsanlage für kontrollierte Be- und Entlüftung, die mit einer Grundwasserpumpe verbunden ist und alle Räume kontinuierlich und auf die jeweilige Nutzung abgestimmt, mit Frischluft versorgt. So wird die konstante Temperatur des Grundwassers im Winter zur Wärmegewinnung und im Sommer zur Kühlung genutzt, Wärmeverlust durch unsachgemäßes Lüften hingegen vermieden. Ebenso unterliegt die Luftfeuchtigkeit ständigen Messungen und, sollte sie zu niedrig sein, Korrekturen. Warmes Wasser liefert eine 30m² große thermische Solaranlage am Dach des Gebäudes. Wird mehr Heizenergie benötigt, wird diese vom nahen Biomasse-Fernheizwerk der Ludescher Agrargemeinschaft bereitgestellt. Insgesamt wird hier eine Fläche von 22 durchschnittlichen Einfamilienhäusern mit dem Energieaufwand zweier konventionell gebauter Einfamilienhäuser klimatisiert.
Die Kosten
Die Errichtung des Gemeindezentrums kostete netto 5,9 Mio Euro. Einen großen Teil des Planungs- und Umsetzungsprozesses nahm die Überwachung der anfallenden Kosten ein. Akribisch wurden alle Zahlen dokumentiert, doppelt – unter hochwertig herkömmlichen und ökologischen Kriterien – ausgeschrieben und Vergleichsanbote eingeholt. In Summe schlug sich die Verwendung ökologischer Materialien in der Konstruktion mit Mehrkosten von 83.000 Euro (1,9%) zu Buche. Mehrkosten verursachten auch die innovative Haustechnik (145.000 Euro) und die Photovoltaik-Anlage (210.000 Euro). In Hinblick auf Gesamtlebensdauer und niedrige Betriebskosten können diese jedoch vernachlässigt werden. Zudem konnten durch die ökologischen Maßnahmen Fördermittel von Land und Bund lukriert werden, wodurch sich der Mehraufwand bereits halbiert, dazu kommen noch Einnahmen aus Vermietung und Stromerzeugung.
Stromerzeugung
Mehrere Funktionen werden von der Platzüberdachung des Gemeindezentrums erfüllt: Neben der gestalterischen Wirkung und ihrer Schutzfunktion für Holzfassaden und Fenster vor direkter Bewitterung, dient die 350m² große Fläche aus durchsichtigen Photovoltaik-Elementen zur Erzeugung von jährlich 16.000kWh umweltfreundlichen Stroms, der in das Netz der Vorarlberger Kraftwerke eingespeist wird. Damit können fünf Haushalte mit Strom versorgt werden.
Zusammenfassung
Der Primärenergiebedarf für die Errichtung des Gemeindezentrums lag bei weniger als 18kWh pro Quadratmeter. Für die Herstellung der Baumaterialien wurde also bezogen auf die erwartete Lebensdauer des Gebäudes nur etwa die Hälfte jener Energie benötigt, die sonst üblich ist, das Treibhauspotenzial ist sogar um zwei Drittel geringer. Das Gemeindezentrum verfügt über Geschäfte, öffentliche Flächen und Vereinsflächen, womit eine wertvolle Nutzungsvielfalt und -flexibilität gewährleistet ist. Damit wurde der Anspruch, der sich aus der Idee nachhaltigen Bauens ableitet, dass das Gebäude gegenwärtigen Bedürfnissen optimal entsprechen sollte, ohne künftigen Generationen eine Nachnutzung aufzuzwingen oder Entsorgungsprobleme zu hinterlassen, in der Praxis umgesetzt und bewiesen, dass sich mit Hilfe vorhandener Planungsinstrumente ein gesamtökologischer und nachhaltiger Ansatz auch im öffentlichen Bauwesen ohne wesentliche Mehrkosten realisieren lässt.zuschnitt, Mi., 2006.12.20
20. Dezember 2006 Eva Guttmann
verknüpfte Bauwerke
Gemeindezentrum Ludesch
Von Bestand
(SUBTITLE) Umbau einer Tenne in Lans
Der Vorwurf, Nachhaltigkeit sei ein mehrdeutiger Begriff, beruht auf einem sprachlichen Missverständnis: Selbstverständlich ist das Adjektiv „nachhaltig“ mehrdeutig, solange nicht angegeben ist, was nachhaltig sein soll ... Daraus entstehende Unklarheiten sind nicht dem Begriff, sondern ausschließlich dessen Benutzern anzulasten.
aus: Petra Stephan, Nachhaltigkeit – ein semantisches Chamäleon
Für viele Spaziergänger scheinen die beiden Gebäude in der Nähe des Lanser Sees bei Innsbruck seit Generationen unverändert. Perfekt im Gelände platziert, wirken das Bauernhaus und die angrenzende Tenne so, als könnte ihnen nichts und niemand etwas anhaben.
Das Leben des Bauherrn hat sich über die Zeit sehr wohl verändert. Er lebt und arbeitet in China, ist dort verheiratet und wollte am elterlichen Grundstück einen Ort für sich und seine Familie schaffen.
Architekt Martin Scharfetter erkannte das Potenzial der seit langem leerstehenden Tenne und schlug dem Bauherrn einen Umbau der etwas anderen Art vor.
Der Bestand, eine Holzkonstruktion mit 13x14 m Grundfläche, sollte als Hülle für das Haus dienen. Balken, Stützen, Schwellen und Pfetten blieben erhalten und formen weiterhin das Traggerüst für die neue Nutzung. Alles andere wurde entfernt, das Dach mit Tonziegeln neu gedeckt.
Als Material für den Neubau, kam aus logistischen Gründen nur Holz in Frage, da alles andere im Inneren schwer manövrierbar gewesen wäre. Das neue Wohnhaus sollte sich innerhalb des Bestandes entwickeln und erst am Ende konnte die äußere Holzschalung der ehemaligen Tenne entsprechend adaptiert werden.
Das Tiroler Raumordnungsgesetz beschränkte die Errichtung zusätzlicher Wohnnutzfläche. Stadt- und Ortsbildschutz erlaubten keine großen Änderungen im Bestand. Zusätzlich wollte man im neuen Haus auf eine gewisse Wohnatmosphäre aus der zweiten Heimat China nicht verzichten. Zu viele Vorgaben für ein so kleines Objekt? Mit sehr viel Leichtigkeit gelang es Martin Scharfetter, die strengen Parameter zu dematerialisieren. Das Projekt gewinnt dadurch an Komplexität und schafft es trotzdem, die Gegenüberstellung zweier Kulturen, zweier Konstruktionen in keinem Punkt banal werden zu lassen. Alt und Neu, Tradition und Moderne werden in Form von vielschichtigen Räumen miteinander in Einklang gebracht. Die Tenne und das neue Wohnhaus bilden eine Symbiose und lassen die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwimmen.
Die Konstruktion wurde als zweistöckiges Fachwerk mit stumpfen Stößen und einfachen Dübelverbindungen errichtet. Dabei war es dem Architekten wichtig, das Wohngebäude als eigenständigen Baukörper und im Einklang mit dem Bestand zu bauen. In diesem Sinne wurden alle Vorgaben, wie etwa die Lage der Pfetten oder die Position der alten Treppe, sorgfältig in die Planung integriert.
Im Inneren trifft man auf eine unerwartete Kombination aus hellem Birkenholz für die Deckenuntersichten, Eichenholz für die Stiege und Lärchenholz für die Fenster. Der rustikal anmutende Lehmputz und der helle Steinboden passen sich der asiatischen Raumausstattung an und neutralisieren die bunte Mischung an Einrichtungsgegenständen. Die chinesische Möblierung, Seidentapeten und Tatamis werden vom Gebäude wie selbstverständlich aufgenommen.
Eindeutig modern sind die großen Glasflächen und die Staffelung der Zwischenzonen. Dabei ergeben sich Raumhöhen von nur zwei Metern im japanisch inspirierten Essbereich mit großer Verglasung, fast sechs Meter über der Terrasse. Der Bezug zwischen Innen und Außen, die multifunktionalen Zwischenräume sowie die Balance zwischen Individualität und Unterordnung unter ein allgemeines Prinzip werden zu Grundthemen des Entwurfs.
Die Außenverschalung des Tennengebäudes wurde nach Vorgabe des neuen Inneren partiell entfernt bzw. als Sicht- und Sonnenschutz adaptiert. Nur an wenigen Stellen durchbricht ein Raum die alte Holzschalung und macht auf die neue Nutzung dahinter aufmerksam. In den übrigen Bereichen tritt die neue Hülle elegant in den Hintergrund und sorgt für eine Vielfalt an überdachten Außenräumen. Die gedämmte Fassade wurde mit Fichtenholz beplankt und schwarz gestrichen. Direkte und indirekte Leuchtkörper lassen nachts die Schichtungen im Inneren erkennen und für den Bauherrn wird der äußerst subtile Übergang zwischen Neu und Alt einmal mehr zum Raumerlebnis.
Nicht nur die architektonischen Qualitäten des Umbaus, sondern auch Materialwahl und Flexibilität der Räume lassen die Bezeichnung nachhaltig zu und es liegt nahe, auch die neue Nutzung als eindeutigen Mehrwert darzustellen, ohne den der Weiterbestand des Wirtschaftsgebäudes wohl nicht gesichert gewesen wäre.
Stellt man also die Gleichung nachhaltig = zukunftsfähig an, beweist das Projekt von Martin Scharfetter, dass auch eine Tenne als nachhaltig gelten kann.zuschnitt, Mi., 2006.12.20
20. Dezember 2006 Karin Triendl
verknüpfte Bauwerke
„wohnen im heu“
Dritter Frühling Lux Guyers Saffa-Haus
Das in der Schweiz legendäre Saffa-Haus ist seit diesem Sommer an seinem dritten Standort in Stäfa, Kanton Zürich, wieder aufgebaut. Es handelt sich um das 1928 in Bern an der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (Saffa) gezeigte, kostengünstige Fertighaus aus Holz der Architektin Lux Guyer.
Ein Prototyp und Ausstellungsobjekt für wenige Monate, ein Wohnhaus mit Erweiterung für 70 Jahre und seit Sommer dieses Jahres in ursprünglicher Form und mit neuem Zweck am dritten Standort aufgebaut – das Saffa-Haus von Lux Guyer, der ersten Architektin der Schweiz mit eigenem Atelier, lässt sich mit Fug und Recht als Ikone und sowohl architektonisch wie technisch herausragendes Beispiel für nachhaltiges Wirken sehen.
Die drei Leben eines Pionierbaus aus Holz der 1920er Jahre
Das Saffa-Haus, dieses bedeutende Pionierwerk aus den zwanziger Jahren, hat eine bewegte Geschichte. Es entstand aus Anlass der ersten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit Saffa (1928) in Bern als zwar fertig gebauter, dort aber bloß für Schauzwecke ausgestatteter Prototyp. Nach Ende der Saffa wurde das Haus verkauft, demontiert, in Aarau neu aufgebaut und während rund siebzig Jahren als Wohnhaus genutzt. Mit der Zeit wurde der Holzbau erweitert, doch waren diese Anbauten zum Glück so konzipiert, dass die originalen Bauteile mehr oder weniger unangetastet überlebten. Das Umfeld des Standorts in Aarau verwandelte sich nach und nach in eine Industriezone, das Wohnhaus wurde dort zum Exoten und diesem wichtigen Zeitzeugen drohte 1999 der Abbruch. Interessierte Kreise gründeten 2002 den „Verein prosaffahaus“. Sie erreichten in verhältnismäßig kurzer Zeit das Ziel, das Haus zu demontieren, vorerst in Aarau einzulagern und nun in Stäfa am Zürichsee wieder aufzubauen und öffentlich nutzbar zu machen.
Diese dritte Nutzung demonstriert eindrücklich die Dauerhaftigkeit der damals eigens entwickelten Konstruktion aus Holzelementen. Sie waren rasch montiert, demontiert, eingelagert und neu wieder zusammengesetzt – ein im besten Sinn und tatsächlich nachhaltig erdachtes und konstruiertes Haus.
Die Konstruktion
Das Saffa-Haus gehört zu den ersten Fertighäusern aus Holz in der Schweiz. Der Bau besteht aus massiven, normierten Holzelementen und basiert auf einem damals neuen Patent der Firma Holzbau Lungern. Mit diesem Bausystem wären solche Häuser praktisch überall zu erstellen gewesen, doch machten die in den Jahren nach der Saffa ausgebrochene Weltwirtschaftskrise und später der Krieg solche Visionen für die Vorfabrikation aus Holz zunichte.
Wie gut sich dieses Bausystem bewährt hat, illustriert die Tatsache, dass beim Wiederaufbau nach rund 75 Jahren fast alle Holzelemente noch intakt waren. Einzig beim Bad war ein Holzteil durch Feuchte angegriffen und musste ausgewechselt werden. Und beim Ausbau waren die Einbauschränke und Täfelungen zum Teil zu rekonstruieren.
Der Wiederaufbau der Grundsubstanz erfolgte innert sechs Tagen. Die Grundrissaufteilung blieb an den drei Standorten weitgehend gleich, der architektonisch funktionale Grundgedanke von Lux Guyer wurde immer respektiert. Beate Schnitter, Architektin in Zürich, führte die Restaurierung detailgetreu durch und gab dem Haus nicht nur seine ursprüngliche Form zurück, sondern rekonstruierte mit Respekt und Können auch die ursprüngliche Atmosphäre.
Die Architektur
Das Saffa-Haus ist architekturgeschichtlich ein Pionierwerk. Lux Guyer erreichte mit diesem Bau eine Synthese der traditionellen bürgerlichen Wohnkultur – insbesondere des englischen Landhauses – und der radikalen Moderne des Neuen Bauens. Zudem ist das Haus mit seinem Raumprogramm visionär, denn mit seinen vielseitig nutzbaren Räumen ermöglicht es ein partnerschaftlich orientiertes Zusammenleben. Die Räume weisen eine handliche Größe auf, wirken großzügig und hell und ermöglichen durch ihre Anordnung ungewöhnliche Raumkombinationen. Die Fenster, teilweise über Eck, sind so angeordnet, dass vielfältige Möglichkeiten der Möblierung offenbleiben. Der Ausbau ist bis in die Einzelheiten sehr sorgfältig geplant und lässt mit Einbauschränken, Regalen und Schwingtüren auch praktischen Überlegungen Raum. Mit seinem Walmdach und der Fassade mit rötlichen Eternitschindeln strahlt dieses radikal modern konzipierte Holzhaus auch nach außen Geborgenheit aus.
Neue Nutzung am Standort Stäfa
Der Gemeinderat von Stäfa hat sich vom Saffa-Haus begeistern lassen und stellte dem Verein prosaffahaus ein passendes Grundstück zur Verfügung (Tödistrasse 1). Der Wiederaufbau kostete 1,4 Mio Franken, ein Betrag, der dank der Großzügigkeit von über 200 Personen, Institutionen, Unternehmungen und der öffentlichen Hand zusammenkam. Vier Jahre nach seiner Gründung konnte im Sommer 2006 der Verein das Haus der Gemeinde übergeben. Gemäß Vertrag ist die Gemeinde Stäfa verpflichtet, dieses überkommunale Schutzobjekt öffentlich zugänglich zu machen. Sie hat es dem Stäfener Eltern-Kind-Zentrum zur Nutzung überlassen.
Das Saffa-Haus macht am neuen Ort den Eindruck, als sei es schon immer dagewesen, so selbstverständlich integriert erscheint es im neuen Kontext. Dies bestätigt und würdigt die avantgardistischen Ideen und Vorstellungen der Architektin Lux Guyer, die es vor achtzig Jahren wagte, ein fertiges Haus für viele Standorte zu propagieren. Es bestätigt ihre Überzeugung, dass ein solches Haus mit seinen im Entwurf eingeschriebenen Eigenschaften vielen unterschiedlichen Menschen eine individuelle Nutzung zu bieten und gleichzeitig die räumliche Integration in den jeweiligen Siedlungskontext qualitativ zu leisten vermag. zuschnitt, Mi., 2006.12.20
20. Dezember 2006 Charles von Büren
verknüpfte Bauwerke
Wiederaufbau SAFFA-Haus