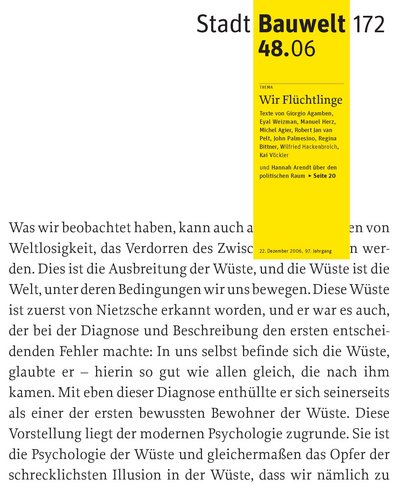Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Ikone der Moderne. 80 Jahre Bauhaus-Gebäude in Dessau Jan Friedrich
03 Dan-Flavin-Retrospektive in München Sandra Hofmeister
03 Kirchen in der Stadt. Veranstaltungsreihe in NRW Gudrun Escher
04 „Bottom Up“ im AzW in Wien Charlotte Friedrich
04 Zum Hamburger Architektur Sommer Olaf Bartels
04 Martin Stollenwerk: SBB Bauten von Max Vogt Hubertus Adam
05 Mona Breede in Berlin Michael Kasiske
WETTBEWERBE
08 Palais de Justice in Paris Doris Kleilein
10 Entscheidungen
12 Auslobungen
THEMA
14 Wir Flüchtlinge Giorgio Agamben
20 Hannah Ahrendt über den politischen Raum
22 Urban Design durch Zerstörung Eyal Weizman
32 Flüchtlingslager im Tschad Manuel Herz
50 Zwischen Stadt und Krieg Michel Agier
58 Eine kurze Geschichte des Lagers Westerbork Robert Jan van Pelt
62 Neutralität John Palmesino
66 NGO-Stadt Kabul Regina Bittner, Wilfried
Hackenbroich, Kai Vöckler
REZENSIONEN
74 Theorie des Städtebaus Roland Stimpel
74 Sprawltown Susanne Schindler
75 5 Codes Friedrich von Borries
76 Halle-Neustadt Führer Ulrich Brinkmann
76 Building with Earth Jürgen Tietz
RUBRIKEN
06 wer wo was wann
06 Leserbriefe
71 Autoren
72 Kalender
78 Anzeigen