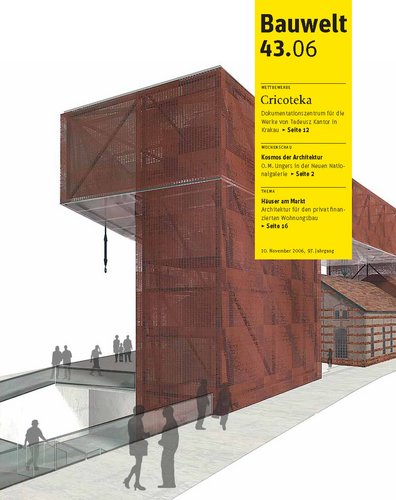Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Kosmos der Architektur. Ungers in der Neuen Nationalgalerie | Peter Rumpf
03 Humboldthafen in Berlin | Jan Friedrich
03 Gartenstadt Atlantic | Silke Reifenberg
04 Stuttgart 21. Abschied vom Großprojekt? | Ursula Baus
05 Megalopolis Shanghai | Olaf Bartels
05 Messe „denkmal“ in Leipzig | Sebastian Redecke
BETRIFFT
10 „Europaviertel Hellersdorf“ | Ulrich Brinkmann
WETTBEWERBE
12 Cricoteka in Krakau | Doris Kleilein
14 Autobahnkirche in Niedersachsen | Sebastian Redecke
15 Auslobungen
THEMA
16 Baustelle Stadt | Klaus Theo Brenner
24 Maßarbeit für die Bauherrengemeinschaft | Christiane Gabler
28 Typologische Unschärfe am Markt | Michael Kasiske
32 Organisiertes Licht am Nordhang | Oliver Elser
REZENSIONEN
39 Der ideale Grundriss. Das Einfamilenhäuser-Planbuch | Frank F. Drewes
39 Im Detail: Reihen- und Doppelhäuser | Volker Lembken
RUBRIKEN
07 wer wo was wann
38 Kalender
41 Anzeigen