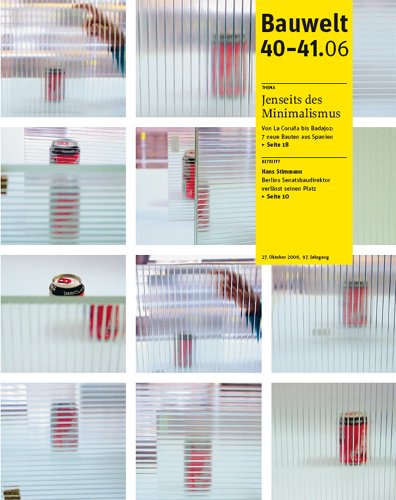Inhalt
Wochenschau
02 Asmara – Afrikas heimliche Hauptstadt der Moderne | Dagmar Hoetzel
03 plan 06 in Köln | Gudrun Escher
03 Peter Zumthor: Laudatio auf die Kölner Oper | Uta Winterhager
04 Salvatorgarage in München | Jochen Paul
05 Michaela Meliáns „Föhrenwald“ | Christoph Tempel
06 Entwicklung des Roche-Areals in Basel | Hubertus Adam
07 Werkschau Stefan Forster | Jan Friedrich
07 Novartis-Campus in Basel | Jan Friedrich
betrifft
10 Hans Stimmann, Senatsbaudirektor | Felix Zwoch
Wettbewerbe
12 Rathaus in Gouda (Niederlande) | Doris Kleilein
14 Entscheidungen
16 Auslobungen
Thema
18 Spanische Architekten suchen neue Inhalte | Kaye Geipel
20 Air Trees in Vallecas | Kaye Geipel
26 Tanzschule und Museum in La Coruña | Kaye Geipel
30 Kongresszentrum in Badajoz | David Cohn
36 7 Hyperminimal Articles | Federico Soriano
38 Verwaltungsgebäude in Bilbao | Kaye Geipel
42 Gemischter Block in Barcelona | Kaye Geipel, Jaime Coll und Judith Leclerc
48 Verwaltungsgebäude in Madrid | Kaye Geipel
54 Granitmauer in Santiago de Compostela | Kaye Geipel
rezensionen
60 Die Schweiz – Ein städtebauliches Porträt, Markus Flückiger
Rubriken
09 wer wo was wann
58 Kalender
62 Anzeigen